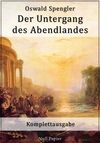Buch lesen: «Deutsche Geschichte», Seite 11
Welfen und Staufer
Mit Lothar von Süpplingenberg kam noch einmal ein Kaiser aus sächsischem Stamme auf den Cäsarenthron. Lothars Vater, Graf Gebhard, fiel 1075 in einer Schlacht gegen Heinrich IV., der Sohn übernahm sein Rebellentum. Durch seine Heirat mit Richenza, einer reichen Erbin, der Schwester Eckberts von Meißen, der einer der mächtigsten Gegner Heinrichs IV. und auf seine Veranlassung, wie man sagte, ermordet war, verstärkte sich ihm die kaiserfeindliche Tradition. Trotzdem erhob ihn Heinrich V., als im Jahre 1106 die Billunger ausstarben, zum Herzog von Sachsen, um den nicht verächtlichen Feind zu gewinnen. Aber der Ausspruch Herzog Bernhards, zwischen einem Erzbischof von Bremen und einem Herzog von Sachsen könne so wenig Freundschaft sein wie zwischen Feuer und Wasser, konnte man auch auf den Kaiser und Sachsen anwenden: es kam bald wieder zu Feindseligkeiten und im Jahre 1115 zu der furchtbaren Schlacht am Welfesholze, wo Graf Hoyer von Mansfeld, der Ungeborene, Niebesiegte, der auf kaiserlicher Seite focht, fiel, und durch welche Heinrich V. aus Sachsen verdrängt wurde. Sein Tod verhinderte ihn, das aufrührerische Land zu unterwerfen, das unter Lothar selbstständiger als je war. Lothar verstärkte die herzogliche Gewalt über die Großen, wählte mit kundigem Blick geeignete Personen für die wichtigen Stellungen und betrieb erfolgreich was jetzt für Sachsen die Hauptaufgabe war, die Eroberung des slawischen Gebiets. Fast wie ein Kaiser des Nordens stand er dem salischen Kaiser gegenüber und war für dessen Gegner der gegebene Prätendent. Dass die Erzbischöfe von Köln und Mainz sich ihm verbanden, verschaffte ihm die Wahl im Gegensatz zum Herzog Friedrich von Schwaben, der als Neffe Heinrichs V. sich zur Nachfolge berechtigt fühlen durfte. Friedrich war der Sohn der Agnes, der einzigen Tochter Heinrichs IV., die er seinem Anhänger, dem Grafen Friedrich von Büren, zur Frau gegeben hatte. Indessen, während herkömmlicherweise das Wahlrecht der Fürsten durch Berücksichtigung der Verwandtschaft beschränkt wurde, betonten jetzt die Fürsten gern ihr Wahlrecht, indem sie die Verwandten übergingen. Denjenigen Fürsten, der als Schwiegervater Herzog Friedrichs von Schwaben naturgemäß auf staufischer Seite stand, der als mächtiger Herr ein gefährlicher Gegner war, Herzog Heinrich den Schwarzen von Bayern, gewann Lothar dadurch, dass er ihm die Hand seiner einzigen Tochter und Erbin, Gertrud, für seinen Sohn versprach. Durch diese Heirat verdichtete sich der Gegensatz zwischen dem Norden und Süden Deutschlands zum Gegensatz zwischen den Familien der Welfen und Staufer, der jahrhundertelang Deutschland und auch Italien zerrissen hat. Die Welfen, ursprünglich ein schwäbisches Geschlecht, führten ihren Ursprung tief in die Vergangenheit zurück: ihre Stammväter sollen unter Odoaker gegen den letzten römischen Kaiser gefochten haben. Zu Karls des Großen Zeit waren sie Grafen im südlichen Schwaben; die schöne Welfin Judith wurde die zweite Frau Ludwigs des Frommen. Ihr Bruder Eticho I. betrachtete es als Erniedrigung, dass sein Sohn Lehensmann des Kaisers wurde, zog sich in ein Kloster zurück und sah den Sohn, der seine Unabhängigkeit preisgegeben hatte, nie wieder. Welf III., der letzte des alten Stammes, begab sich auf den Ruf Heinrichs IV. nach den Ronkalischen Feldern südlich von Piacenza, wo nach altem Brauch die Reichsversammlungen in Italien abgehalten wurden; als er drei Tage lang vergeblich gewartet hatte, da der Kaiser am rechtzeitigen Erscheinen verhindert worden war, zog er mit seinem Gefolge ab und ließ sich vom Kaiser, den er unterwegs traf, weder durch Bitten und Versprechungen noch durch Drohungen zur Rückkehr bewegen. Durch die Heirat der Schwester dieses Welf, Kunizza, mit dem Markgrafen Azzo von Este, verband sich die aussterbende ältere mit einer jüngeren Linie, die nach Italien gewandert und dort begütert war. Der Sohn des Azzo und der Kunizza, Welf IV., wurde Herzog von Bayern und war der erste aus der Familie, der Güter von Bischöfen und Äbten zu Lehen nahm. Dass diese stolze und reiche Familie sich zur Kaiserwürde berufen fühlte, ist natürlich. Die Staufer hatten der rühmlichen Herkunft und dem Reichtum der Welfen ihre Verbindung mit den Saliern und später bedeutende Persönlichkeiten entgegenzusetzen.
Lothar war ein tüchtiger Herrscher. Er erreichte, dass sowohl Böhmen wie Dänemark in ein Vasallenverhältnis zu ihm traten; die Chroniken berichten mit Genugtuung, wie bei der Osterfeier in Halberstadt der dänische König dem mit dem Diadem geschmückten Lothar als Lehens- und Gefolgsmann das Schwert nachtrug. Auch in Italien vertrat er das Reich würdig. Während seiner Regierung kam das Zusammenwirken von Kaiser und Papst, das die Theorie verlangte, wie kaum jemals sonst zustande. Allerdings bestand er nicht auf der Rückgabe des Investiturrechtes, obwohl er einsah, dass ohne dies Recht eine kraftvolle Regierung nicht möglich war, und es deshalb auch forderte; allein er gab nach, um im einzelnen Falle doch selbstherrlich zu handeln. So hielt er das Reichskloster Monte Cassino fest, das der Papst an sich ziehen wollte, und setzte durch, dass der Normannenherzog in Süditalien nicht vom Papst allein, sondern vom Papst und ihm gemeinsam belehnt wurde. Vorwerfen konnte man ihm, dass er die sogenannten Mathildischen Güter, ein zerstreutes Gebiet, das sich teilweise mit dem heutigen Toskana deckt, vom Papst zu Lehen nahm, wodurch der Papst in die Lage kam, den Kaiser als seinen Lehensmann zu bezeichnen. Er unterließ nicht, sich in einer Inschrift im Lateranpalast, die er über dem Bilde Lothars anbringen ließ, damit zu brüsten. Lothar konnte zu seiner Entschuldigung sagen, dass es nur zweierlei gab, entweder Nachgiebigkeit des Kaisers in gewissen Punkten, um dadurch Nachgiebigkeit von seiten des Papstes zu erhandeln, oder dauernden Kampf. Persönlich war Lothar tapfer, meist glücklich im Kriege, Feinden und Besiegten gegenüber so grausam, so erschreckend roh, wie es im Charakter der Zeit lag, unermüdlich tätig, obwohl er, als er König wurde, sechzig Jahre alt war. Schon krank beschleunigte der Zweiundsiebzigjährige seine Rückkehr aus Italien, um in der Heimat zu sterben; aber nur der Tote erreichte sie und wurde in der von ihm gegründeten Stiftskirche zu Lutter, seitdem Königslutter, bestattet. Neben ihm ruhen seine geliebte Frau Richenza, die ihn immer begleitete, sein Schwiegersohn, Herzog Heinrich der Stolze von Bayern, der sein siegreicher Mitstreiter in Italien gewesen war, und seine Tochter Gertrud.
Große Macht empfahl damals nicht zur Kaiserwahl; die Fürsten sahen deshalb nach Lothars Tode von Heinrich dem Stolzen ab, der zugleich über Sachsen und Bayern gebot, und wählten Konrad von Staufen, den Bruder desselben Friedrich, der sich gegen Lothar nicht hatte durchsetzen können. Um seines Gegners Macht zu mindern, nahm ihm Konrad das Herzogtum Bayern und gab es seinem Halbbruder Leopold, dem Sohn des Markgrafen von Österreich, den seine Mutter Agnes, die Tochter Heinrichs IV., nach dem Tode ihres ersten Mannes geheiratet hatte. Nach dem frühen Tode Heinrichs des Stolzen erneuerte Konrad den Versuch, Welfen und Staufer durch eine Heirat zu versöhnen, indem er die Witwe Gertrud, die berühmte Sächsin, wie die Chroniken der Zeit sie nennen, mit seinem Halbbruder Heinrich verheiratete. Sie starb schon im folgenden Jahre an einer schweren Geburt und hinterließ ihr Erbe ihrem Sohn aus erster Ehe, der wie sein Vater Heinrich hieß und später der Löwe genannt wurde.
Konrad III. war sowohl an Liebenswürdigkeit wie an Erfolglosigkeit dem fränkischen König Konrad I. ähnlich, und auch darin, dass er hochherzig genug war, mit Übergehung seines eigenen, noch im kindlichen Alter stehenden Sohnes seinen bereits bewährten Neffen, Friedrich, Herzog von Schwaben, zur Nachfolge zu empfehlen. Friedrich I., der in Italien, wo seit der Zeit des Arminius das blonde Gelock der Germanen geliebt wurde, den Beinamen Barbarossa erhielt, ist ein Symbol der Kaiserzeit geworden, einer, dessen Name für alle steht, vielleicht deshalb, weil der Mittagshöhe seiner Regierung so bald der Absturz folgte. Wie die ersten Salier waren die Staufer ein herrisches Geschlecht, streng gegen andere und streng gegen sich im Erfassen ihrer kaiserlichen Pflicht. Die Möglichkeit, dass das Reich eine Erbmonarchie werde, in den Augen der Fürsten und des Papstes eine große Gefahr, brachten sie der Verwirklichung nah. Karl den Großen und Otto den Großen hatte Friedrich I. als Vorbilder stets vor Augen; was ihn persönlich von ihnen unterschied, war seine wachsame Selbstzucht an Stelle ihres breiteren, argloseren Sichgehenlassens. Friedrich hatte nicht den hohen Wuchs der Salier, er war nur mittelgroß, aber seine Haltung war so königlich, dass er trotzdem durch seine Erscheinung imponierte. Das Imperatorische seiner Gesinnung äußerte sich in seinen Mienen, die immer das Bewusstsein der Größe seiner Aufgabe widerspiegelten. Es machte großen Eindruck, dass er nach der Salbung und Krönung in Aachen, als einer seiner Dienstmannen, der wegen eines schweren Verbrechens in Ungnade gefallen war, sich ihm zu Füßen warf in der Meinung, in diesem Augenblick auf Verzeihung rechnen zu können, ihn abwies mit der Begründung, nicht aus persönlicher Abneigung, sondern um der Gerechtigkeit willen sei der Schuldige von seiner Gnade ausgeschlossen und müsse es bleiben; damit schien er anzudeuten, dass er sich mehr von der Gerechtigkeit als von der Gnade wolle leiten lassen. Strenge Beobachtung des Rechtes hat er sich während seiner ganzen Regierung angelegen sein lassen.
Seine erste Sorge ließ es Friedrich sein, die Spaltung im Reiche, die sich im Gegensatz der Staufer und Welfen ausdrückte, zu überwinden. War er doch im Hinblick darauf gewählt worden, dass er aus der Ehe eines Staufers mit einer Welfin stammte – seine Mutter war Judith, Tochter Herzog Heinrichs des Schwarzen von Bayern – sodass man sagte, er könne wie ein Eckstein die Kluft zwischen den zwei Häusern schließen. In großartiger Weise führte er die Versöhnung dadurch herbei, dass er seinem um sieben Jahre jüngeren Vetter Heinrich, dem Herzog von Sachsen, das Herzogtum Bayern wiedergab. Das war deshalb schwierig, weil Bayern zuvor dem Markgrafen Heinrich Jasomirgott von Österreich wieder abgenommen werden musste, der Friedrichs Halbbruder war und keinen Anlass zu irgendeiner Klage gegeben hatte. Nach umständlichen Verhandlungen glückte es dem König, den Besitzwechsel ohne Erregung von Feindseligkeiten zu vollziehen, indem er einen Teil von Bayern abtrennte und mit Österreich vereinigte und die bisherige Markgrafschaft zum Herzogtum Österreich erhob. Vor der Stadt Regensburg fand im September 1157 die in der Folge so bedeutungsvolle Handlung statt: Heinrich Jasomirgott verzichtete auf Bayern, indem er dem Kaiser sieben Fahnen übergab, die der Kaiser seinem Vetter Heinrich überreichte; von diesen gab Heinrich zwei, die die Ostmark bedeuteten, dem Kaiser zurück, der sie nunmehr seinem Halbbruder gab als Zeichen der Belehnung, nachdem er die Ostmark mit den übrigen österreichischen Grafschaften zu einem Herzogtum Österreich zusammengeschlossen hatte. Eine besondere Begünstigung war es, dass Heinrich Jasomirgotts Frau an der Belehnung teilnahm, damit die Erbfolge auch in weiblicher Linie Geltung habe. Friedrich hatte bewusst einen Feind, seinen Vetter Heinrich, zu einem sehr mächtigen Manne gemacht, indem er darauf rechnete, einen mächtigen und dankbaren Freund zu gewinnen. Der großmütige Gedanke war klug, wenn der Herzog von Bayern und Schwaben seine Macht für den Kaiser einsetzte. Dann stand die gesamte Macht des geeinigten Deutschland dem Kaiser zur Verfügung.
Die zweite schwere Aufgabe, die den jungen König erwartete, war das Verhältnis zum Papst und zu Italien zu ordnen. Wie er das Verhältnis zum Papst auffasste, zeigte er dadurch, dass er gegen den Willen des Papstes auf der Einsetzung des Bischofs Wichmann von Zeitz zum Erzbischof von Magdeburg bestand und sie durchsetzte.
Kaiser und Papst
Das Gefühl des deutschen Volkes war so beleidigt durch die Art und Weise, wie Heinrich V. seinen Vater überlistet und vergewaltigt hatte, dass es in ihm als dem einzigen in der Reihe seiner Kaiser nur den Bösen sehen konnte; aber wenn er auch ganz ohne die gemütlichen Züge war, die dem Deutschen das Bild seiner Großen liebenswert machen, hat er doch tatkräftig und folgerichtig regiert, und zwar gerade in Bezug auf das Verhältnis des Reichs zur Kirche. Heinrich V. hatte sich mit päpstlicher Unterstützung gegen seinen Vater aufgelehnt, um das Reich an sich zu bringen, nicht um ein Werkzeug des Papstes zu werden. Da er als König fortfuhr, Bischöfe einzusetzen, als verstehe sich das von selbst, brach der Streit zwischen Kaiser und Papst sofort wieder aus. Paschalis II. liebte die Deutschen nicht, aber er war ein ehrlicher Gegner und rein in seiner kirchlichen Überzeugung, zu ehrlich, zu rein für einen Papst, der zugleich Beherrscher Italiens und der Welt sein wollte. Als der König den Papst fragen ließ, was denn aus ihm werden solle, und was denn die Grundlage des Reiches bilden solle, wenn ihm die Investitur der Bischöfe entrissen werde, da ja die früheren Könige fast alles der Kirche übergeben hätten, antwortete der Papst: die Kirche solle mit dem Zehnten und Opfer zufrieden sein, der König aber solle alle Güter und Regalien, die von Karl, Ludwig, Otto, Heinrich und seinen übrigen Vorgängern der Kirche übergeben worden wären, für sich und seine Nachfolger zurückerhalten. Er selbst wolle die Güter und Regalien auf rechtliche Weise der Kirche nehmen. Es war eine Antwort, wie ein Kind sie hätte geben können, die einzige Antwort, die dem Recht entsprach, verblüffend in der Einfachheit und Schärfe, mit der sie den unlösbaren Knoten des Konfliktes durchschnitt. Der Kaiser, ein besserer Menschenkenner als der Papst, glaubte nicht an die von jenem eröffnete Möglichkeit; aber er konnte dabei nur gewinnen und stimmte zu. Eine Bereicherung der Krone, wie kein König sie mehr zu denken wagte, wäre die Rückgabe des Kirchengutes gewesen, von unabsehbaren, vielleicht umwälzenden Folgen für das Reich. So wurde im Jahre 1111 die merkwürdige Vereinbarung abgeschlossen, bei welcher der König auf die Investitur verzichtete, und der Papst eine Urkunde aufsetzte, um im Namen der kirchlichen Würdenträger die Regalien, die sie seit Karl dem Großen erhalten hatten, zurückzugeben. Der entrüstete Widerspruch der italienischen wie der deutschen Bischöfe zwang Paschalis, sein gegebenes Wort zurückzunehmen, worauf der König um den Verrat zu rächen, mit einem Heer Rom überfiel und den Papst nebst einigen Bischöfen und Kardinälen gefangennahm. Allein er hatte zu viel Feinde, um in diesem Streite siegen zu können: ein Teil der Bischöfe, Burgund und Frankreich traten auf die Seite des Papstes, vor allen Dingen war es aber wieder der Abfall der Sachsen, der ihn nötigte, seine Macht gegen den Norden zu wenden. Beide Teile sahen endlich ein, dass sie vom Äußersten ihrer Ansprüche etwas aufgeben mussten, und so kam im Jahre 1122 auf einem Fürstentage zu Worms das Konkordat zustande; der unglückliche Paschalis war einige Jahre vorher gestorben. Der Kaiser gewährte allen Kirchen sowohl im Königreiche wie im Kaiserreiche die kanonische Wahl, nämlich die Wahl der Bischöfe durch das Kapitel, und überließ dem Papst und der Kirche die Investitur mit Stab und Ring; der Papst, es war Calixtus II., erteilte dem König das Privileg, dass die Wahl der Bischöfe und Äbte in seiner Gegenwart vollzogen werde, dass er bei strittiger Wahl das Recht des Schiedsspruchs habe und dass in Deutschland der Gewählte vor dem Empfang der kirchlichen Weihe mit den Regalien zu belehnen sei. Im Kaiserreich hingegen, das heißt in Burgund und Italien, solle die Weihe der Belehnung mit den Regalien vorangehen. Der Papst ließ den Text des Wormser Konkordates als Inschrift in einem Gemach des Laterans anbringen, obgleich er sich kaum einbilden konnte, er habe einen bedeutenden Erfolg errungen. Im Grunde war das, worauf der König verzichtete, geringer, als das, was er gewann. Dass einer bedeutenden Persönlichkeit die Möglichkeit blieb, einen beherrschenden Einfluss auf die Bischöfe auszuüben, zeigte sich während der ganzen Regierung Friedrichs I.
Von Friedrich Barbarossa könnte man vielleicht sagen, dass er die Genialität der Gesundheit besaß. Er war nicht hervorragend begabt, aber doch genug, um alle Verhältnisse gut beurteilen zu können, der gesunde Menschenverstand ersetzte, was ihm an Bildung fehlte. Er sprach gut und gern; als er die ersten Proben seiner Redekunst gab, herrschte allgemeines Erstaunen über dies Vermögen eines Ungelehrten. Man behauptete, wenn er nicht lateinisch spreche, unterlasse er es nur, um als Deutscher die deutsche Sprache zu ehren. Er konnte liebenswürdig und fröhlich sein, aber immer auf dem Grunde des gesammelten Ernstes, den sein hohes Amt forderte. Andererseits ließ er sich durch keinen Schicksalsschlag, deren ihn so manche trafen, entmutigen oder nur niederdrücken; niemand sah ihn je anders als aufrecht und zuversichtlich. Das wurde ihm durch seine kräftige Körperlichkeit erleichtert. Er war wie in Drachenblut gebadet, ohne dass eine verletzliche Stelle geblieben wäre; noch als älterer Mann war er im Turnier und in der Schlacht immer frisch, immer freudig bei der Sache, immer königlich sicher. In der Kraft seiner Persönlichkeit besaß er den Zauber, der das Glück und die Menschen fesselt.
Im Beginn seiner Regierung hatte der König Gelegenheit, einen Vorteil über den Papst davonzutragen. Schon zurzeit seines Vorgängers machte die Stadt Rom den Versuch, sich vom Papst unabhängig und zu einer selbstständigen Republik zu machen. In Erinnerung an ihre einstige Größe wurde ein Senat eingesetzt, der Konrad III. aufforderte, zu kommen und nach Beseitigung des klerikalen Widerstandes von ihm die Krone zu empfangen. Konrad antwortete nach längerem Zögern so, dass er für die Einladung dankte und sein Kommen in Aussicht stellte, die gemeldete Neuordnung aber unerwähnt ließ. So ging, ohne dass von kaiserlicher Seite davon Notiz genommen wurde, die römische Bewegung weiter und verband sich mit dem von religiösen Ideen ausgehenden Kampfe des Arnold von Brescia gegen die weltliche Macht der Kurie. Was dieser vom geistlichen Standpunkt aus verlangte, dass der Papst sich auf das Geistliche beschränke, wollten die Römer, um von der päpstlichen Herrschaft unbehindert ihre Stellung als herrschender Weltstaat wiedergewinnen zu können. Papst Eugen IV. wurde vertrieben, Arnold und die Stadt Rom forderten Friedrich auf, sich in Rom die Kaiserkrone zu holen. Vermutlich kam ihm so wenig wie Konrad auch nur auf einen Augenblick der Gedanke, sich auf diese Weise von seinem mächtigen Gegner zu befreien. Die Römische Republik hatte kein Gewicht im Gedächtnis der germanischen Könige gegenüber der Erinnerung an das Römische Kaiserreich. Gewiss war Rom für sich kein Machtbereich und mit seinem anspruchsvollen, unruhigen Adel und seiner beschäftigungslosen Bevölkerung uneinig und unzuverlässig; aber Arnold von Brescia hatte Anhänger, und es war denkbar, dass ein über ein starkes Heer gebietender König mit den Kräften, die sich ihm in Rom zur Verfügung stellten, etwas ausrichten könnte. Das alles aber, was die Römer vorbrachten, war für den König leerer Schall. Wirklichkeit hatte für ihn nur das Imperium, das von Gott den deutschen Königen vermittels des Papstes übertragen war, wovon die Krönung und Salbung durch den Papst in Rom die vollendenden Zeichen waren. Er zweifelte an der Kirche mit ihrem Oberhaupt, dem Papst, so wenig wie an Gott, so wenig wie am Imperium der deutschen Könige und seinem eigenen Recht.
Dem glücklichen politischen Gedanken Friedrichs, der Versöhnung mit den Welfen, dankte er es, dass er sich ungehemmt nach Italien wenden konnte; es zeigte sich, dass einem deutschen Könige, der über alle Mittel des Reiches verfügen konnte, noch eine große Machtfülle zu Gebote stand. Das einige Reich, einig durch das Zusammenwirken zweier Fürsten, erregte überall Bewunderung und Schrecken. Die Könige von Dänemark, Ungarn, Polen, durch dynastischen Zwist geschwächt, mussten sich abhängig bekennen. Nach Italien zog Friedrich mit dem Entschluss, dieselbe Stellung wiederzugewinnen, die Karl der Große und Otto der Große eingenommen hatten. Er fand Entgegenkommen beim Adel und Widerstand bei den Städten, namentlich bei Mailand, der größten und reichsten; aber gerade darauf legte er Wert, dass er die Mittel der reichen handeltreibenden Städte in die Hand bekäme. Nach altem Herkommen hielt er eine Tagung auf den Ronkalischen Feldern, wo die Lehensträger zu erscheinen und ihre Lehen in Empfang zu nehmen hatten. Dort wurde mit Hilfe von juristisch gebildeten Personen untersucht, was dem Kaiser zustehe, was nicht; denn es war Friedrich ernst damit, sein Recht, aber nichts als das in Anspruch zu nehmen. Die Juristen der berühmten Schulen von Bologna und Padova unterstützten ihn über Erwarten; für ihre formalistische Denkart kam einem römischen König deutscher Nation als Nachfolger der römischen Cäsaren dieselbe unumschränkte Herrschaft zu wie den Kaisern des Altertums. Nach ihren Ansprüchen war ein römischer König nicht sehr verschieden von einem Despoten, der über Hab und Gut seiner Untertanen verfügen kann. Friedrich war sich bewusst, dass er in Rechtsfragen an die Zustimmung der Großen seines Reiches gebunden war; aber die aus dem römischen Recht geschöpften Sentenzen über die Göttlichkeit der Kaiserwürde hoben doch sein imperatorisches Selbstgefühl. Vor allen Dingen den Städten gegenüber glaubte er unbedingter Herr zu sein; er sah in ihnen nicht wie im hohen Adel Genossen, nicht wenigstens durch den kriegerischen Beruf ihm Angeglichene wie die Dienstleute, die Ministerialen, sondern dem Stande nach Tieferstehende, emporgekommene Untertanen, die schlechtweg zu gehorchen hatten. Allerdings achtete er die von seinen Vorgängern erteilten Privilegien, nicht aber, was durch Gewohnheit üblich geworden, von den Ausübenden als Recht betrachtet wurde. Friedrichs Auftreten war unwiderstehlich, der Anblick schon seiner kriegstüchtigen deutschen Ritter, ihrer gleichmäßig kraftvollen, elastischen, blitzenden Gestalten verbreitete Schrecken. Den befestigten Städten gegenüber mit ihren gewaltigen Türmen und Bastionen genügten allerdings die Katzen und Igel und Widder nicht, wie denn im ganzen Mittelalter sehr selten eine Belagerung den Zweck erreichte; aber in offener Schlacht blieben die Deutschen Sieger.
Obwohl Friedrich das aufrührerische Rom unterwarf, Arnold von Brescia auslieferte und dem Papst die Rückkehr in seine Stadt ermöglichte, blieb Hadrian I., der einzige Engländer auf dem römischen Stuhle, misstrauisch ablehnend. Da bei der Begegnung Friedrich sich weigerte, dem Papst den Stallmeisterdienst zu leisten, nämlich ihm beim Besteigen des Pferdes den Steigbügel zu halten, weigerte sich der Papst, obwohl Friedrich ihm den Fuß küsste, ihm den Friedenskuss zu geben. Getreu seinem Gerechtigkeitssinn rief Friedrich die Fürsten, die ihn begleiteten, zusammen und überließ ihnen zu entscheiden, was Rechtens sei. Das Reich sollte darüber entscheiden, was sich mit kaiserlicher Ehre vereinen lasse. Das Urteil der Herren fiel zugunsten des Papstes aus: es war Überlieferung, dass Pipin der Kurze dem Papst, als er ins Frankenreich kam, den Marschallsdienst geleistet habe, und die älteren unter den Anwesenden erinnerten sich, von Lothar dasselbe gesehen zu haben. Friedrich fügte sich der Entscheidung und hielt im Angesicht des Heeres dem Papst die Steigbügel, worauf er den Friedenskuss empfing. Zwei in der Wurzel feindliche Gewalten wurden durch künstliche Veranstaltung auf der schmalen Schneide des Einverständnisses erhalten. Nun wurde Friedrich nach altem Ritual zum Kaiser geweiht. Vor der silbernen Pforte der Peterskirche hielt der Bischof von Albano das erste Gebet, mitten in der Kirche der Bischof von Porto das zweite: »Gott, du geheimnisvoller Schöpfer der Welt – schütte auf die Fürbitte aller Heiligen über diesen König das Füllhorn deines Segens aus und festige den Thron seines Reiches. Suche ihn heim wie den Moses im Dornbusch … und übergieße ihn mit deinem Sternensegen und dem Tau deiner Weisheit wie David und seinen Sohn Salomon.« Es folgte die Salbung durch den Erzbischof von Ostia und ein Gebet, dass durch das heilige Öl der Segen des Tröstergeistes in das Herz des Königs eindringen und ihm die Gabe verleihen möge, Unsichtbares zu empfangen, und, nachdem er in Gerechtigkeit und Erbarmung seines zeitlichen Reiches gewaltet, ewiglich mit Christus zu herrschen. Dann war der Augenblick gekommen, wo der Papst dem Knienden das Diadem aufsetzte mit den Worten: »Empfange das Ruhmeszeichen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, damit du unter Verachtung des alten Feindes und aller Sündenberührung Recht und Gerechtigkeit liebest und dich in diesem Leben so erbarmungsvoll zeigest, dass dir unser Herr Jesus Christus in der Gemeinschaft der Heiligen die Krone des ewigen Reiches verleihe.« Als der erschöpfte Kaiser sich zurückziehen und speisen wollte, überfielen die Römer den Papst, und er musste den ganzen Tag durch kämpfen. Am anderen Morgen verließ er, den Papst und die Kardinäle mit sich nehmend, Rom, und der Papst erteilte denen, die im Kampfe Blut vergossen hatten, Ablass. Dabei berief er sich auf gewisse kirchliche Zeugnisse, wonach der Krieger, der, im Gehorsam gegen seinen Fürsten, kämpfend Blut vergießt, nach irdischem und himmlischem Gesetz kein Mörder, sondern ein Strafvollstrecker sei.
Eine merkwürdige Schickung wollte, dass dieser selbstbewusste und dennoch, obwohl zuweilen hart und zuweilen durch Zorn und das Gefühl gekränkter Majestät zu grausamen Handlungen bewogen, maßvolle König, sich dem Einfluss eines Mannes ergab, der ihn auf eine gefährliche Bahn und in dramatische Verwicklungen riss, wie sein eigener Charakter sie womöglich vermieden hätte. Dieser Mann war der Kanzler des Reichs, Rainald, aus dem Geschlecht der an der Weser begüterten Grafen von Dassel. Beherrschte er den Kaiser, weil er so sehr von ihm verschieden war? In ganz anderer Art wie Friedrich war auch er zum Herrscher geboren, so wie ein heidnischer Wikingerführer, dem die Welt gehört, soweit er sie erobern kann. Friedrich war ganz und gar Imperator, sich immer der furchtbaren Verantwortung bewusst, mit der die Krone des großen Karl ihn belastete, und die nur ein streng zusammengefasster Geist ertragen konnte. Rainald von Dassel fühlte sich nur seinem Genie verantwortlich. Sein Genie schuf ihm ein Reich, in dem er auch das Abenteuerliche wagen konnte, wenn es heroisch war. Er erkannte die Mächte seiner Zeit wohl an, die Kirche, den Kaiser und seine Genossen, die Fürsten; aber sie banden seinen Geist nicht und kaum seine Hände. In seinem Gefolge befand sich häufig ein Dichter, der der Nachwelt unter dem Namen des Erzpoeten bekannt ist. Diesem Namenlosen, der nichts besaß als seine klangvollen Verse, mag der Kanzler sich mehr verwandt gefühlt haben als dem Kaiser oder irgendeinem anderen Menschen. Der Dichter spielte ihm eine Musik jenseits aller Dinge, jenseits auch alles dessen, was die Kirche lehrte. In seinem persönlichen Leben war Rainald tadellos, enthaltsam, unangreifbar; man weiß nichts von Frauenliebe in seinem Leben. Er war gebildet, las gern die alten Schriftsteller, aber sein Element war das tätige Leben als Staatsmann und Kriegsmann. Wie von den Königen haben die Zeitgenossen von ihm überliefert, dass weiches Blondhaar sein schönes gebräuntes Gesicht umgab; das Jahr seiner Geburt hingegen haben sie nicht aufgezeichnet. Man kann annehmen, dass er etwa 35 Jahre alt war, als er zum ersten Male maßgebend in der Öffentlichkeit hervortrat.