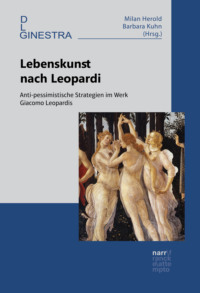Buch lesen: "Lebenskunst nach Leopardi"

Barbara Kuhn / Milan Herold
Lebenskunst nach Leopardi
Anti-pessimistische Strategien im Werk Giacomo Leopardis
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
[bad img format]
Umschlagabbildung: Ausschnitt aus Sandro Botticelli, La Primavera, 1482. Bildquelle: commons.wikimedia.org/wiki/File:Botticelli-primavera.jpg
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung des Romanischen Seminars der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
ISSN 1436-2260
© 2020 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
www.narr.de • info@narr.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8416-8 (Print)
ISBN 978-3-8233-0278-0 (ePub)
Inhalt
Zeit, Gesang und Lebenskunst I. Leopardis Vögel II. Der Vogel und der Mensch III. Literatur und Lebenskunst Literatur
I LEBENSBEGRIFFE
Zur «arte del vivere» ...Zwischen anti-pessimistischem Kalkül und latentem OptimismusI.II.III.IV.LiteraturLeopardi persuasore di vita?Bibliografia‹Dal nulla alla vita›1. Die Entdeckung des Nichts und die teoria del piacere2. Der Lebensbegriff und die Kraft der Imagination3. Das Unbestimmte – L’indefinito4. Anschlüsse: Agamben, EspositoLiteratur
II HEITERKEITEN«Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst»1. Heiterkeit I – Canti2. Heiterkeit II – Operette moraliLiteraturHeiterkeit, posthuman1. Fragile Emanzipation: Die Storia dell’astronomia und der Saggio sopra gli errori popolari degli antichi2. Kosmoklasmus: Operette morali3. Siderales Sehen: Canti4. Schluss: Undichte Pessimismen?Bibliographie
III LYRISCHE STRATEGIEN
Il Risorgimento di Leopardi ...«Chi mi ridona il piangere dopo cotanto obblio?»BibliografiaVerwirrung als ProgrammStruktur und Inhalt von Il tramonto della lunaDer Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummieDie Canzone Alla sua donnaSpuren einer PersonalitätFazitLiteratur
IV LEOPARDI IM DIALOG
Per un’ironia più che ...La satira di Leopardi contro l’Ottimismo di LeibnizLeopardi e LeibnizVoltaire: un modello di ironia militantePascal e l’ironia socraticaUn’ironia più che romanticaBibliografiaLa felicità delle chimere«Due anime nel petto»«Concepire le cose che non sono»Un singolare «genio familiare»Il piacere dell’inesistenteIl sogno dell’infinitoBibliografia«Leopardi produce l’effetto contrario a quello che si propone»LiteraturPoetische Lebens-Kunst mit LeopardiI. ‹Nacktes› LebenII. Anrufung des Großen BärenIII. WahrheitserfahrungIV. Zumutbarkeit schaffenLiteratur
Zeit, Gesang und Lebenskunst
Zur Frage einer «arte del vivere» nach Leopardi Einführende Überlegungen
Tempo, canto e arte del vivere
Modi e concetti di un’«arte del vivere» leopardiana Riflessioni preliminari
Barbara Kuhn
Della lettura di un pezzo di vera, contemporanea poesia, in versi o in prosa […], si può, e forse meglio, (anche in questi sì prosaici tempi) dir quello che di un sorriso diceva lo Sterne; che essa aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita. Essa ci rinfresca, p. così dire; e ci accresce la vitalità.
(Zibaldone 4450, 1. Feb. 18291)
Und wie seltsam wird das Phrasengeräusch der Pessimisten von der Nichtigkeit der Welt übertönt durch dieses memento vivere ihres größten Dichters!
(Paul Heyse2)
«Kennen Sie Leopardi, Ingenieur, oder Sie, Leutnant?» Nicht von ungefähr stellt in Thomas Manns 1924 erstmals in Buchform erschienenem Zauberberg Lodovico Settembrini diese Frage an Hans Castorp und dessen Vetter Joachim. Offenbar konnte der Italiener solche Kenntnis nicht voraussetzen, denn er fährt fort: «Ein unglücklicher Dichter meines Landes, ein bucklichter, kränklicher Mann mit ursprünglich großer, durch das Elend seines Körpers aber beständig gedemütigter und in die Niederungen der Ironie herabgezogener Seele, deren Klagen das Herz zerreißen. Hören Sie dieses!», und man kann sich fragen, was Settembrini dann wohl vor den beiden Herren, die ihn nicht verstehen, rezitiert, bevor er weiter über den «Krüppel Leopardi», über die «Verkümmerung seiner Seele» und sein «[V]erzweifel[n] an Wissenschaft und Fortschritt»3 räsonniert: vielleicht A se stesso, An sich selbst, in dem dem Ich die Welt nur mehr wie Schlamm erscheint, «e fango è il mondo» (v. 10)? Vielleicht die ironischen «magnifiche sorti e progressive» aus La ginestra (v. 51 [die «großartige[n] und fortschrittliche[n] Geschicke»])? Oder vielleicht Sapphos letzte[n] Gesang, den Ultimo canto di Saffo, ehe die unglückliche Dichterin sich – möglicherweise – vom Leukadischen Felsen stürzt?
Die Spekulation über das ungeschriebene Tun einer Romanfigur braucht nicht fortgeführt zu werden; sie ist ebenso müßig wie die Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob Settembrini möglicherweise die Operette morali, vor allem den Dialog zwischen der Natur und einer Seele, allzu schlicht und unmittelbar auf deren Schöpfer bezogen hat, wenn er von Tragik spricht und von der grausamen Natur, die «einen edlen und lebenswilligen Geist mit einem zum Leben nicht tauglichen Körper verband» und so die «Harmonie der Persönlichkeit» gebrochen oder «von vornherein unmöglich»4 gemacht habe. Zu erwägen ist aber dennoch die Frage, warum Settembrini diese Frage überhaupt stellen muß und zudem, offenbar zu recht, davon ausgeht, daß seine deutschen Zuhörer den berühmten italienischen Dichter nicht kennen, denn dieser Befund, der hier im Rahmen der Fiktion knappe 100 Jahre nach der Entstehung von Leopardis Texten angestellt wird, scheint auch weitere knappe 100 Jahre später in Teilen immer noch zuzutreffen, wenn etwa noch in einer 2002 erschienenen Dissertation statt von einer «fortuna di Leopardi in Germania» nur von einer «sfortuna» zu lesen ist, von Mißgeschick und Unglück, und dies konkretisiert wird in den Worten:
Im Falle Leopardis ist die merkwürdige Situation zu konstatieren, daß über einen Autor der hierzulande traditionell so beliebten italienischen Kultur und Literatur, der in seinem Heimatland ähnlich aufbereitet ist wie in Deutschland Goethe, Kafka oder Thomas Mann […], auch nach zweihundert Jahren vor allem Klischees kursieren.5
Doch nicht nur im deutschen Sprachraum existieren solche Klischees, existieren jene Schubladen, in die Leopardi oft vorschnell gesteckt wird, auch wenn hier möglicherweise das eine oder andere Mißverständnis in Übersetzungen und Deutungen des komplexen Werks eine zusätzliche Rolle spielen mag6 und auch wenn insbesondere das große Interesse Schopenhauers, der glaubte, in dem Dichter aus Recanati einen Geistesverwandten gefunden zu haben, die Rezeption vor allem, wenngleich keineswegs nur7 hierzulande in eine spezifische Richtung lenkte. Die wichtigste und beliebteste Schublade, die bis in die Gegenwart immer wieder dazu dient, diese Texte in ihrer Komplexität, ihrer Offenheit und Vieldeutigkeit weniger zu erschließen, als zu verbergen, indem sie ihnen, statt Offenheit und Vieldeutigkeit zuzulassen, ein einheitliches Etikett aufklebt und sie so teilweise bis zur Unkenntlichkeit reduziert,8 ist eben die des angeblichen, gleichsam mantraartig wiederholten und daher schon fast legendären Pessimismus, der in seinen diversen Spielarten durch viele Publikationen geistert. So ist etwa die Rede von einem individuellen oder psychologischen Pessimismus, in einer nächsten Phase von einem historischen Pessimismus, die schließlich gar gekrönt werde von einem allumfassenden kosmischen Pessimismus in den letzten Lebens- und Schaffensjahren – aber ganz gleich, welche Facette gewählt wird, sie reduziert stets das vielgestaltige und vieldeutige Werk Leopardis auf die eine und in sich schon reduktive Dimension: auf jenes Stereotyp des Pessimismus, das einem sich unaufhörlich verändernden Dichten, einem Denken in ständiger Bewegung nicht gerecht werden kann.9
Ein Text, der nicht nur besonders häufig Gegenstand der Forschung geworden ist, sondern zudem vielfach mit der beliebten Pessimismus-Formel bedacht wurde, ist Il passero solitario, der daher besonders geeignet scheint, um in einführenden Überlegungen der Frage nach möglichen anti-pessimistischen Strategien und nach jener spezifischen Lebenskunst nachzugehen, von der Leopardi im 79. seiner Pensieri handelt: jener Frage, der sich auch der 30. Leopardi-Tag der Deutschen Leopardi-Gesellschaft vom 18. bis zum 20. Juli 2019 an der Universität Bonn, dem Gründungsort der Gesellschaft, in einer Vielzahl von breit gefächerten Vorträgen, Diskussionen und einer Lesung von Burkhart Kroeber aus seiner Übersetzung der Operette morali widmete. Denn einmal mehr zeigt sich auch und gerade im Passero solitario, daß entgegen der verbreiteten Forschungsmeinung, die versucht, den Text bruchlos mit der Pessimismus-These zu verknüpfen, eine genaue Lektüre des Gedichts, die auf dieses vermeintliche Geländer verzichtet und sich statt dessen auf den Text selbst einläßt, anderes sichtbar zu machen vermag als nur die erneute Bestätigung des allzuoft Wiederholten10.
Anders als in der großen Mehrzahl der dem «Passero» gewidmeten Beiträge der Forschungsliteratur, die vor allem anderen und immer wieder den Fragen der Entstehungszeit des canto, seiner Quellen und der mit dem «passero solitario» gemeinten Vogelart nachging11, nähern sich die hier vorgeschlagenen Überlegungen dem Gedicht von einigen anderen Vögeln im Werk Leopardis her an, die die mit den fliegenden und singenden Wesen verknüpften Konnotationen in Erinnerung rufen und so die Lektüre des Gedichts, statt primär durch bisherige Forschungsbeiträge, durch die Bilder-, Klang- und Gedankenwelt des Leopardischen Werks grundieren.
I. Leopardis Vögel
Während in Alla primavera o delle favole antiche der «Musico augel»1 oder «sangeskundige[…] Vogel […] die Rückkehr | des Frühlings», «il rinascente anno» (v. 71sq.), in «klangreichen Lieder[n]» besingt, die, anders offenbar als die Lieder dieses hier singenden Ich, keine Klagelieder sind, nicht aus dem Schmerz entstehen («quelle tue varie note | Dolor non forma», v. 78sq.), vermißt die unglückliche Dichterin Sappho gerade den «canto | De’ colorati augelli», der «me non […] saluta» (Ultimo canto di Saffo, vv. 29–31 [«Mich begrüßt nicht | der farbigen Vögel froher Gesang»]): Noch in der Negation durch das lyrische Ich hebt das Gedicht so das herausragende Charakteristikum der Vögel desto stärker hervor: Vor allem anderen singen sie, und kaum ist der Sturm vorbei, singen sie schon wieder, wie das berühmte Incipit von La quiete dopo la tempesta erinnert: «Passata è la tempesta: | Odo augelli far festa» (v.1sq. [«Vorüber ist das Gewitter. | Vögel höre ich jubeln»]).2 Entsprechend scheint diesen gefiederten Wesen ein leichteres Leben vergönnt, wie auch der Hirte im Canto notturno di un pastore errante nell’Asia oder Nachtgesang eines Hirten, der in Asien umherstreift, sich vorstellt:
Forse s’avess’io l’ale
Da volar su le nubi,
E noverar le stelle ad una ad una,
O come il tuono errar di giogo in giogo,
Più felice sarei, dolce mia greggia,
Più felice sarei, candida luna.
O forse erra dal vero,
Mirando all’altrui sorte, il mio pensiero:
Forse in qual forma, in quale
Stato che sia, dentro covile o cuna,
È funesto a chi nasce il dì natale. (Canto notturno, vv. 133–143)
[Vielleicht, wenn ich Flügel hätte, | über den Wolken zu fliegen, | die Sterne zu zählen, einen nach dem andern, | oder als Donner von Berg zu Berg zu irren, | wäre ich glücklicher, du liebe Herde, | wäre ich glücklicher, du weißer Mond. | Oder vielleicht irrt mein Sinn, wenn er das Schicksal | andrer betrachtet, und verfehlt die Wahrheit. | Vielleicht bringt einem jeden, | ob in der Höhle, ob in der Stube geboren, | der Tag der Geburt schon sein Verhängnis.3]
Wie in den drei zuvor zitierten Texten geht es auch in diesem Gedicht nicht eigentlich um Vögel, aber dennoch werden diese hier am Ende über die Flügel als zweitem Spezifikum neben dem Gesang sozusagen synekdochisch ins Gedicht hereingeholt: Mit den Flügeln assoziiert der singende Hirte die Vorstellung des Fliegens, das ihm wie eine Befreiung aus seiner Beschränkung erscheint. Fliegend, so denkt er, könnte er sich über sein kleines, unbedeutendes Dasein erheben, darüber schweben und damit über den bedrängenden Fragen seines Lebens, über der Frage nach dem Sinn des lebenslangen Sich-Abmühens stehen, und dann wäre er, wie die anaphorische Wiederholung des «Più felice sarei» unterstreicht, glücklicher.
Trotz dieser Selbstbeschwörung jedoch ist dieses Glück nur im Konditional zu haben, nur in der Abhängigkeit vom Bedingungssatz, der durch seine Form und zudem durch das einleitende «Vielleicht» (v. 133) schon Zweifel anmeldet, und diese Zweifel am ‹Dann wäre ich glücklicher› werden noch hartnäckiger, wenn das «Vielleicht» gleich zweimal (v. 139 und 141) wiederholt wird: Vielleicht ist auch dies ja nur eine Illusion. Zur Gewißheit gelangt der singende Hirte nicht mit seinem Canto notturno, im Gegenteil; er gelangt zum dreimaligen «Forse», das mithin das ist, was vor allem stehen bleibt am Ende des Gedichts: Sicher ist nicht, daß er fliegend sein Glück fände, sicher ist aber ebensowenig, daß alles von Geburt an unheilvoll ist; sicher ist allein die im «forse» signalisierte und mit dem Gesang realisierte Möglichkeit des Gedankenflugs, die Möglichkeit, sich im canto dank der Imagination momentan aus seinem Trübsinn zu befreien, auch wenn das Ich dadurch nicht zum bewußtlosen Tier wird, sondern eher ein Melancholiker bleibt, wie sein bilder- und gedankenreicher canto in seinen suggestiven Klängen belegt.
Während hier der Hirte an seinem «pensiero» festhält und nur – aber immerhin – im dreimaligen «forse» dessen Relativierung durch andere Denk- und Lebensweisen andeutet, inszeniert Leopardi in einem anderen Text einen Philosophen, der, seinem sprechenden Namen zufolge, ein «spensierato» ist, Amelio, der Sorgenfreie oder, wörtlicher, Gedankenlose, der demnach seine Gedanken auch in der «immensità» des weiten Himmels fliegen lassen kann: Wie das Ich des Infinito, das sie in der Unermeßlichkeit des Meeres versinken läßt und so den Schiffbruch als Wonne erlebt, weil die Gedanken es einmal nicht weiter verfolgen4, imaginiert Amelio sich als frei, unbeschwert und unbekümmert über allem fliegender und singender Vogel. In diesem Fall handelt es sich nicht um einen der Canti, nicht um ein Gedicht, sondern um eine der Operette morali, den Elogio degli uccelli, das Lob der Vögel, das, anders als die meisten Operette, nicht in Dialogform gehalten ist, sondern nach einer kurzen Einleitung, wie der Titel ankündigt, der Form des Enkomion gehorcht. Hier heißt es über den Philosophen und die Situation, in der das Enkomion entsteht:
Amelio filosofo solitario, stando una mattina di primavera, co’ suoi libri, seduto all’ombra di una sua casa in villa, e leggendo; scosso dal cantare degli uccelli per la campagna, a poco a poco datosi ad ascoltare e pensare, e lasciato il leggere; all’ultimo pose mano alla penna, e in quel medesimo luogo scrisse le cose che seguono. (153)
[An einem Frühlingsmorgen, als der einsame Philosoph Amelios umgeben von seinen Büchern lesend im Schatten seines ländlichen Hauses saß, wurde er vom Singen der Vögel ringsum so abgelenkt, dass er ihnen mehr und mehr zuhörte, über sie nachzudenken begann, schließlich das Lesen aufgab und zur Feder griff, um Folgendes zu schreiben. (161)]5
Auch hier spielt der Vogelgesang eine wichtige Rolle, der sich mithin nicht auf bloßes Zwitschern reduziert, denn vor allem zwei Gründe sind es, die Amelio, den sorgenfreien Philosophen, das Lob der Vögel singen lassen: ihr Gesang und ihr Fliegen, und damit auch jene Punkte, die den Elogio mit dem Canto notturno verbinden. So wie sich dort der Hirte in seinem Gesang Flügel zum Fliegen wünscht, so wünscht Amelio am Ende seines Elogio: «io vorrei, per un poco di tempo, essere convertito in uccello, per provare quella contentezza e letizia loro» (160 [«so wäre ich gern für ein Weilchen in einen Vogel verwandelt, um die Zufriedenheit und Heiterkeit seines Lebens zu erfahren», 171]). Und wie der Hirte glaubt, wer Flügel hat und über den Wolken fliegen kann, müsse glücklicher sein als er auf seinen beschwerlichen Erdenwegen, so vermutet auch Amelio, die Zufriedenheit und Heiterkeit der Vögel hänge mit ihrem Fliegen und unaufhörlichen Singen zusammen.
Der Gesang im allgemeinen und im besonderen der Vogelgesang ist für ihn ein Zeichen von Fröhlichkeit, gleichsam ein Lachen: Trost und Vergnügen bereite der Vogelgesang den Menschen oder, wie er vermutet, sogar allen Lebewesen, und zwar weder aufgrund der Süße des Klangs noch aufgrund seiner Vielfalt oder Harmonie, sondern weil er Freude bedeute: aufgrund «quella significazione di allegrezza che è contenuta per natura, sì nel canto in genere, e sì nel canto degli uccelli in ispecie. Il quale è, come a dire, un riso, che l’uccello fa quando egli si sente star bene e piacevolmente» (155 [aufgrund «jener Bekundung von Fröhlichkeit, die naturgemäß in jedem Gesang, besonders aber in dem der Vögel steckt. Ist er doch gleichsam ein Lachen, in das der Vogel ausbricht, wenn er sich wohl und vergnügt fühlt», 164]). Insofern die Vögel, wie Amelio fortfährt, folglich durch ihren Gesang am menschlichen Privileg, das einzige animal ridens zu sein, teilhaben, wird das Lob der Vögel insgeheim zu einem ‹Lob des Lachens› und kehrt sich damit in diesem kleinen Exkurs die Argumentation beinahe um: Obwohl die menschliche Spezies «unter allen Geschöpfen das geplagteste und elendeste» ist (164), «infra tutte le creature […] la più travagliata e misera» (155), besitzt der Mensch doch die Fähigkeit, noch unter den widrigsten Umständen zu lachen, selbst wenn er das Unglück des Lebens kennt und von der Eitelkeit aller menschlichen Güter überzeugt ist. Im Grunde scheint die Fähigkeit zu lachen ausgerechnet in jenem Wesen, das nicht nur das lachende, sondern auch das denkende Tier sein soll, zumindest paradox, wenn nicht gar eine Art momentaner Verrücktheit, eine «specie di pazzia non durabile», die sich der Mensch gelegentlich sogar durch Trunkenheit verschafft, weil es einen vernünftigen Grund zum Lachen im Dasein des unglücklichsten unter allen Lebewesen ja eigentlich nicht gebe, das Lachen aber erlaubt, sich selbst und sein Leben zeitweise zu vergessen. Dieses menschliche Lachen also sei dem Vogelgesang vergleichbar, der jedoch, und damit beschließt Amelio seinen Exkurs über das Lachen, anders als das Singen und Lachen der Menschen, das privat bleibe, dank des Wirkens der Natur öffentlich gehört werde und daher, wie jede Heiterkeit anderer, wo sie keinen Neid auslöst, tröste und erfreue:
sapientemente [la natura] operò che la terra e l’aria fossero sparse di animali che tutto dì, mettendo voci di gioia risonanti e solenni, quasi applaudissero alla vita universale, e incitassero gli altri viventi ad allegrezza, facendo continue testimonianze, ancorchè false, della felicità delle cose. (157)
[mit großer Weisheit hat die Natur es so eingerichtet, dass die Erde und die Luft erfüllt ist mit Tieren, die den ganzen Tag lang festliche Freudenstimmen erklingen lassen, als applaudierten sie gleichsam dem Leben selbst, und die anderen Wesen zum Frohsinn anstacheln, indem sie ununterbrochen Zeugnis ablegen, mag es auch falsch sein, von der Glückseligkeit aller Dinge. (167)]
Mit diesem falschen Zeugnis, das dennoch seine gute Wirkung tut, kehrt er zu den Vögeln zurück, die nicht grundlos die fröhlichsten unter allen Lebewesen seien, mithin nicht grundlos fast ununterbrochen singen und somit vom scheinbaren Glück künden können: Da sie ebenso ununterbrochen den Ort wechseln, von Land zu Land fliegen, ohne sich irgendwo lang aufzuhalten, sich aus der Tiefe bis in die höchsten Lüfte erheben, sind sie nicht der noia, der Langeweile, unterworfen und von daher viel eher dazu geschaffen, zu genießen und glücklich zu sein. Sie sehen und erfahren in ihrem Leben unendlich viele und verschiedene Dinge, kommen und gehen, wie sie wollen, nicht von irgendeiner Notwendigkeit getrieben, sie fliegen aus purem Zeitvertreib, legen nur zum Vergnügen Hunderte von Meilen zurück, um am Abend wieder zurückzukehren, und selbst wenn sie einen kurzen Moment an einem Ort bleiben, verharren sie nie in Ruhe, wie der seinerseits sich rasch hin- und herbewegende Satz illustriert:
sempre si volgono qua e là, sempre si aggirano, si piegano, si protendono, si crollano, si dimenano; con quella vispezza, quell’agilità, quella prestezza di moti indicibile. (158)
immerzu drehen sie sich hierhin und dorthin, trippeln umher, bücken sich, strecken sich, schütteln sich, alles mit einer unbeschreiblichen Lebhaftigkeit, Gewandtheit und Geschwindigkeit. (168)
Abgesehen von den Augenblicken des Schlafs kommt der Vogel vom Schlüpfen aus dem Ei bis zum Tod nie zur Ruhe, gönnt er sich nie eine Pause, wie das vielsagende und in Leopardis Texten rekurrente Verb «posare»6 signalisiert: «non si posa un momento di tempo» (158 [«ruht er […] keinen Augenblick», 168]). Zu diesen äußeren Eigenschaften des Vogels gesellen sich innere, die ihn ebenfalls fähiger zum Glück machen als alle anderen Lebewesen: Dank ihres feinen Gehörs und ihrer scharfen Augen «godono tutto giorno immensi spettacoli e variatissimi» [«genießen sie den ganzen Tag lang unermessliche und höchst abwechslungsreiche Schauspiele»], schreibt der Philosoph; sie überblicken aus der Höhe so viel Raum, sie entdecken so viele Länder, daß sie «debbono avere una grandissima forza e vivacità, e un grandissimo uso d’immaginativa» [«eine überaus große und lebhafte Phantasie haben müssen»], und zwar nicht jene, die in Unruhe und Ängste versetzen kann, sondern
quella ricca, varia, instabile, leggera e fanciullesca; la quale si è larghissima fonte di pensieri ameni e lieti, di errori dolci, di vari diletti e conforti; e il maggiore e più fruttuoso dono di cui la natura sia cortese ad anime vive. (158sq.)
[jene reichhaltige, vielfältige, leichte, unbeständige und kindliche Phantasie, die eine unerschöpfliche Quelle für angenehme und heitere Gedanken ist, für süße Irrtümer, Entzücken und Trost, mithin die größte und fruchtbarste Gabe, welche die Natur einer lebenden Seele zu schenken vermag. (169)]
Der unaufhörliche Gesang, der dem Lachen gleicht, und die ständige Bewegung, die das taedium vitae verhindert und die Einbildungskraft stimuliert, also sind es, die Amelio das Lob der Vögel singen und ihn ebenso wie den Hirten des Canto notturno wünschen läßt, zeitweise in einen Vogel verwandelt zu werden: Canto und volo stellen wie die zeitweilige Verrücktheit und die kindliche Einbildungskraft eine Opposition zur allzu engen und einseitigen Vernunft des so oft unglücklichen Vernunftwesens Mensch dar, weil sie ihm erlauben, von seiner düsteren Gegenwart abzusehen und sich kraft seiner Imagination über das gleichzeitige Wissen um die «infelicità», über das Bewußtsein von der finitudine, der Vergänglichkeit und Endlichkeit, zu erheben. Fliegen und Imaginieren, Lachen und Gesang bewirken ein momentanes Vergessen der conditio humana – aber dieses momentane Vergessen ist, gerade weil es sich um «continue testimonianze, ancorchè false, della felicità delle cose» handelt, gerade weil das Bewußtsein der Endlichkeit gleichzeitig bestehen bleibt, kein Eskapismus, sondern eher eine Reflexion über das, was im «canto», in der Fiktion, in der Dichtung geschieht und was der paradoxen Situation des Menschen in seiner Welt entspricht: Er weiß um die vanitas, er kennt die «infelicità della vita» – aber er lacht, er singt, und er dichtet. Dank seiner Sprache und seiner Imagination erfindet er all jene Welten, die der Vogel singend überquert, erfindet er den einsamen Philosophen, der von all seinem allzu menschlichen Unglück abzusehen und das Lob der Vögel zu singen vermag.