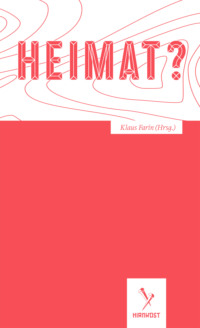Buch lesen: "Heimat?"
HEIMAT?
Klaus Farin (Hrsg.)

Originalausgabe
© 2020 Hirnkost KG
Lahnstraße 25
12055 Berlin
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage September 2020
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung; msr@rungeva.de
Privatkunden und Mailorder: https://shop.hirnkost.de/
Layout: Yunus Kleff
Illustrationen: Root Leeb
Lektorat: Gabriele Vogel
ISBN:
| PRINT: | 978-3-948675-03-5 |
| PDF: | 978-3-948675-05-9 |
| EPUB: | 978-3-948675-04-2 |
Dieses Buch gibt es auch als E-Book,
bei allen Anbietern und für alle Formate.
Unsere Bücher kann man auch abonnieren: https://shop.hirnkost.de/

INHALTSVERZEICHNIS
Klaus Farin
Leonhard F. Seid
Olufemi Atibioke
Roman Israel
Isobel Markus
Gerd Puls
Siegfried von der Heide
Sybil Volks
Dorle Gelbhaar
Joachim Ringelnatz
Reimer Boy Eilers
Ahmed Yussuf
Caritas Führer
Günther W. Hornberger
Ute Scheub
Root Leeb
Werner Schlegel
Armin Steigenberger
Mieste Hotopp-Riecke
David Kalisch
Wahid Nader
Ruth Fruchtman
Bernd-Ingo Friedrich
Axel Görlach
Kurt Tucholsky
Rudolph Bauer
Biografien
Heimat, das ist der Ort, wo sich der Blick von selbst nässt, wo das Gemüt zu brüten beginnt, wo Sprache durch ungenaues Gefühl ersetzt werden darf …
Siegfried Lenz

Vorwort
von Klaus Farin
„Heimat“ ist ein derzeit überall präsentes und diskutiertes Thema, vom „Heimatministerium“ bis zum Punk-Song, über Mode- und Biermarken bis zu Jugendprojekten. Zumeist in scheinbar unauflöslicher Verbundenheit mit dem Wort Liebe. Doch so einfach scheint das mit der „Heimatliebe“ nicht zu sein. Denn offenbar verstehen nicht alle Menschen das Gleiche darunter. Und natürlich melden sich auch jene fleißig zu Wort, denen wir die Deutungshoheit über „Heimat“ nicht unwidersprochen gestatten sollten. „Wir dürfen das Thema Heimat nicht den Rechten überlassen“, plädierte auch Robert Habeck, Schriftsteller und Parteivorsitzender, neulich im Tagesspiegel.1
„Heimat ist nur ein Gefühl“, meint Herbert Grönemeyer, der im Ruhrgebiet aufwuchs, wo „Heimatliebe“ zumeist regional, nicht national, gelebt wird und auch im 21. Jahrhundert noch eng mit dem großstädtischen Bergbau- und Arbeitermilieu verbunden ist, während nur fünfzig Kilometer weiter, im Rheinland, sich überwiegend Angehörige der gehobenen Mittelschichten zusammenfinden, um sich in „Heimat- und Bürgervereinen“ für ihre Region und ihre Mitbürger*innen zu engagieren. Landwirte fordern zum Schutz ihrer Heimat und ihrer eigenen Existenz endlich effektive Maßnahmen gegen die menschlichen Ursachen der Klimakatastrophe, während andere ihre Heimat eher durch eine sechzehnjährige Schwedin und deren Mitstreiter*innen bei den Fridays for Future gefährdet sehen. Während Geflüchtete und andere Migrant*innen versuchen, in Deutschland eine zweite Heimat zu finden, sind manche Eingeborene – in einigen Bundesländern gar über fünfzig Prozent – der Meinung, die gehören sowieso nicht zu ihrer Heimat. „Heimat“ ist eines der emotionalsten Themen überhaupt, erst recht in Zeiten, in denen politische Interessengruppen es ideologisch aufladen und für ihre Zwecke zu missbrauchen versuchen. Denn unsere Perspektive auf „Heimat“ – Wer gehört dazu? Wer nicht? – ist nicht nur durch unterschiedliche weltanschauliche Standpunkte bestimmt, sondern vor allem durch unsere eigenen autobiografischen Erinnerungen und Erfahrungen geprägt.
Welche Gefühle löst das Wort Heimat also in unseren Köpfen aus? Steht es für Sicherheit, Geborgenheit, Natur und Liebe oder wirkt es als Drohung, Ausschluss, soziale Kontrolle? Geht „Heimat“ auch ohne Nationalismus? Welche Bedeutung hat „Heimat“ für Menschen, die das Land ihrer Kindheit und Jugend verlassen mussten? Unterscheiden sich west- und ostdeutsche Heimat-Sichten? In diesem Buch spüren 25 Schriftsteller*innen literarisch und essayistisch ihren eigenen, autobiografischen Heimat-Erinnerungen und der politischen Ambivalenz der Heimat-Renaissance nach.
„Heimat, das ist der Ort, wo Sprache durch ungenaues Gefühl ersetzt werden darf …“ – Diese Anthologie unternimmt den Versuch, diese Gefühle zu fokussieren, den Blick – und die Sprache – ein wenig zu schärfen, ohne die Widersprüche aufzuheben. Es ist nicht das Ziel, eine einheitliche Sicht auf „Heimat“ zu entwickeln; das wird auch nicht möglich sein. Aber die folgenden Beiträge illustrieren, wie multiperspektivisch, facettenreich, dramatisch, humorvoll und lehrreich „Heimat“ sein kann.
Das oben aus dem Zusammenhang gerissene Zitat von Siegfried Lenz verfälscht eigentlich den konkreten Sinn des wohl berühmtesten Heimatromans des 20. Jahrhunderts. Heimatmuseum erzählt von den Versuchen, das Wissen um die Geschichte, Kultur und Traditionen Masurens zu bewahren. Das autobiografisch geprägte Werk war durchaus als Liebeserklärung des Autors an seine Heimat gedacht, die so nicht mehr existierte. So wie der Ich-Erzähler Zygmunt Rogalla in seinem Museum persönliche Zeugnisse, Alltagsgegenstände und andere Artefakte sammelt, um eine bereits in der Moderne und natürlich in der Folge des Zweiten Weltkriegs untergehende Welt für die Nachgeborenen zu erhalten, so erweckt auch Siegfried Lenz mit der ausführlichen Präsentation der Menschen, ihrer Bräuche und der Landschaft der ehemaligen preußischen Provinz im Norden Polens Masuren literarisch meisterhaft wieder zum Leben. Und in der angesprochenen Szene, die vor fast einem halben Jahrhundert niedergeschrieben wurde und dabei doch so wirkt, als wäre sie ein Kommentar zur aktuellen Diskussion, verteidigt Lenz‘ Alter Ego seine Heimat-Sicht:
Ich verstehe, mein Lieber, ich verstehe Sie schon: Sie möchten die Heimat verantwortlich machen für eine gewisse Art von hochmütiger Beschränktheit, Sie möchten ihr Fremdenhass anlasten, den bornierten Dünkel der Sesshaftigkeit. Sie möchten sie verstehen als geheiligte Enge, in der man sich unvermeidlich seine Erwähltheit bestätigen muss, mit einem gehobelten Brett vor dem Kopf.
Ich weiß, ich weiß: Heimat, das ist der Ort, wo sich der Blick von selbst nässt, wo das Gemüt zu brüten beginnt, wo Sprache durch ungenaues Gefühl ersetzt werden darf …
Damit Sie mich nicht missverstehen, ich gebe zu, dass dies Wort in Verruf gekommen ist, dass es missbraucht wurde, so schwerwiegend missbraucht, dass man es heute kaum ohne Risiko aussprechen kann. Und ich sehe auch ein, dass es in einer Landschaft aus Zement nichts gilt, in den Beton-Silos, in den kalten Wohnhöhlen aus Fertigteilen, das alles zugestanden; aber wenn es schon so ist: Was spricht dann gegen den Versuch, dieses Wort von seinen Belastungen zu befreien? Ihm seine Unbescholtenheit zurückzugeben?
Wie ich das meine? Ich vermute, dass Sie lächeln, doch ich sage es gegen Ihr Lächeln: Heimat, das ist für mich nicht allein der Ort, an dem die Toten liegen; es ist der Winkel vielfältiger Geborgenheit, es ist der Platz, an dem man aufgehoben ist, in der Sprache, im Gefühl, ja, selbst im Schweigen aufgehoben, und es ist der Flecken, an dem man wiedererkannt wird; und das möchte doch wohl jeder eines Tages: wiedererkannt, und das heißt: aufgenommen werden …2
Anders als Siegfried Lenz scheitert der Ich-Erzähler Zygmunt Rogalla am Ende, in der Bundesrepublik Deutschland angekommen, an der politisch-gesellschaftlichen Realität, und er sieht keine andere Chance, seine Heimat-Erinnerungen vor dem Missbrauch zu retten, als das komplette Museum zu verbrennen.
„Wer also versucht, einen progressiven oder linken Heimatbegriff zu kreieren, ist zum Scheitern verurteilt“, schlussfolgert auch Leonhard F. Seidl pessimistisch in seinem, diesen Band eröffnenden Beitrag „Schlachtet die Heimat!“. „Heimat ist im Kern eine völkische Idee, denn sie verwechselt Menschen mit Bäumen und spricht ihnen einen natürlichen und angestammten Platz in der Welt zu. Aber wer Menschen verwurzelt, entmündigt sie und ordnet sie der Natur und dem Kollektiv unter, macht sie zu Sklav_innen der Gerüche und Geschmäcker ihrer Kindheit“, schreibt Thorsten Mense im Vorwort zu Thomas Ebermanns fulminanter Anti-Heimat-Suade Linke Heimatliebe.3 Und auch Isobel Markus teilt in ihrem Beitrag für dieses Buch „Heimat ist ein Tomatenbrotschnittchen“ nicht Zygmunt Rogallas Utopie von Heimat als Ort, an dem man jederzeit wiedererkannt wird.
„Heimat ist ein Ort nicht als der, der er ist, sondern als der, der er nicht ist“, fasste Bernhard Schlink einmal in einer Rede in der American Academy in Berlin kurz vor Weihnachten 1999 einen zentralen Topos der Heimat-Wahrnehmung zusammen. „Heimat“ existiert vor allem in unseren Köpfen. „So sehr Heimat auf Orte bezogen ist, Geburts- und Kindheitsorte, Orte des Glücks, Orte, an denen man lebt, wohnt, arbeitet, Familie und Freunde hat – letztlich hat sie weder einen Ort noch ist sie einer. Heimat ist Nichtort. Heimat ist Utopie. Am intensivsten wird sie erlebt, wenn sie einem fehlt; das eigentliche Heimatgefühl ist das Heimweh. Die Erinnerungen und Sehnsüchte machen die Orte zur Heimat.“4 – Oder verhindern, dass die Orte der Kindheit und Jugend jemals als „Heimat“ angesehen werden können, wie Werner Schlegel in seinem Beitrag „Phantasia oder Die Heimat der Heimatlosen“ erzählt.
„Heimat ist Utopie. Am intensivsten wird sie erlebt, wenn sie einem fehlt.“ – Vielleicht erklärt sich so die Enttäuschung, die viele Menschen erleben und Autor*innen beschreiben, wenn sie nach Jahren des Exils in die Stadt ihrer Kindheit zurückkehren. Wie könnte die reale Welt, im Laufe der Jahre immer utopischer aufgeladen und sich gleichzeitig im Wandel der Zeit immer stärker von den konservierten Bildern der Kindheit absetzend, gegen eine imaginierte und weichgezeichnete Phantasmagorie kindlicher Idylle bestehen? „Ich fühle mich nirgends so einsam wie in der Stadt, in der ich geboren bin“, notiert Ludwig Marcuse im Juli 1949 nach seiner Rückkehr in seine Geburtsstadt Berlin nach sechzehnjähriger Emigration.5
Gibt es eine Heimat nach der Heimat? Also auch für diejenigen, die den Ort ihrer Jugend nie lieben konnten oder ihr Herkunftsland verlassen mussten? Vilém Flusser, der 1939 vor den Nationalsozialisten fliehen musste und seine gesamte Familie in ihren Konzentrationslagern verlor, fand Sicherheit nur im Exil. „Der Mensch ist wie die Ratte – kosmopolitisch. Wer aus der Heimat vertrieben wird (oder den Mut aufbringt, von dort zu fliehen), der leidet. Die geheimnisvollen Fäden, die ihn an Dinge und Menschen binden, werden zerschnitten. Aber mit der Zeit erkennt er, dass ihn diese Fäden nicht nur verbunden, sondern angebunden haben, dass er nun frei ist, neue zwischenmenschliche Fäden zu spinnen und für diese Verbindungen die Verantwortung zu übernehmen.“6 Ähnlich plädiert auch der deutschschweizerische Schriftsteller Jochen Kelter für ein – mindestens – geistiges Exil: „Die Schreibenden und ihre Leser sollten gegen Heimaten, die nur geografisch befestigt sind, anschreiben und anlesen. Wir sollten uns aufmachen, die Heimat zu verlassen. Die unter unseren Füßen und jene im Kopf.“7 Ruth Fruchtman, Ahmed Yussuf, Wahid Nader und andere Autor*innen erzählen in diesem Band von ihren Wanderungen zwischen den (Heimat-)Welten, Caritas Führer und Mieste Hotopp-Riecke berichten aus einer Heimat, die seit dem 3. Oktober 1990 so nicht mehr existiert.
In diesem Band melden sich ausschließlich Schriftsteller*innen zu Wort, mal literarisch, mal essayistisch, gemäß Heinrich Bölls Forderung an seine Kolleg*innen, sich einzumischen. „Wir Autoren sind die geborenen Einmischer. Das klingt idealistisch, ist es aber nicht. Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben.“8
Heimat? ist der dritte Band einer Edition (nach: Unsere Antwort. Die AfD und wir. Schriftsteller*innen und der Rechtspopulismus, Hirnkost 2018, und Ihre Papiere bitte!, Hirnkost 2020), in der Schriftsteller*innen sich einmischen. Im Vorwort des AfD-Bandes notierte ich im Frühjahr 2018: „Ist die Zeit, in der Wortmeldungen von Autoren wie Heinrich Böll oder Günter Grass noch in den Feuilletons und sogar in der Politik breit diskutiert wurden, endgültig vorbei? Oder müssen Autor*innen (und andere Künstler*innen) vielleicht nur wieder selbstbewusst in die Offensive gehen, sich einmischen, um gehört zu werden? Müssen wir in Zeiten immer kürzerer Themenkonjunkturen und schnelllebigerer und oberflächlicherer Mediendebatten unsere Empörung über Missstände, aber auch unsere Visionen einer besseren – gerechteren, toleranteren, friedlicheren, demokratischeren – Gesellschaft nur lauter platzieren? Dieses Buch ist auch – darin sind sich alle Beteiligten bei ansonsten sehr kontroversen Meinungen zum Thema einig – ein Schritt in diese Richtung. Wir Autor*innen werden uns auch zukünftig – wieder – stärker einmischen!“
2 Siegfried Lenz: Heimatmuseum. Hamburger Ausgabe der Werke, Bd. 9, Hoffmann und Campe 2018, S. 147 f.
3 Thomas Ebermann: Linke Heimatliebe. Eine Entwurzelung. konkret 2019, S. 14; auch in: https://www.neues-deutschland.de/artikel/1108905.debatteum-heimatbegriff-ein-brutales-gefuehl.html.
4 Bernhard Schlink: Heimat als Utopie. Suhrkamp (Sonderdruck) 2000, S. 32 f.
5 Briefe von und an Ludwig Marcuse. Diogenes 1975.
6 Vilém Flusser: Heimat und Heimatlosigkeit. Originaltonaufnahmen 1985–1991. Audible Hörbuch 2019.
7 Jochen Kelter (Hrsg.): Die Ohnmacht der Gefühle – Heimat zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Drumlin, Weingarten 1986, Vorwort, S. 13.
8 Heinrich Böll: „Einmischung erwünscht“, in: ders.: Einmischung erwünscht. Schriften zur Zeit. Kiepenheuer & Witsch 1977, S. 15.


Schlachtet die Heimat!
von Leonhard F. Seidl
Wir sollten von vorne beginnen. Mit der Erbsünde: Adam stibitzt den Apfel, Eva beißt genießerisch hinein, der süße Saft spritzt, und wir feiern ab sofort jährlich ein Fest, das diesen Akt der Befreiung feiert. Natürlich sollten wir das Ereignis anders benennen und damit umdeuten. Vielleicht „Abnabelung“, „Emanzipation“ oder „Lob des Ungehorsams“. Denn jene Abnabelung wirkt bis heute nach. Zwar hat Luther dafür gesorgt, dass wir heute, wenn wir wollen, keinen Ablass mehr dafür leisten müssen. Also nicht mehr zur Beichte schreiten müssen, um von unseren Sünden, die auch auf der Erbsünde beruhen, befreit zu werden. Ob er es als positiven Akt des Ungehorsams deuten würde, sei dagegen dahingestellt. War er doch der Meinung: „Drum soll hier erschlagen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann, und daran denken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann als ein aufrührerischer Mensch; (es ist mit ihm) so, wie man einen tollen Hund totschlagen muss: Schlägst du (ihn) nicht, so schlägt er dich und ein ganzes Land mit dir.“ Widersprechen würde ihm die griechische Schöpfungsgeschichte, die ebenfalls auf „einen Akt des Ungehorsams“ zurückgeht, wie es Erich Fromm so treffend festgestellt hat. Denn Prometheus stahl den Göttern das Feuer und „legte … die Grundlage für die Entwicklung des Menschen“. Und war stolz darauf: „Ich möchte lieber an diesen Felsen gekettet als der gehorsame Diener der Götter sein.“
Die Erbsünde als eine Schuld ist tief in uns verankert, allen voran in katholisch sozialisierten Menschen wie mir. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, wie ich in der dämmrigen, Weihrauch durchwalkten Kirche zum Beichtstuhl schritt. Am Abend zuvor hatte ich mir im Bett überlegt, welche Sünden ich begangen hatte, um sie dem Pfarrer hinter dem Holzgitter in der beklemmenden Enge des Beichtstuhls zu gestehen. Da ich damals noch ein äußerst anständiger Bub war, grübelte ich wie besessen, bis in die Nacht hinein, über mögliche Verfehlungen. Und goss damit den Samen der Erbsünde für die nächtlichen, schuldgeplagten Grübeleien im Erwachsenenalter zwischen ein und drei Uhr morgens, die bekanntlich zu nichts führen, außer zu Augenringen und Gewissensbissen. Und hier zeigt sich wieder einmal die Bildhaftigkeit der deutschen Sprache. Die Bisse schmerzen, sie dringen ins Fleisch, lassen einen sich von der einen Seite des Bettes auf die andere werfen. Darum sind Begrifflichkeiten auch von derart eminenter Bedeutung, besonders wenn sie mit tiefen Emotionen, Deutungsmustern und daraus hervorgehenden Handlungsmustern und/oder -anweisungen verknüpft sind. Eben Begriffe wie Erbsünde oder Heimat.
Gerade der gerne von Ernst Bloch zitierte Satz: „Heimat, ein Ort, der allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war“ spiegelt die emotionale Suggestion von Worten wider. Mit Heimat verknüpfen viele Menschen die Geborgenheit auf dem Schoß der Mutter, bestenfalls sogar des Elternhauses. Hinzu kommen Bäume, Wiesen, Wälder: Natur. Wer möchte es ihnen vergällen. Wir alle sehnen uns nach Harmonie. Und gerade im Weichspüler des Rückblicks ist sie in besonderem Maße vorhanden. Wie in einem Werbespot: Kräftige Farben, breites Lächeln (scheinbar) makelloser Menschen, blütenweiße, saubere Laken. Die Blutspritzer auf dem Weiß, durch die Schläge des Vaters oder Schüsse der Waffen-SS, würden verstören. Ebenso das noch warme Blut des erlegten Hirsches, aufgehängt an den Läufen, das aus der Hauptschlagader der durchschnittenen Kehle pulst. Der Hirsch als Element des Heimatgefühls. Nicht als Hirschkopf über dem Esstisch, sondern als Hirschbraten auf dem Esstisch. Als Mahl am Heiligen Abend. Durchdrungen vom Zauber der Bescherung, der Überraschung der Geschenke hinter dem bunten Papier und dem Spiel zu Füßen der Eltern und Verwandten. Der nicht selten am Weihnachtsabend aufbordende Streit wird im Rückblick häufig genauso ausgeblendet wie die anstrengenden, weil angespannten Verwandtenbesuche an den darauffolgenden Feiertagen bei Onkeln, Tanten und Großeltern. Darum bewirkte die Forderung nach einem Veggieday auch eine derart heftige Reaktion. Wie kommen die (damals noch) bösen Grünen nur auf den Gedanken, mir diese heimelige Erinnerung an den Braten oder andere fleischliche Genüsse verknüpft mit Geborgenheit zu rauben!?
Wenn wir nun versuchen würden, dem Begriff der Heimat eine fortschrittliche, emanzipatorische Bedeutung zu geben, fernab von Heimattümelei und Nationalismus, müssten wir den Hirsch schlachten, um die Blutspritzer auf dem weißen Laken zu zeigen, auf dem kitschigen Bild der verklärten Kindheit und damit der Heimat. Wie bei dem Begriff der Erbsünde sind die mit dem Begriff und der Realität der Heimat, also einer Nation, Gesellschaft, Region, einhergehenden Unterdrückungsmechanismen enorm. Denn Sprache formt Bewusstsein und geriert damit Realität. Fühle ich mich der Heimat zugehörig, fühle ich mich nicht selten auch als Teil der Macht und habe damit das Gefühl, „das Richtige“ zu tun, wenn ich gehorsam bin. Dann fühle ich mich als Teil der Gemeinschaft, nicht mehr allein, fühle mich aufgehoben in der Heimat. So, wie es Erich Fromm in seinem Aufsatz Der Ungehorsam als ein psychisches und ethisches Problem beschrieben hat. Ein wesentliches Element dieses Gehorsams ist immer auch, nicht zu sündigen, also sich nicht schuldig zu machen. Was gerade in der Provinz gleichbedeutend ist mit gehorsam sein. „Provinz ist überall“, schrieb der homosexuelle, niederbayerische Dramatiker Martin Sperr und unterstrich damit die Weltläufigkeit dieses nicht selten brutalen Mechanismus, dem letztlich meist nur in der Stadt zu entkommen ist. Denn sobald man gegen die Regeln und Gesetze der Heimat verstößt, ist man ungehorsam und bekommt unmittelbar zu spüren, dass man sich etwas zuschulden kommen hat lassen.
Dank der Erbsünde wird bei Streitereien sofort die Frage aufgeworfen, wer Schuld hat. Es geht keineswegs um ein möglichst konstruktives Problemlösungsverhalten, mit dem allen gedient wäre, sondern um richtig und falsch und letztlich auch darum, wer das Sagen, die Macht hat. Somit hat die beklemmende Enge der Heimat immer auch ein ausgrenzendes Moment. Wer Ungehorsam ist, fällt auf und raus und kann kein Teil dieses Konstrukts sein. Die „Zugereisten“, auf altbairisch auch abfällig „Zuagroaste“ oder „Preißn“ geschimpft, haben es qua Abstammung noch schwerer, was den Blut-und-Boden-Aspekt des Heimat-Konstruktes und damit auch des Begriffes offenbart – von dem es keine Entsprechung in anderen als der deutschen Sprache gibt. Und der nur im Singular auftaucht, was aufzeigt, dass er in Zeiten der Globalisierung nicht mehr zeitgemäß ist. Und der den „Eingeborenen“ mehr Rechte einräumt als den Neuankömmlingen. Als würden die kapitalistischen Ausgrenzungsmechanismen nicht schon genügen.
Die mit Heimat einhergehenden Ausgrenzungsmechanismen sind eine Form von Gewalt, die das Grundbedürfnis nach Sicherheit raubt und seine Kumulation in Molotow-Cocktails und „Ausländer-raus!“-Rufen vor Unterkünften für Geflüchtete findet. Und sie äußern sich auch in zweierlei Maß der Bemessung von Gewalt. Wenn sich die Dorfjugend „fotzt“, gehört das zum Erwachsenwerden. Wenn geflüchtete Jugendliche Andere angreifen, was keineswegs relativiert werden soll, aber ebenso ein Element der Lebensphase Jugend sein kann, gehören sie abgeschoben.
Wer also versucht, einen progressiven oder linken Heimatbegriff zu kreieren, ist zum Scheitern verurteilt. Oder wie sollte die „Heimat“ der alten Nazis, die eine „rassische“ Durchmischung ablehnten, wie auch der Neo-Nazis des „Thüringer-Heimatschutz“, aus dem der NSU entstand, und auch die der Faschist*innen der Neuen Rechten und der AfD positiv konnotiert werden? Der Rechtsruck und die tägliche Gewalt gegen „Nicht-Heimat-Ansässige“ geben die Antwort: Überhaupt nicht. Genauso unmöglich ist es, einem Hirsch die Kehle auf einem weißen Laken durchzuschneiden, ohne dass es von Blut besudelt wird. Eher wird es uns gelingen, die Erbsünde als Akt der Befreiung und des Lobs des Ungehorsams neu zu schreiben und zu verinnerlichen.