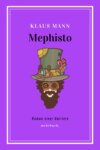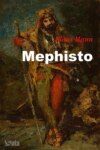Buch lesen: «Klaus Mann - Das literarische Werk», Seite 12
Sie bemühte sich nicht nur für die literarische Chansonette – die schon ganz heruntergekommen und verhungert war – sondern auch für ein Dutzend anderer. Gelegentlich assistierte sie der Proskauer bei der übermäßig anwachsenden Arbeit, die der Betrieb im Comité mit sich brachte. Mit Hummler zusammen – der ihr zäh und geduldig den Hof machte – kümmerte sie sich um die politische Agitation. Es machte ihr Freude, bei der Abfassung von Manifesten und Broschüren behilflich zu sein, die dann, als Reklameheftchen für Zahnpasta oder Korsetts schlau zurechtgemacht, den illegalen Weg nach Deutschland fanden.
Seltsame Typen meldeten sich bei Marion von Kammer, deren Aktivität und Hilfsbereitschaft man kannte. Eines Morgens klopfte es an der Türe ihres Hotelzimmers. Im Halbdunkel des Korridors stand eine große, hagere Frau, sie war nicht ganz jung; Marion taxierte: fünfundvierzig oder fünfzig Jahre alt. ›Mein Gott, sie will mir etwas verkaufen‹, dachte Marion, denn die Dame trug ein kleines gelbes Handköfferchen. ›Und ich habe doch gar kein Geld …‹ Sie bemühte sich, ein möglichst freundliches Gesicht zu machen, als sie sagte: »Guten Morgen. Kommen Sie herein.«
Die hagere Dame erwiderte den Gruß nicht. Während sie eintrat, blickte sie sich scheu und hastig um, als fürchtete sie, es könnte ihr jemand folgen. »Danke schön«, sagte sie etwas sinnlos und schauerte zusammen wie jemand, den ein kalter Luftzug berührt. »Setzen Sie sich doch!« sagte Marion, wobei sie die Besucherin einer schnellen, aber genauen Musterung unterzog. Sie hatte es sich angewöhnt, die Menschen, mit denen sie zu tun bekam, zunächst einmal gründlich anzuschauen.
Die Kleidungsstücke, welche die Frau trug – schiefes kleines Hütchen, langer Regenmantel, hängende Strümpfe, ausgetretene Halbschuhe – schienen auf eine sonderbare Art entfärbt und verblichen, von einem völlig leichenhaften Grau – noch nie, meinte Marion, hatte sie derart fahle Kleidungsstücke gesehen. Aschgrau wie Kappe und Mantel waren auch die drei grotesken Löckchen, die unter dem Hutrand hervor auf die Stirne hingen. Diese Stirne übrigens schien edel geformt und von einer fast kindlichen Glattheit; nicht einmal die lächerlichen, runden, steif gedrehten Löckchen konnten sie entstellen. Die unruhigen, kleinen und dunklen Augen lagen in schattig vertieften Höhlen. Von einer sehr langen, scharf profilierten Nase liefen gramvolle Furchen zu einem schmalen, verzerrten Mund.
»Fräulein Proskauer hat Ihnen also meine Adresse gegeben«, sagte Marion, da die Fremde, in starrer Haltung, mitten im Raum stehen blieb. »Aber warum setzen Sie sich denn nicht?«
Die Frau fuhr auf wie aus schweren Träumen; erschauerte wieder und ließ ein beängstigendes kleines Kichern hören. »Fräulein Proskauer, ganz recht«, sagte sie geschwind und fügte rätselhaft hinzu: »Eine sehr originelle Person … Sie hat mich auf die Idee gebracht, mit Lavendelwasser, Seife und komischen kleinen Schwämmen hausieren zu gehen … Äußerst originell …« In ihren Augen gab es ein kurzes, gehässiges Funkeln.
Marion fragte besorgt: »Sie verkaufen also Toiletteartikel?« Dabei berechnete sie: ›Ich besitze noch dreißig Francs. Eine Tube Zahnpasta könnte ich ihr vielleicht abkaufen; das wird nicht mehr als acht Francs kosten.‹
Statt Marions Frage zu beantworten, erklärte die Fremde, mit einer vornehm knappen Neigung ihres langen und schmalen Hauptes: »Mein Name ist Friederike Markus.« Den Oberkörper vorgebeugt, die aschfarbene Skeletthand an den Mund gelegt, fügte sie raunend hinzu: »Freunde nennen mich Frau Viola. Aber verraten Sie es Etzel nicht! Er kann es nicht ausstehen, wenn ich als ›Frau Viola‹ begrüßt werde – vielleicht weil Gabriel mich stets so angeredet hat: immer als Frau Viola, ganz konsequent, niemals anders.« Daß sie mit mißtrauisch schrägem Blick Marions erstaunte Miene bemerkte, machte sie gereizt: »Nun ja, es könnte doch sein, daß Sie Etzel, meinen sogenannten Gatten, einmal irgendwo treffen. Er ist viel unterwegs, wird überall vorgelassen und benutzt all seine Verbindungen, um gegen mich zu intrigieren.« – Marion dachte: ›Mein Gott, sie ist nicht ganz richtig im Kopf. Durch vieles Leiden ist sie völlig aus der Form gekommen und hat ihr inneres Gleichgewicht ganz verloren. Was fange ich mit ihr an?‹
Frau Viola, die kerzengerade, mit dem Köfferchen auf den aneinandergepreßten Knien, im Stuhle saß, ließ ihre Stimme vernehmen, die scharf klirrte wie ein geborstenes Instrument: »Ehe wir zu den Geschäften übergehen, liebes Fräulein von Kammer, möchte ich mir doch noch eine Frage erlauben: Kennen Sie Bernard Shaw?«
»Ich hatte nie das Vergnügen.« Marion war ziemlich erschrocken. »Ohne Frage, ein bedeutender Schriftsteller«, fügte sie hilflos hinzu.
»Der Ansicht bin ich auch einmal gewesen«, bemerkte Friederike Markus spitzig. »Aber wenn er wirklich so bedeutend ist – warum hat er mir dann auf fünfzehn Briefe« – bei Nennung dieser Zahl hob Frau Viola drohend den langen Zeigefinger – »auf fünfzehn lange, mit meinem Herzblut geschriebene Konfessionen nicht geantwortet?!« – Marion meinte, der berühmte Ire dürfe vermutlich stark beschäftigt sein; daraufhin hatte Friederike nur ein unendlich höhnisch-hochmütiges Achselzucken. »Ich habe ihm meine Seele angeboten – mein Innerstes habe ich ihm enthüllt! Nicht nur, daß ich mich bemühte, ihm die furchtbar harten und übrigens äußerst interessanten Umstände meines Lebens ausführlich auseinanderzusetzen – ich habe ihn verschwenderisch beschenkt mit den Früchten meiner Erkenntnis; mit den durch unzählige Schmerzen erworbenen Reichtümern meines Geistes!« Plötzlich den Ausdruck ihres Gesichtes und der Stimme verändernd, den Oberkörper wieder vertraulich vorgeneigt, fuhr sie fort: »Vorigen Monat hatte ich nämlich die Möglichkeit, so viele Briefe zu schreiben, wie mein Herz begehrte. Ich habe meine Armbanduhr versetzt und mir für den Erlös eine Schreibmaschine geliehen. Eine Schreibmaschine – denken Sie sich doch nur, ganz für mich alleine!« Sie kicherte wieder, diesmal klang es beinahe munter. »Etzel war um diese Zeit in relativ friedfertiger Laune. Alles traf sich sehr günstig, ich zog mich vier herrliche Wochen lang von den Geschäften zurück und widmete mich ganz meinen Briefen. – Und nun diese Enttäuschung …« Sie sank trostlos in sich zusammen. »Diese schmähliche Niederlage! – Wann werde ich mir jemals wieder eine Schreibmaschine leisten können? Und Etzel – ach, wenn Sie ahnten, wie er jeden meiner Schritte belauert!«
Ehe es zum Verkauf der Zahnpasta kam, mußte Marion sich noch manches über Frau Violas Vergangenheit anhören. »In Berlin hatte ich Glanz um mich!« rief sie stolz. »Ich war Kunstsammlerin, ich liebte das Schöne und erwarb es in bedeutenden Mengen; ich besaß Gemälde und Tiere aus Porzellan, und bestickten Samt!« Jedes Glück aber war aus ihrem Leben gewichen, seitdem Gabriel sich zurückgezogen hatte – »Gabriel, mein Erzengel!« In Friederikes schattigen Augenhöhlen glimmten Lichter. »Gabriel, der einzige, der mich verstand; der all des innigen Gefühls, das ich zu bieten habe, würdig gewesen ist! Ach, er ging … er ging … da bog er um die Ecke!« rief sie fassungslos, als wäre der liebe Jüngling eben erst entwichen und hätte gerade dieses Zimmer verlassen. Ihre Hände krampften sich um den Koffer, der die Pasten, Crèmes und Wohlgerüche enthielt, mit denen die Unglücksfrau hausieren ging. »Warum ließ Gabriel Frau Viola?« fragte sie mit gräßlicher Hartnäckigkeit – während Marion nicht mehr wußte, wohin sie schauen sollte vor Scham und Schrecken.
Für die Zahnpasta verlangte Frau Markus elf Francs und fünfzig Centimes: »Es kommt Sie mindestens um zwölf Prozent billiger als in jedem Laden«, erklärte sie, plötzlich geschäftsmäßig. Nachdem der Handel abgeschlossen war, bat Marion die Besucherin milde, nun zu gehen. Zum Abschied sagte Friederike – sehr leise und während eine helle, flaumige Röte über ihr hageres, zerwühltes Gesicht lief: »Ich möchte Sie bald wieder einmal besuchen dürfen, liebes Fräulein von Kammer! Sie sind doch ein Mensch. Meistens begegnet man nur Lemuren …« Noch einmal erschauerte sie; der eisige Lufthauch hatte sie wohl wieder berührt. Schon im Korridor bat sie noch: »Und bitte, Etzel gegenüber – völlige Diskretion: über alles!« Dabei legte sie, lustspielhaft neckisch, den langen Zeigefinger an die verzerrten Lippen.
Friederike Markus verließ das Hotel; steif und närrisch affektiert stolzierend, schritt sie die Rue Jacob hinunter und bog in die Rue St.-Benoît ein, um den Boulevard St.-Germain zu erreichen. Das gefüllte Köfferchen, das sie zu tragen hatte, war nicht ganz leicht. Ihre eine Schulter wurde ein wenig nach oben gezogen, während die andere hinabhing. Friederikes Haltung war sowohl steif als schief – und da die einsam Wandelnde auch noch im Selbstgespräch die Lippen bewegte und zuweilen stehenblieb, um mißtrauische Blicke hinter sich zu werfen, war der Eindruck, den sie machte, ein so überraschender, daß mancher Passant mitleidig-amüsiert auf sie schaute. Sie bemerkte es kaum; denn sie war durchaus beschäftigt mit den eigenen Gedanken, die sich teils sorgenvoll-gequält ans Nächste, kümmerlich Alltägliche hielten, teils aber abglitten, davonhuschten, Reißaus nahmen, um sich in jenen Gegenden niederzulassen, wo der Jüngling, Gabriel genannt, seinen strahlenden Aufenthalt hatte. – ›Heute vormittag muß ich noch mindestens drei Visiten machen‹, rechnete Frau Viola. ›Zuerst gehe ich wohl zu dieser Schweizer Dame im Hôtel des Saints-Pères. Vorher will ich aber noch eine Tasse Kaffee trinken …‹
Sie ließ sich in einem schmutzigen kleinen Bistro nieder, das »Au Rendezvous des Chauffeurs« hieß. – Wenn Friederike eine Tischplatte vor sich sah, wurde sie immer gleich von der unwiderstehlich starken Lust ergriffen, zu schreiben. Es war eine Art von Trance, in die sie verfiel, wenn sie die Feder ins Tintenfaß tauchte – und es entstanden die endlos langen, konfusen, übrigens fast unleserlichen Briefe, die sie an berühmte und ihr meistens fremde Personen adressierte. Dichtern und Professoren, Malern und Schauspielerinnen, Dirigenten und Politikern ihr gepeinigtes Herz auszuschütten war zum einzigen Vergnügen geworden, das sie sich gönnte. Solche Liebhaberei bedeutete für sie einen Luxus, und zwar einen recht leichtsinnigen, üppig unstatthaften. Das Briefporto spielte in ihrem Etat eine beängstigende Rolle, und wenn es sich gar um Doppelbriefe handelte – was häufig vorkam – und sie obendrein noch dem inneren Drang nachgeben mußte, das schwere Schreiben rekommandiert und expreß zu senden, so hieß es gar manches Mal, tagelang auf eine warme Mahlzeit zu verzichten und sich mit altem Weißbrot und lauem Tee begnügen, damit nur all die fremden Berühmtheiten aus ihrer Morgenpost erführen, wie melancholisch und interessant das innere Leben der Frau Viola beschaffen war.
Heute schrieb sie an Frau Tilla Tibori – was sie sich schon lange vorgenommen hatte; denn diese Schauspielerin war ihr eine der liebsten in Berlin gewesen. »Verehrte Frau!« Friederikes Feder eilte knirschend übers Papier. »Auch Sie hat unser gemeinsames Unglück in ein fremdes, unwirtliches Land verschlagen.« (Die Markus hatte zufällig Tillas Züricher Adresse durch gemeinsame Bekannte in Erfahrung gebracht.) »Hören Sie die Klage und das Bekenntnis einer Leidensgenossin …« An dieser Stelle stutzte sie plötzlich, als hätte eine Stimme sie angerufen. Sie hob ruckhaft den Kopf. Während ihre Blicke irr ins Leere glitten, sprach sie mit einer kleinen, zirpend hohen Stimme: »Ja – Gabriel – wo bist du? Ich kann dich hören! Aber sprich doch bitte, bitte etwas deutlicher, damit ich dich besser verstehe!«
Der Kellner beobachtete sie, erstaunt und ziemlich angewidert.
Während Frau Viola das armselige Briefpapier »Au Rendezvous des Chauffeurs« mit Anklagen und Beschwörungen, Ausbrüchen des Stolzes und des grenzenlosen Jammers füllte, telefonierte Marion mit der Proskauer, um einige Tatsachen über die Unglückliche zu erfahren. »Was ist das für eine Frau?« fragte Marion. »Sie hat mir angekündigt, daß sie mich wieder besuchen wird …«
Dora wußte sofort Bescheid. »Natürlich erinnere ich mich an Friederike Markus, die vergißt man nicht, sie hat uns ja genug Sorgen gemacht. Eine Zeitlang mußten wir sie unterstützen, bis wir ihr diese Parfümerievertretung verschafften. Es sind noch keine Klagen über sie gekommen; ihre Arbeit scheint sie korrekt zu erledigen. Trotzdem bin ich pessimistisch, was ihre Zukunft betrifft. Ihr Geisteszustand wird immer bedenklicher.«
»Ist denn alles erfunden, was sie erzählt?« wollte Marion wissen. »Die ganze Geschichte von ihrem satanischen Gemahl Etzel und dem schönen Jüngling Gabriel?«
»Alles erfunden«, bestätigte die Proskauer, »alles erträumt. In Wirklichkeit hat sie niemanden – und das ist wohl so schlimm, daß sie sich einen Gatten ausdenkt, der sie quält, und einen Jüngling, der sie verlassen hat. Von den Dingen, die in ihrem Leben wirklich passiert sind, spricht sie nie. Sie hatte nämlich tatsächlich einen Mann – du wirst seinen Namen wahrscheinlich gehört haben: Doktor Max Markus, Rechtsanwalt. Er war der juristische Vertreter einer linkspolitischen Gruppe in Berlin, und dann kam er ins Konzentrationslager, und dort soll er sich umgebracht haben.« Dora Proskauer schwieg; am anderen Ende der Leitung ließ Marion einen kleinen Laut der Bestürztheit und der Trauer hören.
Marions Tage in Paris waren erfüllt von Sorge um die eigene Zukunft und von Anstrengungen, die sie für die Zukunft anderer unternahm. Nicht alles, was man versuchte und anzettelte, wollte geraten. Ilse Ill zum Beispiel kam verzerrt vor Enttäuschung von ihrem Rendezvous mit dem Theaterdirektor zurück. »Er hat mich abgelehnt!« zischte die Kabarettistin. »So eine Gemeinheit! – Und wissen Sie, was er zu mir gesagt hat?! Er hat mir ins Gesicht gesagt: ›Fräulein, Sie sind zu häßlich!‹ – Später hat er mir aber versichert: ›Natürlich, Sie haben Talent.‹ – Nun bitte ich Sie, Marion, was soll das bedeuten?! Wenn ich Talent habe, dann habe ich doch ein Gesicht. Und wenn ich ein Gesicht habe, dann bin ich doch nicht häßlich!!«
»Ich kenne noch einen Pariser Theaterdirektor«, sagte Marion müde. »Mit dem werde ich Sie zusammenbringen, Fräulein Ill.«
Und Ilse – die vom Ehrgeiz gejuckt wurde wie von einem giftigen kleinen Ausschlag – wiederholte: »Er hat mir gesagt: ›Vous êtes trop laide, Mademoiselle!‹ Ist das zu fassen? Ist das vorzustellen …?«
»Du mußt mit mir ans Meer!« Dieses Mal bestand Marcel darauf.
Sie fuhren nach einem kleinen Ort in der Nähe von Deauville. Der Sommer ging zu Ende; die Winde waren heftiger und rauher. Das dunkle, bewegte Wasser ließ erkennen: es ist Herbst geworden. – »Schluß mit dem Sommer!« Marcel rief es mit grimmiger Vergnügtheit aus – als wäre es jedenfalls gut, daß wieder eine Jahreszeit, irgendein Lebensabschnitt erledigt und endgültig vorüber war. – »Nie wieder Sommer 1933!« Marion hielt das Gesicht und die schimmernde Mähne dem Sturm hin. »Es war ein infernalischer Sommer. Diese heißen Wochen in Paris vergesse ich nie. Der Asphalt auf den Straßen war ja schon ganz weich geworden; die Schuhsohlen klebten einem fest …«
Sie machten weite Strandspaziergänge, oder sie saßen, in ihre Mäntel gehüllt, auf einer Terrasse – fröstelnd, aber froh.
Nachts, wenn der Sturm um das kleine Hotel tobte, veränderte sich alles um sie herum ins Wilde und Phantastische. Sie wußten nicht mehr, daß es ein ziemlich kleinbürgerlicher Erholungsort war, den es da vor ihren Fenstern gab. Das Zimmer, in dem sie einander liebten, schien in der Luft zu hängen, eine schwebende Gondel.
Marion taumelte. Die lange Promenade am Meer und der große Wind, dem sie ihr Gesicht dargeboten hatte, waren wohl ein wenig viel für sie gewesen. Sie klammerte sich an Marcel, als ob sie stürzen müßte, wenn sie ihn ließe.
»Wie mager du bist!« sagte er noch einmal; er schien sich über die Schmalheit ihres Körpers nicht genug erstaunen zu können, obwohl er selber dünn war. »Nur Haut und Knochen!« Dies konstatierte er nicht ohne eine gewisse Strenge. Aber wieviel gerührte Zärtlichkeit klang in seinem Tadel! – »Komm zu Bett!« Es war Marion, die ihn bat. »Mir ist schwindlig.«
Das Zimmer schwankte ihr unter den Füßen. Nun schien es ein Schiff auf hoher See zu sein – oder vielleicht nur ein kleiner Nachen. Wohin trug er sie? Gab es Ufer, jenseits dieser Gewässer, die sich unermeßlich breiteten? Und wenn es Ufer gab – hatte man Kraft genug, um sie zu erreichen?
»J’ai peur – ah, j’ai peur …« Marion erschrak: dies war Marcels flüsternde Stimme; sie aber hatte genau dasselbe sagen wollen – freilich auf deutsch.
»Wovor fürchtest du dich?« – Er beantwortete ihre Frage mit einer Stimme, die plötzlich rauh war und etwas keuchte. »Gefahren – Gefahren überall … Oh, wir sind schon verloren …! Welche Schuld haben wir auf uns geladen, daß man uns zu solcher Strafe verdammt …? Ach, Marion – Marion …« Seine Worte vergingen an ihrem Hals. Vielleicht weinte er.
»Wir werden schon fertig – mit allem!« raunte sie zuversichtlich. Aber auch ihre Augen hatten den entsetzten Blick, als wäre ein Abgrund jäh vor ihnen aufgesprungen.
Aus dem Abgrund stiegen Feuerbrände, auch Qualm kam in dicken Schwaden, und Felsbrocken wurden emporgeschleudert. Es war der Krater eines Vulkans.
Hüte dich, Marion! Wage dich nicht gar zu sehr in die Nähe des Schlundes! Wenn das Feuer dein schönes Haar erfaßt, bist du verloren! Wenn einer der emporgeschleuderten Felsbrocken deine Stirne streift, bist du hin! Auch könnte es sein, daß du am Qualm elend ersticken mußt.
Hütet euch, Marion und Marcel! Furchtbar ist der Vulkan. Das Feuer kennt kein Erbarmen. Ihr verbrennt, wenn ihr nicht sehr schlau und behutsam seid. Warum flieht ihr nicht? Oder wollt ihr verbrennen? Seid ihr versessen darauf, eure armen Leben zu opfern? – Aber ihr habt nur diese! Bewahrt euch! Wenn auch ihr im allgemeinen Brand ersticken solltet – niemand würde sich darum kümmern, niemand dankte es euch, keine Träne fiele über euren Untergang. Ruhmlos – ruhmlos, Marion und Marcel, würdet ihr hingehen!
Noch einmal Marcels keuchende Flüsterstimme: »Gefahren, wohin ich schaue … Kampf – Kampf ohne Ende … Ich sehe Mord – Mord und Tränen … Voici le temps des assassins! Die mörderische Zeit ist angebrochen … Wohin retten wir uns? Wohin fliehen wir mit unserer Liebe? Wohin, Marion, wohin?«
Der Griff seiner Hände, der von verzweifelter Heftigkeit war, lockert sich endlich. Er schmiegt sich an sie. Nebeneinander ruhen ihre erschöpften Häupter. Ihre Augen waren geblendet von Feuerbränden, die den Horizont nicht erhellen, sondern purpurn verfinstern. Da der eine nun die atmende Nähe des anderen spürt, dürfen sie endlich damit aufhören, ins schauerliche Gewoge der Flammen zu schauen – der Flammen aus dem Vulkan. Sie schließen die Augen. Mit dem Seufzen, das alle Liebenden haben – und das nach Qualen klingt, während es doch soviel mehr ausdrückt als nur die Schmerzen – vertrauen sie sich den Umarmungen an, und ihr letzter Trost sind die Küsse.
5
»Man gewöhnt sich an alles«, konstatierte Frau von Kammer und seufzte. Niemals hätte sie es für möglich gehalten, daß sie imstande war, ein derart reduziertes, glanzloses Leben auszuhalten.
Den guten Bekannten, die in Deutschland geblieben waren – achtbaren Leuten durchaus konservativer Gesinnung – schien es noch bedeutend schlimmer zu ergehen, wenn man den Nachrichten glauben durfte, die in Zürich eintrafen. Ein Major a.D., der zu den Freunden des Generals von Seydewitz gehört hatte, war mehrere Wochen lang im Konzentrationslager gewesen und säße heute noch drin, wenn er nicht über besonders glänzende Verbindungen verfügte: alles dies, weil sein Dienstmädchen gemeldet hatte, er spreche respektlos von der Regierung. Ein verdienstvoller Herr, bewährt im Krieg wie im Frieden – und verhaftet wegen der Schwätzereien einer Magd! Manche, die im Februar 1933 von der »Machtergreifung« Hitlers entzückt gewesen waren, schienen jetzt, ein Jahr später, schon enttäuscht. Vor allem in Offizierskreisen gab es Katzenjammer, wie Frau von Kammer sich erzählen ließ. Nicht ohne Triumph nahm sie es zur Kenntnis. »Es scheint in der Tat, daß ein Mensch, der Gefühl für Würde hat, in diesem Deutschland nur noch Selbstmord begehen kann«, sprach Marie-Luise mit feierlichem Nachdruck. – »Selbstmord ist keine Lösung«, warf Tilly etwas schnippisch ein. »Sinnvoller wäre: gegen das Regime zu opponieren.« – »Falls das noch irgendwie möglich sein sollte«, schloß Frau Tibori und hatte ihr dunkles, gurrendes, nicht ganz natürliches Lachen. – Tilly wollte das letzte Wort haben. »Die Möglichkeit zur Opposition ist wohl immer da«, meinte sie und sah eingeweiht aus. »Freilich genügt für die illegale Arbeit gegen die Diktatur weder die rechte Gesinnung noch Courage; es gehört Erfahrung dazu – Training, wie zu einem Sport.« Sie erinnerte sich der barschen Belehrung, mit der die zwei jungen Männer in Berlin sie abgefertigt hatten. Frau Tibori und Marie-Luise zeigten ziemlich ratlose Mienen.
Die Schauspielerin erschien jede Woche mindestens einmal zum Tee bei ihrer Freundin. Frau von Kammer hatte, seit dem ersten Januar, die Wohnung in der Mythenstraße aufgegeben, weil sie zu kostspielig war, und gesellschaftliche Repräsentation ohnedies kaum noch in Frage kam. Sie war weiter hinaus, an den See, gezogen und bewohnte nun mit Tilly drei bescheiden möblierte Stuben in Rüschlikon. Die Tibori ihrerseits lebte immer noch mit jenem älteren Herrn, von dem sie meist zurückhaltend als von »meinem Bekannten«, manchmal auch als von »Herrn Kommerzienrat« sprach. – »Er ist gut zu mir, weißt du«, hatte sie Marie-Luise einmal gestanden, »und er verlangt nicht viel. Eigentlich liegt ihm nur daran, meine Stimme zu hören. Er ist vernarrt in hübsche Frauenstimmen und hört mich so gerne schwätzen. Nun, das Vergnügen ist ihm zu gönnen – wenn man bedenkt, was er sich’s kosten läßt. – Der Rest bedeutet nicht viel für ihn.«
Frau von Kammer war doch ein wenig schockiert, weil ihre Jugendgespielin mit soviel Zynismus vom »Rest« sprach. Sie hatte Tilla einmal mit dem Kommerzienrat, gelegentlich einer Theaterpremière, getroffen. Der Tibori war es peinlich gewesen; aber ihr greiser Kavalier ließ sich unbarmherzig vorstellen. Er sah recht verfettet und melancholisch aus, mit hängenden bleichen Backen und Augen, die in fahlem Speck zu verschwinden drohten. – ›Wie hält Tilla das aus?‹ fragte Frau von Kammer sich besorgt und etwas angewidert.
Tilla mußte es wohl aushalten. Wie sollte sie sonst über die Zeit hinwegkommen, während deren sie ihre Kenntnisse im Englischen perfektionierte und auf den Bescheid ihres Agenten aus Hollywood wartete? – Einmal war sie in London gewesen; dort hatte man, im Auftrag einer amerikanischen Gesellschaft, Probeaufnahmen von ihr gemacht. Nun hatte die Entscheidung in Kalifornien zu fallen. Aber die maßgebenden Herren schienen kaum Eile zu haben …
Am Ende konnte es Frau von Kammer nur recht sein, daß die Freundschaft zwischen Tilly und Tilla nicht so intim geworden war, wie die Ältere dies wohl beabsichtigt hatte. »Ich bin doch eigentlich so etwas wie deine Patentante«, hatte die Tibori gescherzt und nichts unversucht gelassen, um das junge Mädchen für sich zu gewinnen und einzunehmen. Tilly aber blieb spröde. Wenn die Actrice sich Mühe gab, in ihre kleinen Geheimnisse einzudringen, schwieg sie störrisch. Sie war degoutiert von der Lebensführung ihrer »Patentante«. – »Eine nicht mehr junge Frau, die sich von einem dicken Kapitalistenschwein aushalten läßt!« sagte sie streng. Der Patentante konnte es nicht entgehen, daß sie etwas verächtlich behandelt ward. Wahrscheinlich ahnte sie auch die Gründe. »Diese junge Generation ist moralisch«, meinte sie sinnend. »Man erregt heute leichter Anstoß bei einer Zwanzigjährigen als bei einem Pfarrer oder einer alten Jungfer. Vielleicht hat das gute Gründe. Wir haben uns aus den moralischen Gesetzen, mit denen es unsere Eltern noch so ernst nahmen, nicht mehr viel gemacht und sind mächtig stolz auf unsere ›Freiheit‹ und ›Unabhängigkeit‹ gewesen. Nun kommen andere: unsere Kinder – oder solche, die unsere Kinder sein könnten – und sie müssen sich neue Gesetze erfinden, ganz für sich allein – weil das Leben sonst langweilig und ohne Spannung wäre.«
Frau von Kammer dachte, etwas verbittert: ›Wie anspruchsvoll sie daherredet! Und was ist das für eine gewagte Behauptung: wir hätten die Moralgesetze überwunden? Es gibt doch wohl Unterschiede, auch innerhalb einer Generation …‹ – Sie sagte: »Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Leider muß ich fürchten, daß die Kreise, in denen meine Tilly verkehrt, es nicht sonderlich genau mit den moralischen Prinzipien nehmen – weniger genau jedenfalls, als manche von uns es taten, als wir jung waren.« – »Doch«, beharrte Tilla Tibori, »auf ihre neue Art sind sie sehr moralisch und verurteilen jeden, der etwas laxere Begriffe hat und sich mal ein bißchen gehen läßt. Es fehlt ihnen der Sinn fürs Frivole. Sie sind alle politisch, lauter kleine Fanatiker – und das macht sie mindestens ebenso unerbittlich, wie wenn sie religiös wären. Wir haben wohl für all das nicht mehr ganz das richtige Verständnis, meine liebe Marie-Luise …«
Frau von Kammer, die den Umgang mit verdächtigen Emigranten immer noch mied und von den feinen Leuten ihrerseits gemieden wurde, blieb recht allein. Aus Deutschland schrieb ihr fast niemand mehr, auch kam wenig Besuch. Ihre beste – oder vielmehr: ihre einzige Freundin in Zürich war eine alternde Schauspielerin, die sich von einem Kommerzienrat aushalten ließ … Trotz alledem war Marie-Luise nicht eigentlich unglücklich. Das Bewußtsein, daß sie sich Entwürdigungen entzogen hatte, denen ihre alten Bekannten in Berlin ausgesetzt waren, gab ihr den Halt.
Marion war zu Weihnachten ein paar Tage in Zürich gewesen. Sie sprach viel und eifrig von ihren Plänen; denn nun waren sie schon so weit gediehen, daß kein Aberglaube mehr daran hindern konnte, von ihnen zu reden. Es lief darauf hinaus, daß Marion als Rezitatorin Abende veranstalten und durch die Länder reisen wollte. Das Programm, das sie vorbereitete – Verse und Prosa von klassischen sowohl als auch von modernen Autoren – war unter einem antifaschistischen Gesichtspunkt zusammengestellt. »Freilich sollen nicht alle Stücke, die ich sprechen will, einen direkt politischen Inhalt haben«, erklärte sie. »Aber irgendwie muß man sie in Beziehung bringen können zu unseren Kämpfen und Problemen. Ich habe schon die wunderbarsten, aufregendsten Dinge gefunden, bei Goethe oder Lessing, bei Heine, Hölderlin oder Nietzsche, oder bei den Neuen. Die deutsche Literatur ist ja so reich, jetzt erst merke ich, wie herrlich reich sie ist. Alles, was uns auf den Nägeln brennt, ist eigentlich schon gesagt und ausgedrückt worden – mit welcher Macht, welcher Schönheit! – Wer zwingt mich übrigens, mich nur auf die deutsche Literatur zu beschränken?« fügte sie noch hinzu, fast übermütig vor lauter Unternehmungslust.
Tilly war gleich begeistert von Marions Plan. Die Mutter verhielt sich mißtrauisch. »Ob man sich wirklich sein Brot verdienen kann durch Gedichteaufsagen?« zweifelte sie. Marion lachte. »Wir werden ja sehen … Und übrigens riskiere ich nicht viel – nur all die Arbeit, die ich mir jetzt mache. Wenn es kein Erfolg wird, versuche ich etwas anderes.«
So war Marion: immer aktiv, voller Einfälle und nicht ohne Munterkeit – wenngleich sie nun häufig recht angestrengte Züge zwischen den Brauen auf der Stirn zeigte. Sie reiste bald wieder ab, weil sie in Paris kolossal viel zu tun hatte, teils mit der Sorge um all ihre Freunde, teils mit der Vorbereitung ihres literarischen Programms. Die drei Zimmer in Rüschlikon wurden so still, wie sie es gewesen waren vor diesem turbulenten, angeregten Besuch. – Tilly war selten zu Hause. Frau von Kammer beschäftigte sich mit großen Handarbeiten, oder sie schüttelte den Kopf über der Lektüre der Zeitung; oft saß sie auch nur einfach da und grübelte, oder sie schrieb auf Zetteln lange Zahlenkolonnen untereinander, um sich auszurechnen, ob sie mit ihrem Monatsgeld auskommen konnte. Es schien fast nicht möglich; aber es mußte sein. Wenn nur das Schulgeld für die kleine Susanne nicht so teuer gewesen wäre. Die schrieb weiter ihre korrekten, ziemlich inhaltslosen Briefe aus dem Internat. Auf ihre trockene Art teilte sie mit, daß sie über nichts zu klagen habe. Sie war ehrgeizig, besonders was den Sport betraf. Stolz berichtete sie von ihrem Sieg auf einem Tennisturnier oder bei einer Schwimmkonkurrenz. Mit den anderen jungen Mädchen vertrug sie sich gut. Vor allem lag ihr daran, nicht aufzufallen; eine unter vielen, ein »Durchschnittsmädel« zu sein. Frau von Kammer mußte ihr nette Kleider und feine Wäsche schicken: das war nötig aus Prestigegründen. Es sollte dem Kind nicht zu Bewußtsein kommen, daß sie ärmer war als alle, mit denen sie in der Klasse saß. Um keinen Preis hätte Susanne es sich selber oder anderen zugegeben, daß sie in dem Zirkel von jungen Mädchen solide-wohlhabender Herkunft ein Ausnahmefall und ein »fremdartiges Element« bleiben mußte – ihre Familie lebte unter gar zu anderen Umständen und Verhältnissen als die Angehörigen der übrigen Schülerinnen. Einmal hatte sie empört an die Mutter geschrieben: »Die Berta Baudessin aus Hannover ist sehr frech zu mir gewesen und hat gesagt: ›Ihr seid ja nur Emigranten.‹ Das ist doch eine Gemeinheit und auch gar nicht wahr. Du hast mir gesagt, es ist nur wegen Deiner Gesundheit, daß Du in der Schweiz leben mußt, statt in Berlin. So ist es doch, Mama?« – Solche Zeilen las Marie-Luise nicht ohne Sorge. »Das Kind gibt sich falschen Vorstellungen hin«, sprach sie kopfschüttelnd.
Tilly aber ärgerte sich. »Eine dumme Gans!« rief sie böse. Die Mutter meinte versöhnlich: »Aber sie ist doch noch so jung! Wie soll sie eine Ahnung haben von dem, was in Deutschland geschieht? Ihr kommt es doch nur darauf an, daß sie nicht aus dem Rahmen fällt und nicht anders ist als ihre kleinen Kolleginnen.« Darauf Tilly: »Das ist ja gerade das Schlimme – wenn man bedenkt, was für eingebildete, kapitalistische Fratzen diese ›kleinen Kolleginnen‹ sein müssen!«