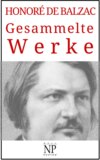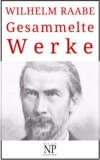Buch lesen: «Gabriele Reuter – Gesammelte Werke», Seite 17
X.
Onkel Gustav war gestorben. Mama hatte ihn heute Morgen tot im Bett gefunden – fast in derselben Stellung, in der sie ihn am Abend zum Schlaf zurechtgelegt hatte. Er war sehr leidend gewesen in der letzten Zeit, aber der Arzt versicherte stets, er könne bei der guten Pflege noch Monate, ja noch Jahre leben. Mama und Agathe saßen still zusammen und flochten an einer Guirlande. Frau Heidling reichte ihrer Tochter kleine Sträuße von Grün und Blumen, aber sie machte es oft ganz verkehrt. Beide sahen müde und abgezehrt aus – besonders Mama konnte sich kaum noch aufrecht halten. Ihre Kräfte waren durch die Anforderungen des Kranken bis auf den letzten Rest verzehrt.
Was sie und Agathe sich auch ausdachten an guten stärkenden Bissen – nichts hatte ihm geschmeckt. Verdrießlich schob er den Teller zurück und erzählte von diesem oder jenem Hotelkoch, der gerade das eine Gericht so wunderbar schön zu bereiten verstand. Beständig wollte er unterhalten sein und unterbrach doch meistens die Bemühungen seiner Nichte mit der trübseligen Bemerkung: »Ach, Kind – das interessiert mich ja gar nicht!« Für nichts auf der Welt empfand er Teilnahme. Es war fast noch ein Glück zu nennen, dass die Pflege seines Körpers viele Stunden des Tages ausfüllte, denn sauber und appetitlich blieb »die Kirschblüte«, wie Onkel Gustav bei Agathes Freundinnen genannt wurde – bis zuletzt. Freilich sank die arme Mama, die dem alten, schwachen Herrn allein bei der Toilette helfen durfte, immer halb ohnmächtig vor Ermattung hinterher aufs Sofa.
Nun war der große Lehnstuhl am Fenster, in dem Onkel Gustav, mit einem langen, grauen Schlafrock bekleidet, ein halbes Jahr hindurch gesessen, leer geworden. Auf dem Tisch lag seine hübsche blonde Perrücke, ohne die er sich der Nichte niemals gezeigt hatte.
Die Angehörigen sprachen wehmütig über das Leben, das so still zerronnen. Frau Heidling erzählte von der strahlenden Jugendblüte ihres Schwagers. Zu der Zeit habe man gemeint, es könne ihm an Erfolg nicht fehlen. Jeder habe ihm eine reiche Heirat prophezeit.
Der Regierungsrat ging ernst im Zimmer auf und nieder.
»Das war sein Unglück«, bemerkte er, stehen bleibend. »Gustav stellte seine Hoffnung und seine Pläne auf die Frauen, statt auf sich selbst. Dabei konnte natürlich nur ein verfehltes, törichtes Leben herauskommen. Man soll von den Toten ja nichts Übles reden – aber was hat die menschliche Gesellschaft, was er selbst von seiner Existenz gehabt? – Keine Pflichten – kein Beruf – kein Streben nach eigener Vervollkommnung … Nur immer die Frauen – die Frauen! Schließlich haben die Frauen ihn auch nur genarrt!«
Der Regierungsrat schwieg – vor Agathe durfte man den ferneren Gedankengang nicht gut laut werden lassen.
Agathe nahm ihre Guirlande und trug sie hinüber in das Sterbezimmer, wo der gute Onkel im Sarge lag. Mit leisen, vorsichtigen Bewegungen schlang sie das Grün um sein weißes Kissen. Wie er zusammengefallen war, nun man ihm auch die falschen Zähne herausgenommen hatte. Ein sehr alter Mann – und doch hatte er noch nicht die Sechzig erreicht.
Niemand grämte sich über seinen Tod – auf der weiten Welt niemand – die Frauen hatten ihn nur genarrt.
Wer wird sich einmal um sie grämen? Niemand – auf der weiten Welt niemand. Die Liebe hatte sie auch nur genarrt.
*
Bei Onkel Gustavs Begräbnis holte Mama sich eine Erkältung, und nun brach sie vollends zusammen.
Das war eine andere Pflege, als die von Onkel Gustav. Schlaflose Nächte – wochenlang in tätlicher Aufregung, ein zitterndes Bangen und Erwarten … O Gott – o mein Gott – musste sie von hinnen?
Agathe verzweifelte fast bei der Vorstellung.
Nein – dann war das Leben länger nicht zu ertragen – dann machte auch sie ein Ende! Sicherlich! Papa konnte zu Eugenie und Walter gehen.
»O Herrgott – o barmherziger Heiland – strafe mich nicht um meines Unglaubens willen! Lass mir doch mein liebes Mütterchen noch! Ich habe ja weiter nichts – weiter nichts!«
Sie wollte auch, gar kein Verständnis, keine geistige Gemeinschaft – nur das bisschen Liebe und Zärtlichkeit nicht verlieren.
Der gleiche Kampf, Tag und Nacht Agathe war es oft, als ringe sie Körper an Körper mit dem Tode und als müsse sie siegen, wenn sie alle Kräfte bis aufs äußerste anspannte – keine Sekunde nachließ – immerfort auf der Wacht blieb …
»Wie Agathe das aushält, ist mir unbegreiflich«, sagte Eugenie. »Ich hätte dem Mädchen so viel Stärke gar nicht zugetraut.«
»In der Not sieht man erst, was in dem Menschen steckt«, bemerkte Walter achtungsvoll.
Sie sollte eine Diakonissin zur Hilfe nehmen.
Ja – schon gut! Aber was wusste die Krankenschwester von dem heimlichen Kampf? Würde sie mitten in der Todesangst sich das Hirn zermartern, welche Listen nun angewendet werden mussten, um das Furchtbare zu vertreiben, das da unsichtbar und wartend im Zimmer stand – dicht neben Agathe – sie fühlte es – sie roch es – sie spürte seine Gegenwart ungreifbar in ihrer Nähe – entsetzte sich mit kalten Schauern, die durchs innerste Mark drangen … Und doch fand sie dabei ein liebes und tröstendes Wort für die Kranke.
Nein – das würde die fremde Pflegerin nicht tun – das konnte sie einfach nicht. Sie wusste ja doch nicht, was davon abhing, dass die alte, müde, traurige Frau nicht starb! Und darum half ihre Gegenwart Agathe auch nichts. Allein musste es durchgeschafft werden.
In der letzten Zeit betete Agathe nicht mehr. Ihr Herz war gefühllos geworden, wie in allen Krisen ihres Lebens, sie glaubte auch nicht, dass sie ihre Mutter wiedersehen werde. Sie vermochte sich das geduldige Antlitz, den alten, schmerzensvollen Leib, welchen sie mit tausend Zärtlichkeiten pflegte, nicht in verklärter Gestalt zu denken. Das würde ja doch nicht ihre Mutter mehr sein.
Die Kranke sprach oft vom Himmel und von ihren gestorbenen Kinderchen, die sie dort erwarteten. Dann nahmen ihre Augen einen so sehnsüchtigen Ausdruck an, dass man ahnen konnte, wie viel von ihrem Herzensleben die Frau mit ihnen ins Grab gelegt hatte. Sie war mit dem lebenden Sohn und der Tochter nicht gewachsen – sie war immer die Mutter der kleinen Kinder geblieben. In lichten, schmerzfreien Augenblicken erzählte sie Agathe Geschichtchen aus deren Säuglingsalter und flüsterte ihr die Kosenamen zu, in denen sie einst mit dem unbewussten, zappelnden kleinen Tierchen auf ihrem Schoße gespielt hatte.
Unzählige Male musste Agathe ihr versprechen, für den Papa zu sorgen, dass er alles genau so bekäme, wie er es gewohnt sei, immer bei ihm zu bleiben, ihn zu pflegen und lieb zu haben. Und Agathe versprach alles – wie sollte sie auch nicht? Sie war ja nun mit ihrem Vater vereinigt in einem Kummer.
Als Mama gestorben war, klammerten sie sich aneinander und weinten zusammen, wenigstens in den ersten Stunden nach ihrem Tode. Später fand Papa seine ruhige, würdige Haltung wieder, und Agathe verbarg ihre Tränen, um ihn nicht noch mehr zu betrüben.
Ihr ganzes tägliches Dasein, ihre geringsten Handlungen waren nun gleichsam überschattet von dem Andenken der Toten. Unsichtbare Geisterhände regierten im Hause und leiteten nach wie vor alles dem Willen und den Eigentümlichkeiten der Dahingeschiedenen gemäß.
Wie zu ihren Lebzeiten bürstete Agathe jeden Abend den Teppich im Wohnzimmer ab und rollte ihn zusammen, und jetzt fielen Tränen der Sehnsucht nach der Vergangenheit daraus nieder.
Sie hätte nun den Haushalt führen können, wie sie wollte. Aber sie fand keine Freude mehr an diesem Gedanken. Sie leitete ihn auch nicht für sich, sondern betrachtete ihn als ein ehrwürdiges Vermächtnis der Toten. Die Verantwortung, welche sie übernommen hatte, peinigte sie, und sie hetzte sich ab in einer fieberhaften Tätigkeit, damit niemand ihr vorwerfen könne, sie zeige sich ihrer heiligen Aufgabe nicht gewachsen.
XI.
Agathe stieg auf den Boden. Sie hatte begonnen, eine Inventur all der Dinge aufzunehmen, die nun ihrer Obhut unterstellt waren. Zu dem Zweck sollten auch die Kisten und Kasten dort oben untersucht werden. Bei dieser Gelegenheit bat Eugenie, die im Winter das von Walter langersehnte Töchterchen zu den zwei Jungen bekommen hatte, ihr von den kleinen Kindersachen zu geben, die Mama noch immer aufbewahrte. Mama war so eigensinnig gewesen in der Beziehung – sie gab nicht ein Stückchen heraus. Aber Agathe nützten die Sachen ja doch nichts mehr.
Indem Agathe die letzte steile Treppe erklomm, fühlte sie plötzlich, dasselbe Leiden, von dem ihre Mutter lange Jahre hindurch heimgesucht war; thalergroße Stellen an ihrem Körper, in denen ein Schmerz tobte, als habe ein wütendes Tier sich dort mit seinen Zähnen festgebissen.
Ihre Mutter wusste, warum sie diese Qualen litt. Sie – die zarte Frau – hatte sechs Kinder geboren, und vier von ihnen hatte sie sterben sehen müssen. Da war es ja verständlich, dass ihre Kräfte erschöpft waren und die misshandelte Natur sich, rächte. In gewisser Weise war Mama immer stolz auf ihr Leiden gewesen. Sie trug es wie einen Teil ihres Lebens, als die Dornenkrone des Weibes – ihr von Ewigkeit her vorbestimmt.
Wie kam Agathe als junges Mädchen, das geschont und gehütet war und niemals für das Menschengeschlecht auch nur das Geringste geleistet hatte, zu diesem schrecklichen Erbe? Das war ja geradezu unnatürlich, war wie ein boshafter Hohn des Schicksals! Der Gram um ihre Mutter?
War es nicht auch unnatürlich, wenn sie der Tod einer müden, alten Frau, die ihre Aufgabe erfüllt hatte, mit einer so maßlosen Verzweiflung ergriff, dass sie in jedem Augenblick des Alleinseins weinte und weinte und sich nicht zu fassen vermochte?
So ging es nicht weiter! – Sie richtete sich ja zu Grunde!
Sie sah es ja – sie fühlte es!
Und sie fasste plötzlich den Entschluss, alle die Schmerzen des Leibes und der Seele durch die Kraft ihres Willens zu bezwingen. Sie sammelte alle Energie in sich und stachelte sie zum Kampf, richtete sie auf ein Ziel. –
Sie begann zu lächeln und sich selbst einzubilden, nichts tue ihr weh. Sie raffte sich auf und ging mit leichten, elastischen Schritten, wie ein glücklicher, von Tatenlust überströmender Mensch an ihre Arbeit.
Warme, dumpfe Luft erfüllte die Bodenkammer. Agathe stieß eine Dachluke auf. Ein Strom von Sonnenlicht schoss herein und verbreitete sich unter dem Balkengewirr, zwischen all den verstaubten Gegenständen, die im Laufe der Jahre hier heraufgewandert waren. Sie blickte durch das kleine Fensterchen. Die Schieferdächer der Stadt umgab ein leichter, bläulich-goldener Duft – von Ferne leuchtete die grüne Ebene des freien Landes mit ihren gelben Rapsfeldern und den Blütenbäumen an den Chausseen freundlich herüber.
Agathe begann vor sich hinzusummen:
Es blüht das fernste, tiefste Tal –
Nun, armes Herz, vergiss die Qual,
Es muss sich alles, alles wenden …
Dabei zog sie eine Kiste hervor, schloss auf und kniete davor nieder. Obenauf lagen ihre Puppen. Als sie die verblichenen, zerzausten Wachsköpfchen wiedersah, wurde sie mit einer gewaltsamen Deutlichkeit in jenen Tag zurückversetzt, an dem sie sie eingepackt hatte.
War es auch eine andere Bodenkammer, der Sonnenstrahl tanzte ebenso lustig in dem grauen Staubwust umher, und niemand hatte seitdem die Kiste geöffnet. Unter der rosenroten Decke fand sie, zerknittert und verdrückt, wie sie es in der glückseligen Aufregung ihrer siebzehn Jahre eilig hineingesteckt hatte, das feine, spitzenbesetzte Hemdchen.
Sie wollte tapfer sein – sie wollte keine Träne weinen … Und erbleichend in der Anstrengung, die es sie kostete, packte sie hastig alle die hübschen kleinen Dinge in ihre Schürze, um sie Eugenie zu bringen, während sie ganz sinnlos noch immer vor sich hinsummte:
Es blüht das fernste, tiefste Tal –
Nun, armes Herz, vergiss die Qual,
Es muss sich alles, alles wenden …
Als sie sich aufrichtete, stieß sie an eine andere kleine Kiste. Es klirrte darin wie Glasscherben. Sie war angefüllt mit leeren Fläschchen, alle von der gleichen Größe. Dazwischen lagen Bündel bestaubter Etiquetten. Agathe nahm eine Handvoll heraus – sie trugen alle die gleiche Inschrift:
Heidlings Jugendborn. –
Das war alles, was von Onkel Gustav auf Erden geblieben war.
Agathe biss die Zähne in die Lippe. Nur nicht die leeren Hülsen gescheiterter Hoffnungen so hinter sich zurücklassen!
Nur tapfer sein, zu rechter Zeit einen Abschluss machen!
Im Esszimmer wartete Eugenie.
Als sie anfing, die lieben Sächelchen gegen das Licht zu halten, schadhafte Stellen mit dem Nagel zu prüfen, und ihr vieles nicht mehr gut genug war, als sie wegwerfend bemerkte: »Mützen trägt jetzt kein Kind mehr, die kannst Du Dir pietätvoll einbalsamieren«, hätte Agathe sie ins Gesicht schlagen mögen. Aber diese dumpfe Wut war töricht – sie musste auch überwunden werden.
Agathe legte ihr freundlich beiseite, was sie gewählt hatte. Die Schwägerinnen küssten einander, und Frau Heidling junior entfernte sich in ihrer eleganten Trauertoilette mit dem Kreppschleier, der ihr lang und feierlich über den schlanken, geschmeidigen Rücken wallte. Sie würde den Burschen schicken, um den Korb zu holen.
Nun noch das Spielzeug. Cousine Mimi Bär war vorstehende Schwester der Kinderstation im Krankenhause, die konnte dergleichen immer brauchen. Mimi war erfreut, als Agathe ankam, und forderte sie auf, ihre Gaben selbst unter die Kleinen zu verteilen. Wenn’s nun auch nicht die eigenen sein konnten – es kam doch so jedenfalls Kindern zu gute. In dem großen, geweißten Saal saßen oder lagen sie reihenweise in ihren eisernen Gitterbettchen, armselige Geschöpfe, manche mit Gazeverbänden um die kleinen Köpfe, von Skropheln und Ausschlag entstellt oder von Fieber verzehrt, mit gereiftem, leidendem Ausdruck in den blassen Gesichtchen. Aber alles war hell und sauber, die Bettchen so schneeig – es machte doch einen traulichen Eindruck. Als Schwester Mimi eintrat, wendeten sich alle die Köpfchen ihr zu. Ungeduldige Stimmchen riefen ihren Namen. Sie ging von Reihe zu Reihe, mit einem behaglichen Frohsinn aus ihren großen Zügen unter der steifgestärkten Haube. Sie scherzte hier, strafte lustig dort – Agathe beneidete sie als friedliche Herrscherin hier in diesem Reich der Krankheit und des Todes.
Sich überwinden – glücklich sein mit anderen – bis zur Selbstvergessenheit – bis zur Selbstvernichtung – das ist das Einzige – das Wahre!
Und sie verteilte alle ihre lieben Andenken unter die armen, geplagten Kinder des Volkes, sie spaßte und spielte mit ihnen. Da war ein kleines Mädchen – hässlich wie ein braunes Äffchen, aber voller Lebendigkeit, wie das die arme verblasste Prinzessin Holdewina in ihrem Bettchen Purzelbäume schlagen ließ – nein, das war zu komisch! Agathe verfiel in ein lautes Lachen – sie lachte und lachte …
»Aber Agathe, rege meine Kinder nicht auf«, mahnte die ruhige Mimi. Agathe wollte sich zusammennehmen – die Tränen quollen ihr aus den Augen – das Lachen tat ihr weh, es schüttelte sie wie ein Krampf – die Kleinen blickten furchtsam nach ihr, die Töne, die sie ausstieß, waren fern von Fröhlichkeit.
Mimi nahm sie am Arm und trug sie fast hinaus. Sie öffnete ein Fenster und pflegte Agathe sorgsam und mit Bedacht, bis diese sich endlich beruhigte und zu Tode erschöpft auf Mimis Lager ruhte.
»Armes Kind«, sagte Mimi mit ihrer überlegenen Güte, »Du musst etwas für Dich tun. Du bist sehr überreizt.«
XII.
Der Regierungsrat Heidling hörte von allen Seiten, dass seine Tochter sich durchaus eine Erholung gönnen müsse. Er selbst hatte nichts dergleichen bemerkt, sie war ja doch nicht krank und tat ihre Pflicht. Aber da der Hausarzt es auch meinte, so sollte natürlich etwas geschehen. Ihm würde ein wenig Zerstreuung auch wohltätig sein. Er vermisste seine arme Frau mit jedem Tage mehr. Agathe gab sich ja alle Mühe – aber die Frau konnte ihm so ein junges Mädchen ja doch nicht ersetzen. Seine Gewohnheiten waren trostlos gestört.
So reiste er denn mit Agathe nach der Schweiz.
Auf dem Wege besuchten sie Woszenskis für ein paar Stunden. Sie lagen noch, immer in hartem Kampf mit der Tücke, der Hässlichkeit und Dummheit ihrer lebenden und toten Umgebung. Noch immer hinderten boshafte, mit seltsamen Gebrechen des Leibes und Geistes Behaftete Köchinnen Frau von Woszenski am Arbeiten. Noch immer wurden auf dem Kunstmarkt lachende Neger und gut frisierte Jäger mehr begehrt als nackende Anachoreten und ekstatische Nonnen. Noch immer war es ein Leiden, dass Michel nichts essen mochte. Der Blödsinn seiner früheren Gymnasiallehrer wurde aber noch übertroffen von dem Stumpfsinn der Akademieprofessoren, unter denen er jetzt studierte. Noch immer hatte Herr von Woszenski die barocksten Pläne und Einfälle, und noch immer fehlt es ihm an Stimmung zu ihrer Ausführung.
Sein langer Bart und das wirre Haar waren ergraut, die Adlernase trat noch schärfer hervor, die blauen Augen sahen aus tiefen Höhlen schwermütig in die närrische Welt. Mehr als je glich er seinen von wunderlichen Visionen heimgesuchten Anachoreten.
Als Agathe auf dem mit einem verschossenen persischen Teppich bedeckten Divan saß, ihre Blicke über die buntbemalten, steifen Kirchenheiligen, die dunklen Radierungen an den Wänden und die gelben Einbände französischer Romane auf den geschnitzten Stühlen glitten, als sie den scharfen des Terpentin und der ägyptischen Zigaretten in der Wohnung spürte, war es ihr zu Mut, als kehre sie aus einer sehr langen, öden und gehaltlosen Verbannungszeit in ihre Heimat zurück.
Aber es war Torheit, sich dem hinzugeben. Sie musste noch an demselben Abend wieder Abschied nehmen. Und sie konnte so tiefe Empfindungen, wie sie sie einst in diesem Hause durchlebt, jetzt kaum noch in der Erinnerung vertragen.
Sie hörte, dass Adrian Lutz sich verheiratet habe mit ihrer alten Pensionsgefährtin Klotilde, der Tochter des Berliner Schriftstellers. Die Ehe war nicht glücklich, – man sprach bereits von Scheidung. In Agathe regte sich Verachtung und Widerwillen der wohlerzogenen Bürgerstochter gegen das Unsichere, Schweifende solcher Künstlerexistenzen. Eine geschiedene Frau – hätte es so geendet, wenn sie die Seine geworden wäre?
Als Maler habe Lutz bei weitem nicht erreicht, was er einst versprochen. Seine Schülerin, Fräulein von Henning, habe ihn förmlich überholt. »Das heißt – von Geist und Grazie hat die Person ja keinen Schimmer«, sagte Frau von Woszenski. »Aber die Energie! Damit macht sie mehr, als hätte sie Talent! Stellt in Paris im Salon aus …«
»Nun, Talent hat sie doch auch«, meinte Woszenski gütig.
»Ach, mein Mann nimmt’s mit den Damen nicht so genau«, rief Mariechen und lachte scharf und laut.
Agathe bemerkte wohl, dass ihrem Vater die Art von Woszenskis nicht sympathisch war. Wie sollte sie auch.
Sie fragte, was aus dem Bilde geworden sei, an dem Herr von Woszenski damals arbeitete – die Ekstase der Novize. Ob er es verkauft habe.
»Ach, verkauft! Ich arbeite noch daran.«
Er blickte über die Brille nachdenklich auf Agathe.
»Warum habe ich Sie nur damals nicht als Modell genommen?«
Er brachte eine Farbenskizze zu dem neuen Entwurf. Es war im Laufe der Zeit ein völlig anderes Bild geworden.
Statt des himmlischen Sonnensturmwindes, der die üppige rot und goldene Pracht des Hochaltars wirbelnd bewegte und in dem Tausende von Engelsköpfen die niedergesunkene Gottesbraut selig-toll umflatterten, glitt nun ein leichenhaftes, blaues Mondlicht durch den Säulengang eines Klosters. In dem stillen Geisterschein schwebte ein bleiches Kind mit einer Dornenkrone zu ihr hernieder. Die Nonne war nicht mehr das rosige Geschöpf, welches den kleinen Erlöser in ihren Armen empfing und mit unschuldig strahlendem Lächeln an ihr Herz drückte. Im Starrkrampf lag sie am Boden, die Arme steif ausgestreckt, als sei sie ans Kreuz geschlagen – die roten Wundenmale an der blassen Stirn und den wächsernen Händen.
»Man versucht eben auf mancherlei Weise auszudrücken, was man meint«, sagte Woszenski leise: »Mit den Jahren verändern sich dabei die Ideeen.«
Er seufzte tief und stellte die Leinwand, die Agathe schweigend und lange betrachtet hatte, beiseite.
»Mein Freund Hamlet« nannte Lutz einmal den grüblerischen Künstler. Und der Tag, an dem sie Lutz zum ersten Male gesehen, stand wieder vor Agathe. Zwischen damals und heute lag ihr Leben. Und nun nichts mehr? Ein langsames Erstarren in Kälte und Entsagung?
Sie blickte nieder auf ihre wächsernen Hände, und fast meinte sie, das blutige Stigma müsse dort sichtbar werden …
Was ihr für wunderliche, sinnlose Gedanken bisweilen kamen …
*
Acht Tage später saß Agathe auf der Veranda einer Schweizer-Pension und sah über Geranien- und Nelkentöpfe nach den hohen Bergen. Vom schwindenden Abendlicht wurden sie in braunviolette Tinten getaucht und standen mit ihren gewaltigen Linien gegen den südlich warmen blauen Himmel.
Gott – war das schön! – Auf alle ernsten, tiefen Menschen wirkt die große Natur beruhigend, erhebend, heilend. Sol musste denn auch Agathe beruhigt, erhoben, geheilt werden. Es war das letzte Mittel. Es musste helfen!
War es umsonst – dann – Ja dann? –
Sie wollte nicht daran denken, an die schreckliche Angst, die immer in ihrer Nähe lauerte, bereit, über sie herzustürzen …
Nur die Nächte …
Durch die lange Zeit des Wachens am Krankenlager ihrer Mutter hatte sie das ruhige Schlafen verlernt. Zwar nach den weiten Spaziergängen mit Vater sank sie, trunken von der Gebirgsluft, übermüdet in ihre Kissen und verlor sofort das Bewusstsein. Doch nach kurzem fuhr sie mit jähem Schrecken empor – es war, als hätte sie einen Schlag empfangen. – Etwas Furchtbares war geschehen …! Sie konnte sich nicht besinnen, was es gewesen … Der Schweiß rieselte an ihr nieder, das Herz klopfte ihr … O Gott, was war es denn nur?
Jemand war im Zimmer – dicht in ihrer Nähe! – Es sollte ihr etwas Böses geschehen – sie fühlte es deutlich.
Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie in die Dunkelheit.
Sie musste sich gewaltig zusammennehmen, dass sie nicht laut aufschrie in Furcht und Grauen.
Dann redete sie sich Vernunft ein. Ihr Vater war ja nebenan. Sie horchte, es drang kein Laut zu ihr. Papa schlief ganz friedlich.
Diebe …? In dem fremden Hotel. Es konnte ja sein – es war sogar wahrscheinlich.
Wieder horchte sie angestrengt.
Aber vorige Nacht hatte sie dasselbe durchgemacht und die vorige auch. Einbildung – alles war nur Einbildung.
Kaum legte sie sich auf ihrem Lager zurecht – da war es auch schon wieder … Das Fremde – Geisterhafte – Unbegreifliche … Was konnte es nur sein?
»O Gott, lieber, lieber Gott, hilf mir doch«, betete sie schaudernd und kroch mit dem Kopf unter die Decke. »O Gott, lieber Gott, lass mich endlich wieder einschlafen!«
Aber kein Gedanke an Schlafen. Und sie lag und lauschte auf das harte Plätschern des Springbrunnens vor ihrem Fenster.
Er hatte eine Sprache – aber sie verstand sie nicht. Er sang einen Rhythmus – sie musste ihn doch endlich heraushören … Vergebens. Immer das gleiche harte Plätschern. Wenn es doch einmal enden wollte – nur für eine Sekunde … Es war ihr, als läge sie dort im Brunnen und das Wasser plätscherte auf ihre Stirn – immerfort – wie weh es tat.
Heut Mittag – der Herr ihr gegenüber an der Table d’hôte … Sonderbar sah er sie an … Wenn er ihr auf einem einsamen Spazierwege begegnete.
Und der Schiffer, der sie übergefahren, hatte sie auch mit dem Blick verfolgt. Er war eigentlich ein schöner Kerl …
Mein Gott, mein Gott – was ergriff sie denn?
War sie so tief gesunken, sich mit einem Schifferknecht zu beschäftigen?
Strafte Gott sie für ihr Abfallen vom Glauben, indem er sie der Gewalt des Teufels überließ? Wenn es nun doch eine Hölle gab? Ewige Verdammnis – ewige … Ewiges Bewusstsein seiner Qual … Schon fühlte sie ihre Schrecken in dieser Verlassenheit – diesem Ekel an sich selbst.
Adrian … Adrian Lutz … Ja, den allein hatte sie geliebt. O du Einziger, Schöner – Süßer …
Nein – es war ja gar nicht Adrian, an den sie eben dachte – es war Raikendorf. Und Raikendorf auch nicht … Martin – Martin Greffinger! Damals in Bornau hatte er sie doch lieb gehabt! Hätte sie ihm den Kuss gegeben, um den er sie bat … Sich dann mit ihm verlobt! So viele Mädchen verloben sich mit Schülern … Martin hätte sie mit sich hinausgenommen in sein fremdes, abenteuerliches Leben … Sie hätten für eine große Sache gekämpft, und sie wären selbst groß und frei und stark dabei geworden. O ja – sie hätte schon eine ganz tüchtige Sozialistin abgegeben!
Wie konnte sie nur von seiner warmen, schönen jungen Liebe damals so ungerührt bleiben?
Wenn Adrian sie verführt hätte – wie die Daniel?
O mein Gott!
Sie richtete sich auf und zündete Licht an. Die endlose Nacht war nicht zu ertragen! Mit bloßen Füßen lief sie zum Fenster, lehnte sich hinaus und atmete die frische, düftegetränkte Bergluft.
Wie müde – wie müde …
In der Morgendämmerung schlief sie zuweilen noch ein.
Unglücklicherweise hatte Papa die Leidenschaft der frühen Ausflüge. So wurde sie oft nach einer halben Stunde schon wieder geweckt. Und sie wagte ihm nicht zu sagen, dass sie schlecht schlief. Es würde ihm die Sommerfrische verdorben haben.
Der Beginn des Tages war ja auch köstlich. Aber um zehn Uhr befand sich das Mädchen schon in einem Zustand von Abspannung und nervöser Unruhe, der nur durch eine krampfhafte Anstrengung aller Selbstbeherrschung verborgen werden konnte.
Es war auch so schwül. Früh brannte und stach die Sonne in das weite, schattenlose, von den hohen Felsengebirgen umschlossene Tal. Abends entluden sich schwere Gewitter. Sie kühlten die Luft kaum. Nur ein feuchter Dampf quoll von den Matten, aus den Obstgärten, schwebte über dem wilden rauschenden Bergwasser, das den Ort durchströmte, und der warme Dunst senkte sich ermattend auf die nach Erquickung schmachtenden Menschen nieder.
Dabei verging dem Regierungsrat die Lust, weitere Partien zu unternehmen. Man saß auf der Veranda oder unter einer Edelkastanie des Hotelgärtchens – Agathe mit ihrer Handarbeit, Papa mit einer Zigarre und der Zeitung – so ziemlich, wie man daheim im Harmoniegarten auch gesessen hatte.
War das Gewitter schon gegen Mittag eingetreten, so schlenderte man um die Zeit des Sonnenunterganges zum See hinaus.
Sie hatten eine Gerichtsratsfamilie mit einer ältlichen Tochter zum Umgang gefunden – so blieb man hübsch in dem gewohnten Geleise der Unterhaltung.
Agathe fragte sich zuweilen, warum sie eigentlich nach der Schweiz gereist waren.
Sie sah die Felsenberge an in ihrer stummen, gewaltigen Größe – sie starrte in das eilig brausende Gewässer – sie betrachtete die Kastanien und Nussbäume, die thaufunkelnden Farne – die Granaten in den Gärten – die ganze schon südlich sie anmutende Vegetation – und an alle tat sie die gleiche Frage. Die Felsen schwiegen in steinerner Ruhe, das Wasser brauste hinab zum See – die Granaten blühten, und die Bäume reiften ihre Früchte. Sie gaben Agathe keine Antwort. Und die aufdringliche Schönheit, die üppige Pracht dieser Natur ermüdete, beleidigte, empörte sie.