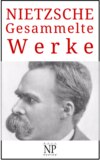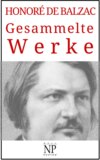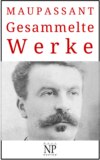Buch lesen: «Friedrich Wilhelm Nietzsche – Gesammelte Werke», Seite 57
6
Die irdische Gebrechlichkeit und ihre Hauptursache. – Man trifft, wenn man sich umsieht, immer auf Menschen, welche ihr Lebenlang Eier gegessen haben, ohne zu bemerken, daß die länglichten die wohlschmeckendsten sind, welche nicht wissen, daß ein Gewitter dem Unterleib förderlich ist, daß Wohlgerüche in kalter, klarer Luft am stärksten riechen, daß unser Geschmackssinn an verschiedenen Stellen des Mundes ungleich ist, daß jede Mahlzeit, bei der man gut spricht oder gut hört, dem Magen Nachteil bringt. Man mag mit diesen Beispielen für den Mangel an Beobachtungssinn nicht zufrieden sein, um so mehr möge man zugestehen, daß die allernächsten Dinge von den meisten sehr schlecht gesehen, sehr selten beachtet werden. Und ist dies gleichgültig? – Man erwäge doch, daß aus diesem Mangel sich fast alle leiblichen und seelischen Gebrechen der einzelnen ableiten: nicht zu wissen, was uns förderlich, was uns schädlich ist, in der Einrichtung der Lebensweise, Verteilung des Tages, Zeit und Auswahl des Verkehres, in Beruf und Muße, Befehlen und Gehorchen, Natur- und Kunstempfinden, Essen, Schlafen und Nachdenken; im Kleinsten und Alltäglichsten unwissend zu sein und keine scharfen Augen zu haben – das ist es, was die Erde für so viele zu einer "Wiese des Unheils" macht. Man sage nicht, es liege hier wie überall an der menschlichen Unvernunft: vielmehr – Vernunft genug und übergenug ist da, aber sie wird falsch gerichtet und künstlich von jenen kleinen und allernächsten Dingen abgelenkt. Priester und Lehrer, und die sublime Herrschsucht der Idealisten jeder Art, der gröberen und feineren, reden schon dem Kinde ein, es komme auf etwas ganz anderes an: auf das Heil der Seele den Staatsdienst, die Förderung der Wissenschaft oder auf Ansehen und Besitz, als die Mittel, der ganzen Menschheit Dienste zu erweisen, während das Bedürfnis des einzelnen, seine große und kleine Not innerhalb der vierundzwanzig Tagesstunden etwas Verächtliches oder Gleichgültiges sei. – Sokrates schon wehrte sich mit allen Kräften gegen diese hochmütige Vernachlässigung des Menschlichen zugunsten des Menschen und liebte es, mit einem Worte Homers, an den wirklichen Umkreis und Inbegriff alles Sorgens und Nachdenkens zu mahnen: das ist es und nur das, sagte er, "was mir zu Hause an Gutem und Schlimmem begegnet".
7
Zwei Trostmittel. – Epikur, der Seelen-Beschwichtiger des späteren Altertums, hatte jene wundervolle Einsicht, die heutzutage immer noch so selten zu finden ist, daß zur Beruhigung des Gemüts die Lösung der letzten und äußersten theoretischen Fragen gar nicht nötig sei. So genügte es ihm, solchen, welche "die Götterangst" quälte, zu sagen: "wenn es Götter gibt, so bekümmern sie sich nicht um uns", – anstatt über die letzte Frage, ob es Götter überhaupt gebe, unfruchtbar und aus der Ferne zu disputieren. Jene Position ist viel günstiger und mächtiger: man gibt dem andern einige Schritte vor und macht ihn so zum Hören und Beherzigen gutwilliger. Sobald er sich aber anschickt das Gegenteil zu beweisen – daß die Götter sich um uns bekümmern –, in welche Irrsale und Dorngebüsche muß der Arme geraten, ganz von selber, ohne die List des Unterredners, der nur genug Humanität und Feinheit haben muß, um sein Mitleiden an diesem Schauspiele zu verbergen. Zuletzt kommt jener andere zum Ekel, dem stärksten Argument gegen jeden Satz, zum Ekel an seiner eigenen Behauptung; er wird kalt und geht fort mit derselben Stimmung, wie sie auch der reine Atheist hat: "was gehen mich eigentlich die Götter an! hole sie der Teufel!" – In anderen Fällen, namentlich wenn eine halb physische, halb moralische Hypothese das Gemüt verdüstert hatte, widerlegte er nicht diese Hypothese, sondern gestand ein, daß es wohl so sein könne: aber es gebe noch eine zweite Hypothese, um dieselbe Erscheinung zu erklären; vielleicht könne es sich auch noch anders verhalten. Die Mehrheit der Hypothesen genügt auch in unserer Zeit noch, zum Beispiel über die Herkunft der Gewissensbisse, um jenen Schatten von der Seele zu nehmen, der aus dem Nachgrübeln über eine einzige, allein sichtbare und dadurch hundertfach überschätzte Hypothese so leicht entsteht. – Wer also Trost zu spenden wünscht, an Unglückliche, Übeltäter, Hypochonder, Sterbende, möge sich der beiden beruhigenden Wendungen Epikurs erinnern, welche auf sehr viele Fragen sich anwenden lassen. In der einfachsten Form würden sie etwa lauten: erstens, gesetzt es verhält sich so, so geht es uns nichts an; zweitens: es kann so sein, es kann aber auch anders sein.
8
In der Nacht. – Sobald die Nacht hereinbricht, verändert sich unsere Empfindung über die nächsten Dinge. Da ist der Wind, der wie auf verbotenen Wegen umgeht, flüsternd, wie etwas suchend, verdrossen, weil er’s nicht findet. Da ist das Lampenlicht, mit trübem rötlichem Scheine, ermüdet blickend, der Nacht ungern widerstrebend, ein ungeduldiger Sklave des wachen Menschen. Da sind die Atemzüge des Schlafenden, ihr schauerlicher Takt, zu der eine immer wiederkehrende Sorge die Melodie zu blasen scheint, – wir hören sie nicht, aber wenn die Brust des Schlafenden sich hebt, so fühlen wir uns geschnürten Herzens, und wenn der Atem sinkt und fast ins Totenstille erstirbt, sagen wir uns "ruhe ein wenig, du armer gequälter Geist!" – wir wünschen allem Lebenden, weil es so gedrückt lebt, eine ewige Ruhe; die Nacht überredet zum Tode. – Wenn die Menschen der Sonne entbehrten und mit Mondlicht und Öl den Kampf gegen die Nacht führten, welche Philosophie würde um sie ihren Schleier hüllen! Man merkt es ja dem geistigen und seelischen Wesen des Menschen schon zu sehr an, wie es durch die Hälfte Dunkelheit und Sonnen-Entbehrung, von der das Leben umflort wird, im ganzen verdüstert ist.
9
Wo die Lehre von der Freiheit des Willens entstanden ist. – Über dem einen steht die Notwendigkeit in der Gestalt seiner Leidenschaften, über dem andern als Gewohnheit zu hören und zu gehorchen, über dem dritten als logisches Gewissen, über dem vierten als Laune und mutwilliges Behagen an Seitensprüngen. Von diesen vieren wird aber gerade da die Freiheit ihres Willens gesucht, wo jeder von ihnen am festesten gebunden ist: es ist, als ob der Seidenwurm die Freiheit seines willens gerade im Spinnen suchte. Woher kommt dies? Ersichtlich daher, daß jeder sich dort am meisten für frei hält, wo sein Lebensgefühl am größten ist, also, wie gesagt, bald in der Leidenschaft, bald in der Pflicht, bald in der Erkenntnis, bald im Mutwillen. Das, wodurch der einzelne Mensch stark ist, worin er sich belebt fühlt, meint er unwillkürlich, müsse auch immer das Element seiner Freiheit sein: er rechnet Abhängigkeit und Stumpfsinn, Unabhängigkeit und Lebensgefühl als notwendige Paare zusammen. – Hier wird eine Erfahrung, die der Mensch im gesellschaftlich-politischen Gebiete gemacht hat, fälschlich auf das allerletzte metaphysische Gebiet übertragen: dort ist der starke Mann auch der freie Mann, dort ist lebendiges Gefühl von Freude und Leid, Höhe des Hoffens, Kühnheit des Begehrens, Mächtigkeit des Hassens das Zubehör der Herrschenden und Unabhängigen, während der Unterworfene, der Sklave, gedrückt und stumpf lebt. – Die Lehre von der Freiheit des Willens ist eine Erfindung herrschender Stände.
10
Keine neuen Ketten fühlen. – So lange wir nicht fühlen, daß wir irgend wovon abhängen, halten wir uns für unabhängig: ein Fehlschluß, welcher zeigt, wie stolz und herrschsüchtig der Mensch ist. Denn er nimmt hier an, daß er unter allen Umständen die Abhängigkeit, sobald er sie erleide, merken und erkennen müsse, unter der Voraussetzung, daß er in der Unabhängigkeit für gewöhnlich lebe und sofort, wenn er sie ausnahmsweise verliere, einen Gegensatz der Empfindung spüren werde. – Wie aber, wenn das Umgekehrte wahr wäre: daß er immer in vielfacher Abhängigkeit lebt, sich aber für frei hält, wo er den Druck der Kette aus langer Gewohnheit nicht mehr spürt? Nur an den neuen Ketten leidet er noch: – "Freiheit des Willens" heißt eigentlich nichts weiter, als keine neuen Ketten fühlen.
11
Die Freiheit des Willens und die Isolation der Fakta. – Unsere gewohnte ungenaue Beobachtung nimmt eine Gruppe von Erscheinungen als eins und nennt sie ein Faktum: zwischen ihm und einem andern Faktum denkt sie sich einen leeren Raum hinzu, sie isoliert jedes Faktum. In Wahrheit aber ist all unser Handeln und Erkennen keine Folge von Fakten und leeren Zwischenräumen, sondern ein beständiger Fluß. Nun ist der Glaube an die Freiheit des Willens gerade mit der Vorstellung eines beständigen, einartigen, ungeteilten, unteilbaren Fließens unverträglich: er setzt voraus, daß jede einzelne Handlung isoliert und unteilbar ist; er ist eine Atomistik im Bereiche des Wollens und Erkennens. – Gerade so wie wir Charaktere ungenau verstehen, so machen wir es mit den Fakten: wir sprechen von gleichen Charakteren, gleichen Fakten: beide gibt es nicht. Nun loben und tadeln wir aber nur unter dieser falschen Voraussetzung, daß es gleiche Fakta gebe, daß eine abgestufte Ordnung von Gattungen der Fakten vorhanden sei, welcher eine abgestufte Wertordnung entspreche: also wir isolieren nicht nur das einzelne Faktum, sondern auch wiederum die Gruppen von angeblich kleinen Fakten (gute, böse, mitleidige, (neidische Handlungen usw.) – beide Male irrtümlich. – Das Wort und der Begriff sind der sichtbarste Grund, weshalb wir an diese Isolation von Handlungen-Gruppen glauben: mit ihnen bezeichnen wir nicht nur die Dinge, wir meinen ursprünglich durch sie das Wahre derselben zu erfassen. Durch Worte und Begriffe werden wir jetzt noch fortwährend verführt, die Dinge uns einfacher zu denken, als sie sind, getrennt voneinander, unteilbar, jedes an und für sich seiend. Es liegt eine philosophische Mythologie in der Sprache versteckt, welche alle Augenblicke wieder herausbricht, so vorsichtig man sonst auch sein mag. Der Glaube an die Freiheit des Willens, das heißt der gleichen Fakten und der isolierten Fakten, – hat in der Sprache seinen beständigen Evangelisten und Anwalt.
12
Die Grundirrtümer. – Damit der Mensch irgend eine seelische Lust oder Unlust empfinde, muß er von einer dieser beiden Illusionen beherrscht sein: entweder glaubt er an die Gleichheit gewisser Fakta, gewisser Empfindungen: dann hat er durch die Vergleichung jetziger Zustände mit früheren und durch Gleich- oder Ungleichsetzung derselben (wie sie bei aller Erinnerung stattfindet) eine seelische Lust oder Unlust; oder er glaubt an die Willens-Freiheit, etwa wenn er denkt "dies hätte ich nicht tun müssen", "dies hätte anders auslaufen können", und gewinnt daraus ebenfalls Lust oder Unlust. Ohne die Irrtümer, welche bei jeder seelischen Lust und Unlust tätig sind, würde niemals ein Menschentum entstanden sein – dessen Grundempfindung ist und bleibt, daß der Mensch der Freie in der Welt der Unfreiheit sei, der ewige Wundertäter, sei es, daß er gut oder böse handelt, die erstaunliche Ausnahme, das Übertier, der Fast-Gott, der Sinn der Schöpfung, der Nichthinwegzudenkende, das Lösungswort des kosmischen Rätsels, der große Herrscher über die Natur und Verächter derselben, das Wesen, das seine Geschichte Weltgeschichte nennt! – Vanitas vanitatum homo.
13
Zweimal sagen. – Es ist gut, eine Sache sofort doppelt auszudrücken und ihr einen rechten und einen linken Fuß zu geben. Auf einem Bein kann die Wahrheit zwar stehen; mit zweien aber wird sie gehen und herumkommen.
14
Der Mensch der Komödiant der Welt. – Es müßte geistigere Geschöpfe geben, als die Menschen sind, bloß um den Humor ganz auszukosten, der darin liegt, daß der Mensch sich für den Zweck des ganzen Weltendaseins ansieht und die Menschheit sich ernstlich nur mit Aussicht auf eine Welt-Mission zufrieden gibt. Hat ein Gott die Welt geschaffen, so schuf er den Menschen zum Affen Gottes, als fortwährenden Anlaß zur Erheiterung in seinen allzulangen Ewigkeiten. Die Sphärenmusik um die Erde herum wäre dann wohl das Spottgelächter aller übrigen Geschöpfe um den Menschen herum. Mit dem Schmerz kitzelt jener gelangweilte Unsterbliche sein Lieblingstier, um an den tragisch-stolzen Gebärden und Auslegungen seiner Leiden, überhaupt an der geistigen Erfindsamkeit des eitelsten Geschöpfes seine Freude zu haben – als Erfinder dieses Erfinders. Denn wer den Menschen zum Spaße ersann, hatte mehr Geist als dieser, und auch mehr Freude am Geist. – Selbst hier noch, wo sich unser Menschentum einmal freiwillig demütigen will, spielt uns die Eitelkeit einen Streich, indem wir Menschen wenigstens in dieser Eitelkeit etwas ganz Unvergleichliches und Wunderhaftes sein möchten. Unsere Einzigkeit in der Welt! ach, es ist eine gar zu unwahrscheinliche Sache! Die Astronomen, denen mitunter wirklich ein erdentrückter Gesichtskreis zuteil wird, geben zu verstehen, daß der Tropfen Leben in der Welt für den gesamten Charakter des ungeheuren Ozeans von Werden und Vergehen ohne Bedeutung ist: daß ungezählte Gestirne ähnliche Bedingungen zur Erzeugung des Lebens haben wie die Erde, sehr viele also, – freilich kaum eine Handvoll im Vergleich zu den unendlich vielen, welche den lebenden Ausschlag nie gehabt haben oder von ihm längst genesen sind: daß das Leben auf jedem dieser Gestirne, gemessen an der Zeitdauer seiner Existenz, ein Augenblick, – ein Aufflackern gewesen ist, mit langen, langen Zeiträumen hinterdrein, – also keineswegs das Ziel und die letzte Absicht ihrer Existenz. Vielleicht bildet sich die Ameise im Walde ebenso stark ein, daß sie Ziel und Absicht der Existenz des Waldes ist, wie wir dies tun, wenn wir an den Untergang der Menschheit in unserer Phantasie fast unwillkürlich den Erduntergang anknüpfen: ja wir sind noch bescheiden, wenn wir dabei stehnbleiben und zur Leichenfeier des letzten Menschen nicht eine allgemeine Welt- und Götterdämmerung veranstalten. Der unbefangenste Astronom selber kann die Erde ohne Leben kaum anders empfinden als wie den leuchtenden und schwebenden Grabhügel der Menschheit.
15
Bescheidenheit des Menschen. – Wie wenig Lust genügt den meisten, um das Leben gut zu finden, wie bescheiden ist der Mensch!
16
Worin Gleichgültigkeit not tut. – Nichts wäre verkehrter, als abwarten wollen, was die Wissenschaft über die ersten und letzten Dinge einmal endgültig feststellen wird, und bis dahin auf die herkömmliche Weise denken (und namentlich glauben!) – wie dies so oft angeraten wird. Der Trieb, auf diesem Gebiete durchaus nur Sicherheiten haben zu wollen, ist ein religiöser Nachtrieb, nichts Besseres, – eine versteckte und nur scheinbar skeptische Art des "metaphysischen Bedürfnisses", mit dem Hintergedanken verkuppelt, daß noch lange Zeit keine Aussicht auf diese letzten Sicherheiten vorhanden und bis dahin der "Gläubige" im Recht ist, sich um das ganze Gebiet nicht zu kümmern. Wir haben diese Sicherheiten um die alleräußersten Horizonte gar nicht nötig, um ein volles und tüchtiges Menschentum zu leben: ebensowenig als die Ameise sie nötig hat, um eine gute Ameise zu sein. Vielmehr müssen wir uns darüber ins Klare bringen, woher eigentlich jene fatale Wichtigkeit kommt, die wir jenen Dingen so lange beigelegt haben: und dazu brauchen wir die Historie der ethischen und religiösen Empfindungen. Denn nur unter dem Einfluß dieser Empfindungen sind uns jene allerspitzesten Fragen der Erkenntnis so erheblich und furchtbar geworden: man hat in die äußersten Bereiche, wohin noch das geistige Auge dringt, ohne in sie einzudringen, solche Begriffe wie Schuld und Strafe (und zwar ewige Strafe!) hineinverschleppt: und dies um so unvorsichtiger, je dunkler diese Bereiche waren. Man hat seit alters mit Verwegenheit dort phantasiert, wo man nichts feststellen konnte, und seine Nachkommen überredet, diese Phantasien für Ernst und Wahrheit zu nehmen, zuletzt mit dem abscheulichen Trumpfe: daß Glauben mehr wert sei, als Wissen. Jetzt nun tut in Hinsicht auf jene letzten Dinge nicht Wissen gegen Glauben not, sondern Gleichgültigkeit gegen Glauben und angebliches Wissen auf jenen Gebieten! – Alles andere muß uns näherstehen als das, was man uns bisher als das Wichtigste vorgepredigt hat – ich meine jene Fragen: wozu der Mensch? Welches Los hat er nach dem Tode? Wie versöhnt er sich mit Gott? und wie diese Kuriosa lauten mögen. Ebensowenig wie diese Fragen der Religiösen gehen uns die Fragen der philosophischen Dogmatiker an, mögen sie nun Idealisten oder Materialisten oder Realisten sein. Sie allesamt sind darauf aus, uns zu einer Entscheidung auf Gebieten zu drängen, wo weder Glauben noch Wissen not tut; selbst für die größten Liebhaber der Erkenntnis ist es nützlicher, wenn um alles Erforschbare und der Vernunft Zugängliche ein umnebelter trügerischer Sumpfgürtel sich legt, ein Streifen des Undurchdringlichen, Ewig – Flüssigen und Unbestimmbaren. Gerade durch die Vergleichung mit dem Reich des Dunkels am Rande der Wissens-Erde steigt die helle und nahe, nächste Welt des Wissens stets im Werte. – Wir müssen wieder gute Nachbarn der nächsten Dinge werden und nicht so verächtlich wie bisher über sie hinweg nach Wolken und Nachtunholden hinblicken. In Wäldern und Höhlen, in sumpfigen Strichen und unter bedeckten Himmeln – da hat der Mensch, als auf den Kulturstufen ganzer Jahrtausende, allzulange gelebt, und dürftig gelebt. Dort hat er die Gegenwart und die Nachbarschaft und das Leben und sich selbst verachten gelernt – und wir, wir Bewohner der lichteren Gefilde der Natur und des Geistes, bekommen jetzt noch, durch Erbschaft, etwas von diesem Gift der Verachtung gegen das Nächste in unser Blut mit.
17
Tiefe Erklärungen. – Wer die Stelle eines Autors "tiefer erklärt", als sie gemeint war, hat den Autor nicht erklärt, sondern verdunkelt. So stehen unsre Metaphysiker zum Texte der Natur; ja noch schlimmer. Denn um ihre tiefen Erklärungen anzubringen, richten sie sich häufig den Text erst daraufhin zu: das heißt, sie verderben ihn. Um ein kurioses Beispiel für Textverderbnis und Verdunkelung des Autors zu geben, so mögen hier Schopenhauers Gedanken über die Schwangerschaft der Weiber stehen. Das Anzeichen des steten Daseins des Willens zum Leben in der Zeit, sagt er, ist der Koitus; das Anzeichen des diesem Willen aufs Neue zugesellten, die Möglichkeit der Erlösung offenhaltenden Lichtes der Erkenntnis, und zwar im höchsten Grade der Klarheit, ist die erneuerte Menschwerdung des Willens zum Leben. Das Zeichen dieser ist die Schwangerschaft, welche daher frank und frei, ja stolz einhergeht, während der Koitus sich verkriecht wie ein Verbrecher. Er behauptet, daß jedes Weib, wenn beim Generationsakt überrascht, vor Scham vergehn möchte, aber "ihre Schwangerschaft, ohne eine Spur von Scham, ja mit einer Art Stolz, zur Schau trägt." Vor allem läßt sich dieser Zustand nicht so leicht mehr zur Schau tragen, als er sich selber zur Schau trägt; indem Schopenhauer aber gerade nur die Absichtlichkeit des Zur-Schau-Tragens hervorhebt, bereitet er sich den Text vor, damit dieser zu der bereitgehaltenen "Erklärung" passe. Sodann ist das, was er über die Allgemeinheit des zu erklärenden Phänomens sagt, nicht wahr: er spricht von "jedem Weibe"; viele, namentlich die jüngeren Frauen, zeigen aber in diesem Zustande, selbst vor den nächsten Anverwandten, oft eine peinliche Verschämtheit; und wenn Weiber reiferen und reifsten Alters, zumal solche aus dem niederen Volke, in der Tat sich auf jenen Zustand etwas zugute tun sollten, so geben sie wohl damit zu verstehen, daß sie noch von ihren Männern begehrt werden. Daß bei ihrem Anblick der Nachbar und die Nachbarin oder ein vorübergehender Fremder sagt oder denkt: "sollte es möglich sein –", dieses Almosen wird von der weiblichen Eitelkeit bei geistigem Tiefstande immer noch gern angenommen. Umgekehrt würden, wie aus Schopenhauers Sätzen zu folgern wäre, gerade die klügsten und geistigsten Weiber am meisten über ihren Zustand öffentlich frohlocken: sie haben ja die meiste Aussicht, ein Wunderkind des Intellekts zu gebären, in welchem "der Wille" sich zum allgemeinen Besten wieder einmal "verneinen" kann; die dummen Weiber hätten dagegen allen Grund, ihre Schwangerschaft noch schamhafter zu verbergen als alles, was sie verbergen. – Man kann nicht sagen, daß diese Dinge aus der Wirklichkeit genommen sind. Gesetzt aber, Schopenhauer hätte ganz im allgemeinen darin recht, daß die Weiber im Zustande der Schwangerschaft eine Selbstgefälligkeit mehr zeigen, als sie sonst zeigen, so läge doch eine Erklärung näher zur Hand als die seinige. Man könnte sich ein Gakkern der Henne auch vor dem Legen des Eies denken, des Inhaltes: Seht! Seht! Ich werde ein Ei legen! Ich werde ein Ei legen!