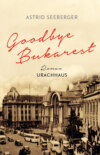Buch lesen: «Nächstes Jahr in Berlin», Seite 2
Stuttgart, den 25. November 2007
Am nächsten Tag fuhr ich zu Mutters Wohnung. Dorthin war sie mit Vater gezogen, als das Mietshaus, in dem ich aufgewachsen war, abgerissen werden sollte. Das neue Haus glich dem alten, ein Betonblock, der ebenso gut in einem Moskauer Vorort hätte stehen können.
Das Aufschließen der Tür ging nur langsam voran. Daran war nicht der Schlüssel schuld. Es lag an dem Geruch des Treppenhauses: Es roch nach Rauch und Reinigungsmitteln. Ich erkannte ihn wieder. Es gibt Gerüche, die sind vollkommen lähmend.
Das Erste, was ich sah, als ich das Licht im Flur anschaltete, war mein Gesicht im Garderobenspiegel. Ich schaute weg. Das dort war nicht ich. Solche aufgerissenen Augen hatte ich nicht. Im Flur hingen keine Kleidungsstücke, nur leere Bügel. Oben auf der Ablage lag Mutters Hut, er war groß und schwarz und mit einer kleinen gesprenkelten Feder geschmückt. Ich zog den Mantel aus und hängte ihn auf, es war mein weicher brauner, den ich in Berlin gekauft hatte, als ich zusammen mit Lech dort war.
Dann ging ich ins Wohnzimmer. Darin war es kalt. Mutter hatte die Heizung abgestellt, wie immer, wenn sie aus dem Haus ging. Ich drehte sie voll auf. Was ich danach tun sollte, wusste ich nicht recht.
Ich betrachtete die Nappaledercouch. Sie stand da, als wäre nichts geschehen, dunkelblau wie der Abendhimmel, darauf zwei hellblaue Kissen, die Mutter mit Blumenranken bestickt hatte. Solange es den Kreuzstich und das Kreuzworträtsel noch gibt, sagte sie zuweilen. Dann verstummte sie, als wüssten wir anderen, wie das Ende des Satzes zu lauten hatte. Oder sie wusste es selbst nicht. Über der Couch hing das Bild, das Mutter zu ihrem fünfzigsten Geburtstag bekommen hatte. Vaters Cousin Heinz hatte ein Schiff gemalt, das dem stürmischen Meer trotzt. Als Vater das Bild zu Gesicht bekam, runzelte er die Stirn. Ihm könne das Meer gestohlen bleiben, sagte er. Er hatte die Nordsee im Zweiten Weltkrieg erlebt. Sein Meer glich nicht Mutters schimmerndem, gesegnetem Gewässer. Sein Meer verschlang, war abgrundtief und schwarz.
Neben der Couch stand Mutters Gummibaum, kerzengerade wie ein preußischer Soldat. Ich entfernte ein Blatt, das bereits gelb geworden war, und legte es auf den Couchtisch, mitten auf das runde Spitzendeckchen, das an den Heiligenschein der Engel von Fra Angelico erinnerte. Ich hatte es Mutter, die Spitzendeckchen liebte, geschenkt. Als könnten diese Deckchen den schweren Mahagonischrank aufhalten, der die ganze Wand gegenüber der Couch einnahm und sich allem in den Weg stellte.
Ich brachte es nicht fertig, die anderen Zimmer zu betreten, nicht sofort. Es war richtig, dachte ich, dass ich Lech nicht mit hergebracht hatte. Und plötzlich fiel mir etwas ein: Als wir das erste Mal miteinander geschlafen hatten und ich glücklich in seinen Armen lag, hatte er leise gesagt: »I am like a pelican in the wilderness.« Ich wusste nicht, ob er der Pelikan war oder eher ich. Und ich habe nicht nachgefragt. Es spielte keine Rolle, damals nicht.
Ich ging ans Fenster. Hätte man im Haus gegenüber Kanonen auf die Balkone gestellt, hätte man es für eine Festung halten können. Auf dem Hof wuchs Rasen, der Wind blies die Samen der Pappeln, die die Straße säumten, dorthin. Zuweilen sah es aus, als wäre das Gras von grauweißem Schaum bedeckt. Diesen Pappelschaum hatte einmal jemand in Brand gesteckt. Und Mutter hatte wie besessen geschrien, das Lodern habe sie um den Verstand gebracht, sagte sie mir später am Telefon.
Ich ging zurück zum Mahagonischrank. Auf einem Absatz stand die Stereoanlage, die Mutter ein halbes Jahr nach Vaters Tod gekauft hatte. Eine CD steckte darin, vielleicht die letzte, die Mutter gehört hatte: Bruckners siebte Symphonie. Die Hülle lag daneben, darauf ein Bild von Karajan, den die Frauen vergöttert hatten, dachte ich, während Bruckner niemals jemanden in die Arme schließen konnte. Auch dass der Kaiser von Bruckners Musik so begeistert war, dass er ihn in seinem Schloss wohnen ließ, hatte nichts daran geändert. Nicht einmal ein Prunkbett hilft, wenn man einen plumpen, unförmigen Körper hat.

Bei einem meiner letzten Besuche hatte Mutter diese CD abspielen lassen. Ich lag schon im Bett, als ich Musik hörte. Kurze Zeit später stand ich auf. In ihrem langen weißen Baumwollnachthemd saß Mutter auf der Couch. Sie hatte kein Licht angemacht, nur der schwache Schein der Straßenlaternen fiel ins Zimmer. Ich setzte mich zu ihr und fragte, ob etwas sei. »Alles gut«, sagte sie. Sie saß vollkommen reglos da, nur ihre Lippen zitterten. Wir lauschten der Musik. Nach dem zweiten Satz, dem Adagio, stand sie auf und schaltete die Anlage aus.
»Genug damit«, sagte sie. Und blieb mit hängenden Armen stehen, als wüsste sie nicht, was sie tun sollte. Dann sagte sie, ich könne die CD mitnehmen, sie habe sie jetzt oft genug gehört.
Dann setzte sie sich auf den Hocker neben der Couch, zog die Schultern hoch, so als friere sie. Ich fragte, ob es eine besondere Bewandtnis mit der Musik habe. Sie gab keine Antwort, nicht sofort, erst, als ich wissen wollte, warum sie sich die Bruckner-Symphonie denn zugelegt habe. Mir sei bisher nicht aufgefallen, dass sie seine Musik möge.
Das habe nichts mit mögen zu tun, sagte Mutter. Doch als sie diese Musik das erste Mal gehört habe, sei ihr klar geworden, dass Bruckner etwas über Einsamkeit wusste.
Es war in Alfdorf gewesen, einem Flecken in der Nähe von Schwäbisch Gmünd, wo sie nach der Flucht aus Ostpreußen gelandet war. Ich wusste, dass sie dort Arbeit bei einem Kerzenmacher gefunden hatte. Doch hatte sie nie über diese Zeit sprechen wollen und war auch nie wieder nach Alfdorf gefahren. Obgleich ihre Stimme stets einen warmen Ton bekam, wenn sie den Kerzenmacher zufällig erwähnte. Einmal sagte sie, er sei ein guter Mann gewesen, doch was vorbei sei, sei vorbei. Jetzt erzählte sie. Als sei die Musik eine Art Türöffner.
Es war an einem späten Abend gewesen, sagte sie, als der Chef und sie Kerzen für eine eilige Lieferung gegossen hatten. Im Radio spielte Musik, das Adagio aus Bruckners Symphonie. Und es rührte etwas in ihrem Herzen an, was sie an jenen Abend erinnerte, als sie mit Tausenden anderer Flüchtlinge über schneebedecktes, schimmerndes Eis gezogen war, nur ganz schwach schimmernd, als versuchte es, ein Fünkchen Tageslicht zurückzuhalten. Mit einer großen schmerzenden Leere in der Brust war sie dahingestapft. Sie hatte alles verloren, ihre Familie mit dem Vater, der einem König glich, und ihr Zuhause, wo man in einem Lichtstreifen von Zimmer zu Zimmer gehen konnte. In Bruckners Musik hatte es eine ähnliche Leere gegeben.
Ich schaute sie an. Man konnte meinen, auf ihrem Gesicht läge der Widerschein des Eises, nicht der der Straßenlaternen. Ihre Lippen zitterten heftig, was sie zu einer Pause zwang. Dann schien sie sich wieder zu fassen.
Es gibt Augenblicke, an die man sich genau erinnert, sagte sie, in denen jedes Detail so ungemein stark ist, dass es dem Vergessen widersteht. Der Kerzenmacher und sie hatten soeben den Tauchkorb aus dem Wachsbad gehoben, als das Adagio verklang und eine Stimme im Radio mitteilte, Hitler sei tot. Sie hatten vollkommen reglos dagestanden, während das Wachs von den Kerzen tropfte. Beim Auftreffen der Tropfen ertönte ein schwacher, weicher Laut. Sie konnte ihn noch immer hören, er glich dem Schlag eines kleinen Herzens. Als das Tropfen aufhörte, sagte der Kerzenmacher, nun ginge der Krieg zu Ende. Und es käme die Zeit, in der alle Leerräume auszufüllen wären. Jetzt, wo der schlimmste Verursacher von Leere gestorben war.
Beim Erzählen schaute Mutter die Schrankwand an, nicht mich. Ich wusste, dass sie auch mich zu ihren Leerräumen zählte. Ich war in ein neues Land verschwunden, hinein in eine neue Sprache. Für mich sei das Deutsche wie eine alte Schlangenhaut gewesen, die ich zurückgelassen hatte, stand in einem Brief von ihr, als sie noch Briefe an mich schrieb. Ich sagte Mutter, dass ich die CD mitnehmen würde. Das zu sagen war leicht, das andere zu sagen war zu schwer.

Ich setzte mich auf einen Hocker, der mit dem gleichen Nappaleder wie die Couch bezogen war. Er gehörte mir. Alles gehörte jetzt mir. Ich war das einzige Kind, die einzige Erbin all der Dinge, die Mutter hinterlassen hatte. All der Dinge, die Mutter und Vater besessen hatten, auch ihrer Erinnerungen.
Der Autor W. G. Sebald hatte einmal in einem Interview gesagt, dass man, je älter man wird, immer mehr vergisst. Dass aber das, was in Erinnerung bleibt, eine merkwürdige Verdichtung erfahre, ein spezielles, äußerst hohes Gewicht erhalte. Zuweilen könnten die Erinnerungen von solcher Schwere sein, dass sie einen in bodenlose Tiefe rissen.
Ich dachte, dass ich nun auch noch die anderen Räume betreten müsste. War aber nicht dazu imstande, konnte auch die Mappe nicht hervorholen mit der Liste all der Dinge, die nach Mutters Tod zu erledigen waren. Sie hatte sie mir bei meinem letzten Besuch gezeigt. Die Mappe lag in der untersten Schublade des Schreibschranks in einem großen Umschlag, auf dem mein Name stand. Schon damals war es mir schwergefallen, sie auch nur zu sehen.
Vielleicht, weil ich begriffen hatte, dass auch Mutter zur Leere werden wollte. So eine Leere fühlt nichts. Ich spürte, wie Weinen in mir aufstieg. Als könnte man die Leere, die die eigene Mutter hinterlässt, mit Rotz und Wasser füllen.
Vater hatte immer gesagt, man solle das tun, was ansteht. Ein Hinterbliebener habe sich um die Hinterlassenschaft des Toten zu kümmern, selbst wenn es sich nur um einen Haufen Feldsteine handelte. Am besten fängt man mit dem Schwierigsten an, dachte ich, dem Schlafzimmer, wo Mutter in ihrem großen Ehebett gelegen hat, schlaflos angesichts all der Leere, mit Vaters unbenutzter Betthälfte neben sich. Es galt, sich zusammenzureißen und die Tür zu öffnen.
Ein schwacher Lavendelduft hing im Raum. Mutter hatte Lavendelblüten getrocknet und sie jeden Herbst in kleine Stoffbeutel gefüllt. Die sie zwischen Wäsche und Kleidungsstücke stopfte. Dieser Duft hatte Vater und sie umgeben. Auch mich, als ich ein Kind war.
Das Ehebett der Eltern stand noch immer an derselben Stelle, sorgfältig bezogen, obgleich Vater seit fünf Jahren tot war. Jeden Freitag hatte Mutter die Bettwäsche gewechselt, auch Vaters, nachdem sie beider Kopfkissen und Daunendecken gelüftet hatte. Als könnte man die Leere, die Vater hinterlassen hatte, mit Daunen füllen. Nachdem alles andere saubergewischt war, hatte sie das Kruzifix abgestaubt, das über ihren Betten hing.
Es war ein großes, massives Kreuz aus dunklem Holz mit einem imposanten Bronze-Jesus, der ohnmächtig zu sein schien, was verständlich war, wenn einem jemand drei große Nägel durch den Körper gejagt hatte, zwei durch die Hände und einen durch die über Kreuz gelegten Füße. Ich habe nie begriffen, wie sein Vater das tun konnte. Wie kann man sein Kind sterben lassen, verzweifelt und einsam? Wie kann man vor dem Rufen des eigenen Kindes die Ohren verschließen? Als Allmächtiger kann man die Rettung der Menschheit doch wohl auf besserem Wege regeln. Es stimmt nicht, dass die Zeit alle Wunden heilt, ja, nicht einmal die Auferstehung.
Mir fiel ein, dass das Kruzifix jetzt mir gehörte. Wäre es wenigstens ein handliches Kreuz gewesen, wie das goldene, das Alois bei den Prozessionen trug. Alois liebte Prozessionen: das Umherziehen, das Singen und – das Beste von allem – das Segnen. Er segnete alles mit dem gleichen Enthusiasmus – die neu errichteten Häuser, die junge Saat auf den Feldern, die Blüte der Bäume. Und die Gemeinde zog singend mit, auch ich. Ich lief mit den anderen Kindern ganz vorn, die Körbe voller Blumen, die wir auf die Wege streuten. Sodass der goldene Jesus über einen Blütenteppich getragen wurde.
Ich begab mich zu der Kommode neben dem Bett. Auf einem Spitzendeckchen stand eine Vase mit Stoffblumen, daneben Porzellanfigürchen von Hummel. Mutter sammelte sie, fröhliche rotwangige Kinder, die unverdrossen Geige oder Ziehharmonika spielten oder sangen.
Ich zog die oberste Schublade auf. Der Anblick der sorgfältig gestapelten Unterwäsche, der blendend weißen BHs mit den kleinen Körbchen und der ebenso weißen Baumwollschlüpfer, gab mir das Gefühl, ich würde mich an Mutter vergehen. Auch der alles durchdringende Lavendelduft. Ich suchte nach den Beuteln und fand sie, obendrein anderes: Andachtsbildchen mit Gott und seinen Heiligen, Bildchen, die in der Kirche verteilt worden waren.
Auf einigen stand ein Datum. Sie waren aus den Fünfzigern, als ich noch ein Kind war. Eins zeigte die Madonna mit winzig kleinen Menschen, die sich wie erschrockene Küken unter ihrem Rocksaum drängten, und darunter stand eine verblüffende Textzeile: »Muttergottes, rette Deutschland und Russland.« Auf einem anderen Bild sah man einen weißbärtigen Gott mit ausgestreckten Armen auf einer Wolke stehen, fast wie ein Seiltänzer. Unter der Wolke stand: »Aus der Tiefe rufe ich zu Dir.« Ich legte das Bildchen zur Seite. Sah Mutter rufen, als sie auf der Autobahnbrücke stand und sich über das Geländer beugte, das ihr bis zur Taille reichte. Aus ihrem Mund aber kam kein Ruf, sie sagte nur leise: »Wenn ich doch nicht so feige wäre.« Es gibt Worte, die ein Kind nie vernehmen sollte, nicht einmal, wenn es bereits erwachsen geworden ist.
Ich sammelte die Bildchen ein und legte sie neben die Hummel-Figuren: Gott und seinen Sohn und den Heiligen Geist. Und Maria und die Engel. Und die furchtsamen Kükenmenschen. Alles roch nach Lavendel. Auch meine Hände.
Ich ging ins Badezimmer und wusch sie gründlich, wie vor einer Operation. Dann zog ich die Tür hinter mir zu, ließ die Wohnung zurück, wie sie gewesen war. Es gibt Augenblicke, da muss man durch die Straßen rennen.
Wer war es, der gesagt hat: Der Tod verstärkt die Kraft der Fragen, so als drehte man die Lautstärke am Radio auf, wenn die Antworten längst verklungen sind. Vielleicht aber waren die Antworten auch da, so wie die Kükenmenschen, die sich unter Marias Rock versteckten. Irgendwo, während man durch die Straßen rennt. Und die Rauchfahnen der Autowerke sich ausbreiten. Und der Ruß fällt. Wenn wenigstens Vater noch am Leben wäre und Waldhorn spielte. Ich muss mir ein Waldhorn kaufen. Und es an die Wand hängen, statt des verlassenen Sohnes, der am Kreuz ohnmächtig wird, nicht vor Schmerz, sondern vor Verzweiflung.
Auf der Insel, den 29. Dezember 2012
Es herrscht Tauwetter, nicht wie im Vorfrühling, mit Knospen an den Zweigen und Erdgeruch, sondern ein Wintertauwetter mit den nagenden Zähnen des Morastes. Und der Schnee wehrt sich, ballt sich fest zusammen und leistet Widerstand.
Lech und ich sind vor neun Monaten hergezogen. In ein altes Haus, umarmt von großen, alten Bäumen, auf einer Insel, umarmt vom weiten, schimmernden See. Darüber ein Himmel gleich einer gewölbten Hand. Und voller Schweigen. Und voll von großem Gesang. Im Frühjahr singen die Nachtigallen wie besessen. Wie in Augustenruh. Ich bin heimgekehrt.
Ich muss an einen Geistlichen denken, dem ich begegnet bin, als ich mein erstes Buch vorgestellt und etwas über einen Patienten vorgelesen habe, der sterben wollte. Der Geistliche erzählte mir von einem Gespräch, das er mit einem alten Seemann geführt hatte, der unheilbar krank im Krankenhaus lag. Der Seemann hatte gesagt, er habe jeden Halt verloren, alle Fixpunkte seien aus seinem Leben verschwunden. Vor ein paar Jahren hatte seine Frau ihren Todeskampf ausgefochten und sich an Gott festgeklammert. Und Gott hatte sich nicht aus ihrem Griff befreien können und war ebenfalls im Grab gelandet. Der Pfarrer sagte, ihm sei es nicht gelungen, die Frau oder Gott dort herauszuholen. Trotzdem hatte der Seemann nach dem Gespräch gesagt: »Jetzt sind die Falten meiner Seele geglättet.«
Wie hier auf der Insel, dachte ich. Hier ist die Seele wie ein großes schimmerndes Stück Seide ohne die geringste Falte. Ganz besonders, wenn ich mit Lech zusammen bin.
Stuttgart, den 26. November 2007
Als verwaistes Kind muss man sich wappnen, besonders, wenn man vor einem deutschen Klinkerhaus steht, an dem ein großes Schild neben dem Eingang verkündet: »Häberles Bestattungsinstitut – Leben endet, Liebe nie«. Mutter hatte sich an die Firma gewandt, als Vater gestorben war, und mit ihr vereinbart, dass sie auch ihr Begräbnis ausrichten sollte. Sie hatte mir die Übereinkunft gezeigt, bevor sie gestorben war. Sie wollte eingeäschert werden. Sie scherte sich nicht um das, was ich sagte: Denn Erde bist du, und zu Erde sollst du wieder werden. Sie wollte wie Pappelschaum lodern.
Als ich auf den Klingelknopf drückte, wurde die Tür von einem Mann geöffnet, der aussah, als hätte er sich gerade den Bierschaum von den dicken, glänzenden Lippen gewischt. Er ergriff meine Hand und sprach mir devot und routiniert sein Beileid aus. Er erinnere sich an meine Eltern, sagte er, sie seien wirklich nette Menschen gewesen, was auch immer er darüber wissen konnte. Dann führte er mich in einen Raum, der wie ein normales Büro aussah. Wenn die Glasschränke an den Wänden nicht mit Urnen vollgestanden hätten.
Ich musste an einem breiten, stabilen Schreibtisch Platz nehmen, auf einem breiten, stabilen Stuhl. Er würde seine Frau holen, sagte der Mann, die kümmere sich um die Bestellungen. Und er gab mir eine Broschüre, die ich mir in der Zwischenzeit ansehen könne. Auf dem Umschlag sah man einen schwarzen Berg, der aus einem blauen Wald ragte. Über dem Ganzen segelte eine weiße Taube, auch über der Textzeile zuunterst: »Wir sind Tag und Nacht für Sie da.«
Ich legte die Broschüre beiseite. In meiner Kindheit in Waldstadt gab es keine Tauben. Die wurden gefangen, sobald sie sich zeigten. Und nie haben die Leute aus Waldstadt sie gefangen, die Flüchtlinge waren es. Obwohl es bereits Anfang der Fünfziger war, also mehrere Jahre nach Kriegsende, kamen Monat für Monat neue Flüchtlinge an. Sie mussten in einem großen Magazingebäude wohnen, das aus irgendwelchen Gründen die Jalousie hieß. Dort lebten sie auf Matratzen in kleinen Verschlägen mit Wänden aus Kartonplatten, einem Geschenk von Vaters Chef, dem Besitzer von Pfäffles Verpackungswerken.
Auf eine Kartonplatte hatte ein Mann, der nach Mutters Worten durch irgendetwas, das er im Krieg gesehen hatte, stumm geworden war, einen Bauernhof gemalt. Er hatte ihn sorgfältig dargestellt, mit Wasserfarben, auch die Stiefel, die auf der Vortreppe standen, ein kleines Paar und zwei Paar große. Eins der großen Stiefelpaare war voller Lehm, der in Klumpen daran festklebte. Die beiden anderen Paare glänzten, das kleine ganz besonders.
Oft saß der Mann da und starrte das Bild an. Man sah ihn nie auf dem Hof beim Suppenkessel, obgleich die Flüchtlinge ihn abwechselnd bewachten. Es war ein großer, verbeulter Topf, in dem die Flüchtlinge über einem Feuer ihr Essen kochten. Manchmal schwammen Tauben in der Brühe. Ich weiß es noch genau: Sobald es brodelte, begannen die kleinen nackten Leiber zu zucken.
Mutter ging oft zur Jalousie, um jemanden zu finden, der ihre Identität bezeugen konnte. Sie hatte keine persönlichen Dokumente, die waren im Krieg verloren gegangen. Sie konnte nicht nachweisen, dass sie war, wer sie war. Und sie fragte dort alle nach ihrer Familie. Was war aus ihren Geschwistern geworden, was aus ihrer Mutter und ihrem Vater?

Eine Hand streckte sich mir entgegen, am wurstigen Finger ein goldener Ring, der für immer festzusitzen schien. Frau Häberle sah mich mit einem Blick an, der schwer von Mitgefühl war, während sie mir ihr Beileid aussprach, mit exakt denselben Worten wie ihr Mann. Dann stellte sie ihr Sortiment vor.
Sie zeigte mir die Urnen. Bei der Auswahl müsse man sorgfältig vorgehen, erklärte sie, die Urne sollte zu dem Verstorbenen passen. Sie habe das Gefühl, meine Mutter – eine nette Frau, sagte sie, jedes Mal, wenn sie sich beim Einkaufen im Fleischerladen begegnet waren, hätten sie ein paar Worte gewechselt – harmoniere besser mit den künstlerischen Urnen als mit einer einfachen schwarzen. Warum also nicht diese nehmen, auf der Picassos Friedenstaube abgebildet war, die sei ein Renner. Ich sagte nicht, dass Mutter Tauben verabscheut hatte, weil sie fand, sie verdreckten die Städte, sogar die Kirchen.
Ich wählte eine dunkelblaue Urne mit goldenen Sternen aus. Als Kind hatte ich geglaubt, die Sterne wären die Laternen der Engel, und dass man seinen Weg findet, wenn man ihnen folgt. Was Frau Häberle über die Sternenurne sagte, habe ich nicht in Erinnerung.
Dann legte sie mir die Kataloge mit den Blumengebinden vor, prächtige Kränze oder Rosenherzen, so groß, wie man sie nur haben wollte. Ein schönes Begräbnis sei schließlich eine Erinnerung fürs Leben, sagte Frau Häberle. Ich entschied mich für einen Kranz aus Rosen, die Mutters Lieblingsblumen waren, vielleicht, weil sie selbst Rose hieß.
Und Frau Häberle führte mich in der Villa herum. Statt Betten und Sofas standen in allen Räumen Särge mit geöffneten Deckeln. Auch wenn man eingeäschert werde, habe der Sarg eine Bedeutung, sagte Frau Häberle. Ich fragte nicht, welche. Vielleicht hatte sie es ja erwähnt, und ich hatte nicht zugehört. Ich dachte darüber nach, dass die Särge so ungemein groß waren. Mutters schmächtiger Körper würde darin ganz verloren aussehen. Plötzlich packte mich Schwindel. Es war, als müsste ich mich wieder auf den Boden setzen und die Arme um die Knie schlingen. Ich hielt mich an einem Sarg fest. Und sagte: »Nehmen Sie den!« Nur um da rauszukommen.
Erneut wurde ich gebeten, am Schreibtisch Platz zu nehmen. Frau Häberle schob mir ein Papier zu, das ich unterschreiben sollte. Den oberen Blattrand schmückte ein Bild: Eine rote aufgehende oder untergehende Sonne leuchtete über einem weißen Gebäude, das auf einer fruchtbaren grünen Ebene stand. Unter dem Bild in verschnörkelten Buchstaben: »Wallhall-Krematorium mit Gütesiegel«. Das sei ein Einäscherungsauftrag, erklärte sie. Es genüge nicht, dass Mutter einen Vertrag abgeschlossen habe. Ein Auftrag sei erforderlich, unterzeichnet vom Erben. Ich sagte, das brächte ich nicht fertig, Feuer wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte.

Bevor ich in die Schule kam, besuchte ich einen Kindergarten, der von katholischen Nonnen geführt wurde. Alois, der kleine rundliche Stadtpfarrer, hatte gesagt, das wäre gut für mich, vielleicht, weil er begriffen hatte, wie eigensinnig ich war. Oder es lag daran, dass Mutter, die Katholikin war, jedoch einen Protestanten geheiratet hatte, Hilfe brauchte, um mich im wahren katholischen Glauben zu erziehen.
Ich weiß nicht, ob ich den im Kindergarten gelernt habe. Was man uns dort beizubringen versuchte, war, dass Gott alles sieht, jederzeit, auch mich. Deshalb sah er auch, wenn ich abends im Bett meinen kleinen Schoß berührte, sah es mit einer Art Röntgenaugen, die durch die Decke blicken konnten. Trotzdem aber fasste ich meinen Schoß immer wieder an. Ihn anzufassen und ein wenig zu streicheln tat gut, wenn die Schatten kamen.
Manchmal riss ich aus dem Kindergarten aus. Und rannte in den Wald, zu meinem Bach. Tauchte die Füße hinein. Ich wusste, dass das Wasser des Bachs im Flüssle landete, das durch Waldstadt floss. Und dann im Neckar, der in den Rhein mündete. Und am Ende ins Meer, in Vaters Meer, das alles verschlang. Und Vaters Meer hing mit Mutters schimmernder See zusammen. Wenn ich die Füße in den Bach tauchte, hing auch ich mit allem zusammen.
Es half nichts, dass die Nonnen böse wurden, wenn ich ausriss. Sie wurden so leicht böse, obwohl sie mit Gott lebten. Zur Strafe musste ich in den Keller, eine ganze Stunde im Finstern stehen, zwischen Brennholzstapeln und Kohlevorräten. Ich aber habe nie gestanden, ich habe mich auf den Steinfußboden gesetzt und die Arme um die Knie geschlungen. Und habe ans Meer gedacht mit seinem Schimmern und an die Fische in der Tiefe des Wassers. Sie schwammen ganz friedlich umher, obwohl sie in die ewige Finsternis verbannt waren, während ich nur kurz dort auszuharren hatte.
Einmal, als ich wieder ausriss, kamen Menschen angelaufen. Alle rannten in dieselbe Richtung. Und ich rannte mit. Wir rannten zum Marktplatz, wo ein Haus in hellen Flammen stand, der Himmel war nicht mehr zu sehen, nur dicker, wirbelnder Rauch, und in einem Fenster des obersten Stockwerks stand ein Mann. Ein Mann, der schrie wie ein Tier in äußerster Not, während er versuchte, auf die Fensterbank zu klettern. Seitdem weiß ich, Schreie können auch durch das schlimmste Feuergetöse dringen, direkt hinein in deine Brust. Und noch mehr das Schweigen. Wenn dieser Mensch plötzlich verstummt und nach hinten überkippt, hinein in einen Raum, der nicht länger existiert, nur noch ein Meer ist aus lodernden Flammen. Und das Letzte, was man sieht, ein nackter Fuß im Fenster ist, ein weiß leuchtender, zuckender Fuß.
Ich erinnere mich, dass die Menschen um mich herum weinten. Und dass ich weggerannt bin zu meinem Wald. Doch auch dort gab es Füße, weiße Füße, die zuckten, einfach überall.

Ich unterschrieb den Einäscherungsauftrag. Der Namenszug wirkte seltsam, als hätte ich am ganzen Leib gezittert. Dann fragte ich Frau Häberle, ob die Toten bei der Einäscherung Strümpfe trugen. Mutter musste die besten haben, die es gab. So etwas ist eher ungewöhnlich, sagte Frau Häberle mit ihrem Leben-endet-Liebe-nie-Gesicht, das sich durch nichts aus der Fassung bringen ließ. Mutter muss jedenfalls Strümpfe tragen, sagte ich, und dass ich sie kaufen und dort abgeben würde.
Dann ging ich, ausgestattet mit Kopien des Einäscherungsauftrages und meiner Bestellungen. Vor dem Haus gab es einen kleinen Teich, in dem zwei Goldfische schwammen, beharrlich immer im Kreis, als gäbe es einen Ausweg.
Als ich wieder im Hotelzimmer war, rief ich Lech an. Ich sagte, ich wolle mit ihm nach Dresden fahren. Er fragte nicht, warum, nur wann. Nach Mutters Beerdigung, sagte ich. Und fügte hinzu: »Für dich würde ich durchs Feuer gehen.« Ich sagte es ohne jedes Zögern.