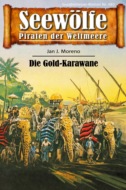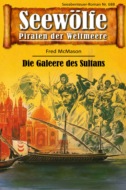Buch lesen: "Seewölfe - Piraten der Weltmeere 689"
Impressum
© 1976/2020 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
ISBN: 978-3-96688-103-6
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
Sean Beaufort
Die Diebeskaravelle
Gibt es die letzte Chance für die angeketteten Arwenacks?
Der Haß tobte in seinem Inneren. Bilalama hob die Arme: Die Ketten rasselten laut.
„Ich bringe dich um, Istaran!“ keuchte er in hilflosem Zorn. „Du und ich, auf einem Schiff. Ich erwürge dich mit dieser verfluchten Kette.“
Istaran hörte es nicht. Er war eben den Niedergang abgeentert, blinzelte und versuchte, im Halbdunkel des stinkenden Decks die Galeerensträflinge zu erkennen.
Er blickte zwar in Bilalamas Richtung, aber seine Augen suchten die Fremden, die Männer der Schebecke, die das Gold leichtfertig dem Falschen übergeben hatten.
Als er sich umdrehte, hörte er den Fluch und den gekrächzten Schrei: „Für alles wirst du bezahlen, Istaran! Sei verflucht, du Sohn einer Hündin!“
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Die Hauptpersonen des Romans:
Luis de Xira – der Kapitän der portugiesischen Karavelle „Cabo Mondego“ glaubt, mit den „Turbanaffen“ leichtes Spiel zu haben.
Sultan von Golkonda – verfolgt die „Cabo Mondego“ und braucht die Hilfe der Arwenacks.
Bilalama – ist von Rachedurst erfüllt, denn er fiel einer Intrige zum Opfer und muß jetzt als Rudersklave dienen.
Istaran Nawab – hat gegen Bilalama intrigiert und zittert jetzt um sein Leben.
Philip Hasard Killigrew – findet endlich eine Möglichkeit für seine Arwenacks und sich, vom Frondienst als Rudersklaven befreit zu werden.
1.
Kapitän Philip Hasard Killigrew hatte längst aufgehört, bei jeder Anstrengung leise oder laut zu fluchen. Aber weder er noch der Rest seiner Crew hatten sich mit ihrer kläglichen Rolle abgefunden – als angekettete Rudersklaven, ausgerechnet auf einer Galeere türkischen Ursprungs.
„Shastri, ich kriege dich“, flüsterte Hasard, spannte wieder seine Muskeln und zog das Griffende des schweren Riemens durch.
Der ausgemergelte Inder neben ihm hing schweißüberströmt über dem Riemenschaft und führte nur noch schwach die Bewegungen aus. Dudu, so nannte er sich, war völlig erschöpft, aber in den vergangenen Stunden hatte er getan, was er konnte.
Seit drei Stunden, schätzte Hasard heulte der Morgenwind in der Takelage. Wellen türmten sich auf. Im Deck der Ruderer klirrten die Ketten. Ununterbrochen knirschten Holz, Leder und nasses Tauwerk.
„Dieser verdammte Hund“, sagte der Seewolf nach einiger Zeit. „Ihm haben wir dieses schöne Geschenk zu verdanken.“
Bis auf Clinton, den Moses, Big Old Shane, den Segelmacher Will Thorne, Old Donegal O’Flynn und Mac Pellew war die gesamte Crew, wie auch er selbst, an die Ruderbänke gekettet.
Hasard hatte Sichtkontakt zu fast einem Drittel seiner Leute. Die erste Nacht war vorüber. Fast pausenlos hatten die Gefangenen unter Deck gepullt. Jetzt hatte der Wind aufgefrischt, und wahrscheinlich würden die schuftenden Gefangenen endlich eine Pause einlegen können. Hasards Wut war beträchtlich, aber er hatte sich seinen Zorn sozusagen von der Seele gepullt. Jetzt dachte er nur noch daran, wie sie sich befreien konnten.
Seit etwa vier Stunden war es tageshell.
Das Licht sickerte, zusammen mit frischer Luft, durch längliche, schmale Luken über ihnen. Unablässig bewegten sich knirschend die unterarmdicken Riemen. Immerhin wurden die unfreiwilligen Galeerensträflinge von den Leuten des Sultans einigermaßen rücksichtsvoll und anständig behandelt. Sie hatten genug zu trinken empfangen, und auch das Essen war gar nicht übel gewesen. Die schmalbrüstigen Inder, die neben den Seewölfen angekettet waren, wunderten sich noch jetzt über die ungewöhnliche Behandlung.
Die angeblich bessere Behandlung war nicht mehr als eine schäbige Entschädigung, das dachten alle Seewölfe.
Auch die Inder, die man wegen aller denkbaren Verfehlungen und Verbrechen auf die Duchten verbannt hatte, waren erschöpft. Der Seewolf schätzte, daß das erbarmungslose Pullen und der Wind die „Stern von Indien“ weit nach Nordnordosten gebracht hatten.
Eine Reihe hinter Hasard ächzte Ben Brighton, der Erste. Seine Stimme war heiser vor Müdigkeit und Wut.
„Sir? Wie zeigen wir’s den indischen Teufeln?“
Hasard blickte über die Schulter und erwiderte mürrisch: „Keine Ahnung, Ben. Ich zermartere mir den Kopf. Mir fällt nichts ein.“
Sie brauchten nicht zu befürchten, daß jemand in diesem Deck ihren Cornwall-Dialekt verstand.
„Die mageren Kerle hier sehen auch nicht gerade so aus, als würden sie sich mit Gebrüll auf ihre Peiniger stürzen!“ rief der Profos von einer der hinteren Bänke.
„Die sind halbtot“, erklärte Higgy sachlich.
Don Juan schien seine gute Laune zeitweilig wiedergefunden zu haben, denn er rief: „Vor Angst und Müdigkeit, Señores!“
Über ihnen, an Deck, polterten Schritte. Stimmen wurden laut, unverständliche Worte waren zu hören. Dann schrie der Taktschläger einige Befehle. Die Riemen gelangten zum Stillstand und wurden langsam eingezogen. Die Geschwindigkeit der Galeere nahm nicht ab, der Wind war kräftig genug geworden.
„Die Ketten sind nicht aufzubrechen“, sagte Ferris Tucker. „Jedenfalls nicht mit bloßen Händen.“
„Und anderes Werkzeug haben wir nicht“, antwortete ihm mißmutig Jack Finnegan.
„Abwarten“, meinte Batuti und wischte sich den Schweiß von den Schultern. „Wir haben es noch immer geschafft.“
„Diesmal sieht es besonders schlimm aus“, sagte Dan O’Flynn.
Jeder von ihnen hatte seit den ersten Minuten ihrer Gefangenschaft immer wieder überlegt, was sie tun konnten, um sich von den Ketten zu befreien. Aber die Bewacher würden schon die ersten Versuche vereiteln.
„Endlich gibt’s Tee und Rum!“ Roger Brighton versuchte einen grimmigen Scherz, als die indischen Seeleute mit kleinen Tonnen und langstieligen Kellen auftauchten. Die Ruderer erhielten ihre erste Wasserration.
„Die ‚Stern‘ geht nach Nordnordost“, erklärte Dan O’Flynn nach einer Weile. Er hatte einen Ärmel seines Hemdes mit dem Frischwasser durchnäßt und sich flüchtig Gesicht und Brust gesäubert. Vor den Luken zog die Küstenlandschaft hinter der Brandungswelle vorbei. Die Sonne stand an Steuerbord.
„Klar, der Sultan will seinen Vetter schnappen, ehe der sich mit dem Gold davonstehlen kann“, sagte Matt Davies. „Aber das alles haben wir schon zehnmal durchgekaut.“
„Richtig. Hat auch nichts gebracht“, stimmte Al Conroy zu.
Die „Stern von Indien“ bohrte ihren Rammsporn in die Bugwellen und wurde mit größtmöglicher Geschwindigkeit nach Norden, auf Madras zugesegelt. Die Crew der Seewölfe war auf beide Ruderdecks verteilt worden. Die meisten Arwenacks befanden sich auf dem Deck, in dem auch der Seewolf angekettet war. Die Spuren der Schlägerei waren vergessen, es gab nur noch unwesentliche Schmerzen und Prellungen.
Der richtige Sultan von Golkonda vermutete, daß Shastris Bande versuchen wollte, das Gold auf dem Landweg wegzuschaffen und nach Gudur zu bringen. Die schnelle Fahrt der „Stern von Indien“ hatte bisher dicht unter Land nach Norden geführt, und darin würde sich in den nächsten Stunden nichts ändern. Schweigend und müde schlangen die Gefangenen und ihre indischen Leidensgenossen das kalte Essen und den warmen Brei herunter.
„Was bleibt uns übrig?“ fragte Ferris Tucker laut.
„Abwarten und die beste Gelegenheit abpassen“, erwiderte Hasard. „Wir kriegen unsere Chance, früher oder später.“
„Wahrscheinlich später. Oder viel zu spät“, sagte Don Juan. „Ich habe schon einen Splint halbwegs gelockert.“
„Laß dich ja nicht erwischen, Juan“, warnte der Seewolf halblaut.
„Ganz sicher nicht. Auch mein Nachbar, dem mein Mitleid gilt, hat nichts bemerkt.“
Das Selbstbewußtsein des Spaniers schien unerschütterlich zu sein. Er wirkte geradezu herausfordernd fröhlich.
„Mitleid“, sagte Hasard und zuckte mit den Schultern. „Wahrscheinlich sind es Mörder, Diebe und Halsabschneider, die zu Recht an den Riemen sitzen müssen, bis der Tod sie erlöst.“
„Wenn wir nicht bald den falschen Sultan finden, kann uns das ebenfalls blühen“, murmelte Higgy.
„Jedenfalls schuften wir weiter“, sagte der Seewolf grimmig.
An vielen Stellen unter Deck waren noch die Spuren der früheren Pracht zu erkennen. Offensichtlich war die „Stern von Indien“ von geschickten Handwerkern zusammengesetzt worden. Der ehemalige Glanz und der Prunk waren hier unten verblichen, dafür nisteten überall Schmutz und Salzkristalle. Aus der Bilge stank es, die Duchten und Grätings waren abgetreten, voller Risse und an vielen Stellen besudelt.
Aber die Seeleute, die Aufseher und das Gefolge des Sultans trugen saubere Kleidung und wirkten sehr gepflegt. Einige trugen auffälligen Schmuck, die meisten waren gut und ausreichend bewaffnet. Sie sahen so aus, als wüßten sie ihre Waffen richtig einzusetzen.
Die Wellen schlugen klatschend und dröhnend gegen die Planken. Die harten Schläge hallten durch den Schiffskörper. Jedesmal, wenn sich der scharfe Rammsporn aus dem Wasser hob, ertönte ein langgezogenes Zischen.
Hasard junior hatte seine Arme über das Griffende des Riemens gehängt und entspannte seine verkrampften Muskeln.
Er schlief nicht, aber er döste mit halbgeöffneten Augen. Sein Blick heftete sich auf Bilalama, der zwischen ihm und Philip junior saß. Die Ketten klirrten leise bei jeder Bewegung des Schiffes.
„Lohnt sich nicht, zu schlafen. Wir müssen gleich wieder schuften“, sagte der junge Inder halblaut.
„Stimmt. Ich versuch’s trotzdem“, entgegnete Hasard. „Auch wenn’s nicht viel hilft.“
Bilalama sah aus, als habe er schon bessere Tage gesehen. Er sprach ein klar verständliches, erstklassiges Hindi. Beide Seewölfe hatten keine Schwierigkeiten, ihn zu verstehen, obwohl ihr Wortschatz noch lange nicht für eine richtige Unterhaltung ausreichte.
„Was hat dich hierher verschlagen?“ erkundigte sich Philip junior und stieß den Mann mit dem nackenlangen, fast blauschwarz schimmernden Haar und den Bartstoppeln an.
„Dort oben an Deck spaziert er herum. Istaran, der Leibwächter des Sultans. Er hat die Schuld an meinem Unglück, schätze ich.“
„Wieder mal ein Unschuldiger an den Riemen, so wie wir“, sagte Hasard und grinste.
„Ihr und ich: Wir sind unschuldig. Eine lange, böse Geschichte“, sagte Bilalama.
„Wir haben Zeit“, antwortete Philip junior. „Erzähl’s uns.“
Etwa ein Drittel der Seewölfecrew befand sich auf diesem Ruderdeck, also nicht bei den Männern um ihren Vater. Bis auf wenige Ausnahmen schienen die angeketteten Inder arme Teufel zu sein, ausgemergelte, verschwitzte Männer mit verfilztem Haar und den frischen Striemen von Peitschenhieben. Ihre Gesichter, von Bärten überwuchert und seit langer Zeit nicht mehr gewaschen, waren verschlagen und bösartig.
Bilalama wirkte hingegen wie ein Mann von hervorragender Ausbildung und guten Umgangsformen, verglichen mit dem Rest seiner Landsleute in der halben Dunkelheit des Decks.
„Wir haben zusammen im Palast gearbeitet“, sagte Bilalama halblaut.
In der kurzen Pause hatten es die meisten Ruderer dieses Decks geschafft, in tiefen Schlaf zu fallen. Die schweren Atemzüge und das rauhe Schnarchen übertönten für kurze Zeit die Geräusche der Wellen und das Knarren der Planken und Verbände.
„Du und dieser Istaran?“ fragte Hasard junior schläfrig.
„Ja. Er als Anführer der Palastwachen. Ich führte die Reiter des Sultans an. Und ich war für die Elefanten verantwortlich.“
Philip und Hasard nickten verständnisvoll. Sie ahnten, wie die Geschichte weitergehen würde.
„Istaran wollte mehr Macht, mehr Geld und deinen Posten, nicht wahr?“ fragte Hasard und gähnte.
„Du hast recht. Woher weißt du …?“ fragte Bilalama und riß die Augen auf.
„Die alte Geschichte. Immer das gleiche“, sagte Hasard. Die Anstrengungen des vergangenen Tages und der Nacht waren an allen Stellen seines Körpers spürbar. „Und schließlich kriegte er, was er wollte.“
„Sonst wärst du nicht hier, Bila“, ergänzte der Zwillingsbruder leise.
Jeder einzelne Mann der Crew war voller schwarzer Gedanken. Es bestand wahrscheinlich noch keine Gefahr für ihr Leben, sagten sie sich, aber die Lage war schlimmer als hoffnungslos. Die Gefahr, daß der falsche Sultan mit dem echten Gold längst über alle indischen Berge war, bestand unverändert.
Die fünf Mann, die als kümmerliche Wache die Schebecke hüteten, würden ebensowenig ausrichten können wie ein einzelner Seewolf, dem es gelang, seine Ketten zu lockern. Schon der Versuch, zusammen mit den anderen Galeerensträflingen einen Aufstand, eine erfolgsversprechende Meuterei anzufangen, war selbstmörderisch und daher sinnlos.
„Istaran hat viele Männer bestochen. Mit dem Gold unseres Herrn. Sie sagten gegen mich aus“, berichtete Bilalama weiter. Während er erzählte, blitzten seine Augen, und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. „Ich wurde, obwohl ich meine Arbeit gut ausführte, zum Schurken abgestempelt. Alle Beweise sprachen gegen mich. Ein unheimlich schlauer Kerl, dieser Istaran, bei allen kalten und heißen Höllen.“
„Schließlich erfuhr der Sultan von Golkonda von deinen angeblichen Schurkereien?“ fragte Hasard schläfrig. Er sehnte sich nach einem langen heißen Bad, einem Becher Wein und einem traumlosen, tiefen Schlaf.
„Ja. Er war rasend vor Zorn. Ich konnte sagen, was ich wollte, es half nichts. Niemand glaubte mir mehr. Die Zeugen logen schamlos. Ich wurde festgenommen, alle Ämter verlor ich, mein Häuschen, meine Frau rannte davon. Niemand weiß, wo sie ist. Dann brachte man mich hierher, und seitdem rudere ich dieses verfluchte Schiff.“
„Es wird dir kein Trost sein“, bemerkte Philip und überlegte, wie die Seewölfe den berechtigten Haß Bilalamas auf Istaran ausnutzen könnten. „Wie du siehst, bist du nicht allein. Wir haben ähnliche Gefühle, was deinen Herrn, den Sultan, betrifft.“
„Nutzt uns das?“ grollte Bilalama und zog die Schultern hoch. Auch ihn beherrschten die Lebensangst und die Aussicht, elend auf der rissigen, harten Holzducht zu enden, zwischen den stinkenden Grätings und inmitten von verwahrlosten Indern, die wegen wirklicher Untaten hier angekettet waren.
„Wir sollten anfangen“, sagte Hasard junior, „darüber nachzudenken, wie wir unsere Freiheit wieder gewinnen können. Mit List, mit Gewalt, auf jeden Fall mit Erfolg. Hilfst du uns, dann helfen wir dir wegen Istaran.“
„Einverstanden“, antwortete der Inder. „Ich denke an den falschen Sultan, an Drawida Shastri. Wenn wir ihn finden, gibt es Kampf.“
„Wenn es Kampf gibt, gibt es ein Durcheinander“, versicherte Philip im Tonfall eines Mannes, der darüber genau Bescheid weiß.
„Und eine solche Wuhling kann uns nur helfen“, murmelte Hasard, bevor er endgültig in einen kurzen, abgrundtiefen Schlaf sackte. „Aber nur dann, wenn wir einen guten Plan haben.“
Die Antwort seines Bruders hörte er nicht mehr.
Philip junior sagte: „Einen Plan, der durchführbar ist. Schließlich sind zweieinhalb Dutzend Arwenacks an Bord.“
Bilalamas Gesicht drückte einen ersten, vorsichtigen Hoffnungsschimmer aus, als er sich vornüber sinken ließ und ebenfalls die Pause ausnutzte, um sich ein wenig zu erholen.
Die Küste nördlich der Hafenstadt Madras war niedrig und fast ausnahmslos von Wald bedeckt. Dan O’Flynn hatte erfahren, daß sich hinter der Brandung und der sandigen Küstenlinie riesige Binnengewässer ausdehnten, die aber nur von Booten mit wenig Tiefgang befahren werden konnten.
Die Luft in diesem Seegebiet war unverhältnismäßig heiß. Unter Deck herrschte tagsüber feuchte Hitze, verbunden mit einem ekelerregenden Gestank, den der Wind, der aus Südsüdwesten wehte, nicht vertreiben konnte.
Hin und wieder prasselten aus den tief treibenden Gewitterwolken schwere Regengüsse auf die „Stern von Indien“ nieder. Süßwasser lief dampfend über die Stufen der Niedergänge hinunter, wusch einen Teil des Drecks weg und versickerte zwischen den aufquellenden Kanthölzern auf dem Weg in die stinkende Bilge.
Die Dünung hob und senkte den langgezogenen Rumpf. Kräftige Böen trieben die „Stern“ durch die Wellen. In dieser Jahreszeit drohten zu allem Überfluß auch noch Wirbelstürme. Auch die Strömung führte nach Norden und verlieh dem Schiff eine beträchtliche Geschwindigkeit.
Die wenigen Landmarken, die Dan O’Flynn von seinem Platz aus erkennen konnte – die Sterne hatte er seit rund zwei Nächten nicht mehr gesehen –, schienen ihm zu beweisen, daß die „Stern“ nördlich von Madras in etwa sieben Seemeilen Abstand von der Küste segelte.
Oft war der Blick auf die Küstenlinie durch Dunst versperrt. Zwischen dem Schiff und der ufernahen Brandung schien es viele Untiefen zu geben, denn auch dort stand starke Brandung. Die Inder vor ihm, hinter ihm und auch seine braunhäutigen Nachbarn hatten einige Namen gemurmelt. Es mochten Bezeichnungen von Orten oder von Buchten sein, die Dan aber nicht sehen konnte: Pulicat, Armagon und Kottapatnam.
Auch Dan O’Flynn fieberte dem Augenblick entgegen, an dem sich die Lage ändern würde. Er hoffte wie jeder der Seewölfe, daß sie dann ihre Chance haben würden.
Bis zu diesem Zeitpunkt beschäftigte er sich weiterhin unablässig mit verschiedenen Plänen, die entweder nichts taugten oder nur beim Zusammentreffen vieler günstiger Umstände zum Erfolg führen konnten. Nichts schien sicher.
Lautlos, aber in steigender Wut und Verbitterung verfluchte er die Koromandelküste.
Schließlich ließ sich auch Dan O’Flynn zur Seite kippen, lehnte sich halb gegen den Ruderschaft und halb an die Schulter eines Inders, der regungslos wie ein Toter schlief.
Spätestens dann, wenn die Brise sich abschwächte, würden die Seeleute des Sultans wieder peitschenschwingend und schreiend die eingeschlafenen Männer an die schweißtreibende Arbeit zwingen.
2.
Die unzähligen Geräusche, die vor dem Beginn der Dunkelheit den Wald erfüllten, waren für Kokoka wie das beruhigende Summen von emsigen Bienen. Nichts anderes half ihm, tief zu schlafen und nicht ängstlich auf den Angriff eines Raubtiers zu warten. Je gleichmäßiger dieses Summen und Kreischen, die vielen Schreie und das leise Zwitschern nachtjagender Vögel in seinen Ohren klangen, desto sicherer war er selbst.
Kokoka langte nach einer Liane, bog sie zur Seite und führte mit dem unterarmlangen Haumesser einen schnellen Schnitt durch das weiche Holz. Er hielt den weit geöffneten Mund in den dünnen Wasserstrahl und trank. Das Wasser war herrlich kühl und schmeckte nach frischen Pilzen.
Kokoka wartete, bis sich das Innere der Liane geleert hatte. Er lehnte ruhig am moosbedeckten Stamm eines Baumriesen und betrachtete prüfend seine ledernen Säcke und die Netze mit den feinen Maschen. Erst die Hälfte war prall gefüllt. Er mußte noch viele Fallen stellen, noch lange war seine Jagd nicht beendet.
Diesmal würde er nicht für wenig Geld seine Beute hergeben müssen. Er hatte einen Auftrag und die Zusicherung, daß ihm alle seine Federn für viele schöne Rupien abgekauft werden würden.
Das Sonnenlicht fiel in breiten, schrägen Balken durch die Lücken der Baumkronen. Kokoka schulterte die Kalebasse, packte seine Säcke und Netze und schob sich weiter über einen kaum sichtbaren Pfad, den Dschungeltiere getreten hatten. Er wußte, daß fast jeder dieser Pfade zu einer Wasserstelle führte, und dort gab es auch meist eine Lichtung, an deren Rand der Jäger übernachten und seine Fallen aufstellen konnte.
„Für heute brauche ich nichts mehr zu tun“, murmelte er und sprang über einen modernden Baumstamm.
Hoch über ihm ertönte wieder das Geräusch des Nath-Vogels. Es war ein metallisches Geräusch, als ob jemand mit einem spitzen Messer gegen einen Messinggong hämmerte.
„Gutes Zeichen“, sagte Kokoka, während er sich zwischen den riesigen Stämmen und dem dichten Buschwerk hindurchwand und den Kopf hob. Er glaubte, das Wasser eines Tümpels oder eines Flüßchens zu riechen. An seinem breiten Gürtel hingen die ausgenommenen Körper von etwa zehn Vögeln, die er im Lauf der letzten Stunden gefangen und mit größter Sorgfalt gerupft hatte. „Keine Tiger in der Nähe.“
Langsam trottete er nach Osten. Hinter ihm sank die Sonne tiefer und färbte sich rot. Sriharikotra war das Ziel von Kokokas langer Wanderung. Dort erwartete ihn der Aufkäufer für den Hof des Mogulkaisers.
Der Pfad wurde breiter, dort, wo zwei weitere Tierspuren, tief im feuchten Boden eingetreten, von links und rechts aus dem Dickicht heranführten und mit dem Morast verschmolzen. Kokoka versank bis über die Knöchel, als er so leise wie möglich weiterging. In anderen Teilen des Küstenwaldes, weiter nördlich, waren es die Elefanten, die breite Pfade durch das Gebüsch bahnten. Hier hatte Kokoka noch nie Spuren dieser großen Dickhäuter gesehen.
„Schneller, Koko“, sagte er zu sich selbst. „Du mußt noch ein Feuer in Gang bringen.“
Kokoka, ein sehniger, schlanker Mann, vierundzwanzig Jahre alt, war in der Binnensteppe und im Wald aufgewachsen. Auch sein Vater war Jäger gewesen. Eine Schlange hatte ihn vor zwei Jahren getötet. Seit diesem Tag trug Kokoka lederne Stiefel, die bis unter die Knie reichten.
Er hörte nach weiteren dreißig Schritten das leise Plätschern und Rauschen von Wasser, und als er eine Reihe flacher Steine fand, folgte er dieser natürlichen Treppe und sah im letzten Licht des Tages eine kleine Lichtung, durch die ein Bach schäumte.
„Sehr gut“, sagte er zufrieden.
Rechts von seinem Standort gab es einen grasbewachsenen Vorsprung. Kokoka ging hinüber und suchte nach Spuren. Kein Tier hatte diesen Platz aufgesucht, jedenfalls kein größeres, das ihm gefährlich werden konnte. Er setzte seine Lasten ab, zog das Haumesser aus dem Gürtel und schnitt in das Gras einen großen Kreis. In dessen Mitte schob er das Gras zusammen und lief ein paarmal um die freie Fläche herum. Seine Schritte und die Schläge der Waffe sollten die Schlangen vertreiben.
Kokoka schichtete seine Bündel zu einem Windwall, rollte die Decke aus und holte aus dem Lederbeutel Zunder und Feuerstein. Mit einem Ruck löste er den Knoten des Holzbündels, das er seit Mittag mit sich schleppte. Er schlug Funken, entzündete den Schwamm, blies darauf, und die trockenen Grashalme fingen zuerst Feuer.
Einige Atemzüge später hatte der Vogeljäger eine winzige Pyramide aus Blättern, Gras und dünnem Holz aufgeschichtet. Kleine Flammen züngelten in die Höhe, ein dünner Rauchfaden kräuselte sich. Kokoka betrachtete seine schlammbedeckten Stiefel, zog die Rinde von einem langen, geraden Ast und spießte sorgfältig die Vogelkörper auf. Aus zwei anderen Ästen schnitzte er, während sich über ihm der Himmel dunkel färbte, zwei Gabeln.
„Wird eine gute Nacht werden“, murmelte der Jäger.
Als das Feuer zuverlässig brannte, rückte er seine Beute in die Nähe der Hitze und huschte fast lautlos hinunter zum Bach, um seine Stiefel zu reinigen. Sein Schatten tanzte über die dunkle Mauer aus Buschwerk und Lianen auf der anderen Seite des Baches.
Sorgfältig beobachtete der Jäger die Umgebung. Die vielen Laute aus den Baumkronen und dem schwer zu durchdringenden Buschwerk klangen jetzt, als das Tageslicht endgültig geschwunden war, ganz anders. Aber Kokoka konnte keine Anzeichen von Warnrufen oder Aufregung heraushören.
Er ging zurück zum Feuer, setzte die beiden Astgabeln um und streute etwas von dem kostbaren Salz über die heißen Fleischstücke, aus denen zischend einzelne Fetttropfen fielen.
Er setzte sich auf die Decke, lehnte sich gegen die Ledersäcke und steckte das Messer und das Haumesser griffbereit neben sich in den Boden. Die ersten Sterne wurden im Ausschnitt zwischen den Wipfeln sichtbar. Große Vögel huschten, fast unhörbar, über dem Bachlauf dahin. Grillen und Käfer zirpten in den Gräsern, die Frösche fingen mit ihrem Lärm an. Von den bratenden Vogelkörpern drang ein Geruch heran, der dem Jäger das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ.
Kokoka knotete das Tuch aus dem langen Haar, warf es zur Seite und band sein Haar, nachdem er es mit dem hölzernen Kamm sorgfältig durchgestriegelt und von Insekten, Blattresten und Schmutz gesäubert hatte, im Nacken zu einem Knoten zusammen. Als er nach seinem hölzernen Bratspieß griff und ihn zu drehen versuchte, erstarrte er.
Aus dem Wald ertönte ein langes, wütendes Trompeten. Ein unverkennbarer Laut.
„Elefanten“, flüsterte er und hielt den Atem an. Er konnte keinen zweiten Schrei hören und drehte den Spieß über der roten Glut am Rand der Flammen.
Kokoka zuckte mit den Schultern. Was in dieser verlassenen Gegend ein Elefant zu suchen hatte, wußte er nicht. Flüchtig dachte er an eine Karawane oder an Holzfäller. Der Schrei war von weither erklungen, aber mühelos durchdrang er sämtliche anderen Geräusche der Nacht.
Wo Elefanten waren, nahmen die anderen Tiere meist Reißaus. Selbst der hungrige Tiger fürchtete den Elefanten. Kokoka nahm noch einmal eine Prise Salz, streute sie über die braune Kruste der Fleischstücke und verschloß den Beutel mit großer Sorgfalt.
Er wartete geduldig, bis die Vogelkörper von allen Seiten knusprig gebraten waren, dann hob er den hölzernen Spieß aus der Hitze, ließ das Fleisch abkühlen und fing zu essen an. Aber unablässig lauschte er nach einem verräterischen Knacken oder nach Tierschreien, die ihn warnten.
Er konnte, ohne daß er unterbrochen wurde, in Ruhe seine Beute verzehren. Schließlich, nach mehr als einer Stunde, als das Feuer heruntergebrannt war und nur noch als grellroter Glutkreis leuchtete, ging der Jäger wieder zum Wasser, trank in Ruhe, wusch sein Haar und den Körper und rieb den Schmutz mit feinem Sand von der Haut. Er wickelte sich halb in die Decke, schob die Glut zusammen und achtete darauf, daß sie sich nicht weiterfressen konnte.
Unter einem weit herausragenden dicken Ast, zwischen seiner Beute an Federn und Vogelbälgen, fühlte er sich sicher und schlief ein. Vor seinen Füßen färbte sich die rote Glut, bis sie nur noch ein schlackenhaftes schwarzrotes Häufchen war, ein schläfriges Auge, das ihn zu bewachen schien.
Plötzlich war er hellwach.
Er richtete sich blitzschnell auf, packte den Griff des Haumessers und schlug mit der Stirn gegen den Ast. Er blinzelte. Das Feuer strahlte zwar noch Wärme aus, aber eine dicke Ascheschicht bedeckte den winzigen Rest der Glut.
Der Mond hatte sich über den Rand des Waldes geschoben, hing über den Wipfeln und strahlte in den schmalen Einschnitt der Lichtung. Die Frösche hatten mit ihrer nächtlichen Musik aufgehört. Mit angehaltenem Atem lauschte der Vogeljäger.
Als der nächste, kurze Schrei durch den Dschungel hallte und die Tiere aufschreckte, wußte der Jäger, was ihn eben geweckt hatte. Jetzt hörte er auch das Brechen von Ästen.
„Bei der schwarzen Kali“, sagte er verwundert. „Es sind doch Elefanten hier.“
Er war gut versteckt. Er kauerte sich im Schutz der Dunkelheit unter dem Ast zusammen und wartete.
Hier, weit entfernt von jeder Ansiedlung, mehr als zwei lange Tagesmärsche vom Meer entfernt, schoben sich einige der großen Tiere durch den Wald. Kokoka hatte keinen Zweifel daran, daß sich eine Herde Elefanten auf sein Versteck zubewegte, und zwar aus der Richtung, aus der auch das Wasser des Baches floß.
Die Tiere setzten ihre Sohlen leise auf, aber ihre Körper schoben Äste und Buschwerk zur Seite. Für eine Weile trompetete keiner der sich nähernden Elefanten mehr, aber das Plätschern des Wassers wurde lauter, und schließlich tauchte zwischen den Baumstämmen das flackernde Licht einer Fackel auf.
„Es wird aufregend, Kokoka“, sagte er im Selbstgespräch und duckte sich noch tiefer in den Schutz seines Versteckes.
Das Mondlicht strahlte auf die Gräser entlang der Bachufer und auf die kleinen Wellen. Das Licht wurde heller. Kokoka unterschied mehrere Männer und die Körper von zwei erwachsenen Tieren. Jetzt waren sie einen guten Bogenschuß weit entfernt und folgten dem Wasserlauf. Eine zweite Fackel wurde sichtbar.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.