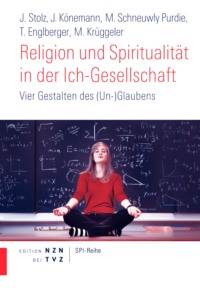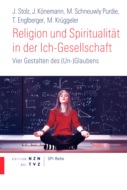Buch lesen: "Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft"
Jörg Stolz, Judith Könemann,
Mallory Schneuwly Purdie,
Thomas Englberger, Michael Krüggeler
Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft
Vier Gestalten des (Un-)Glaubens

Beiträge zur Pastoralsoziologie (SPI-Reihe) 16
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlaggestaltung: Simone Ackermann, Zürich
Titelbild: Jean-Charles Rochat
Satz und Layout: Claudia Wild, Konstanz
ISBN 978-3-290-20078-7 (Buch)
ISBN 978-3-290-20112-8 (E-Book)
|XX| Seitenzahlen des E-Books verweisen auf den Beginn der jeweiligen Seite der gedruckten Ausgabe.
© 2014 Theologischer Verlag Zürich
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotografischen und audiovisuellen Wiedergabe, der elektronischen Erfassung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten. |5|
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Zentrale Fragestellung
1.2 Bisherige Antworten
1.3 Eine neue Typologie
1.4 Eine neue Theorie
1.5 Die These des Regimewechsels religiös-säkularer Konkurrenz
1.6 Methode12
1.7 Was ist neu?
1.8 Grenzen und eigene Position
1.9 Darstellung und Plan des Buches
2 Theorie: Religiös-säkulare Konkurrenz in der Ich-Gesellschaft 2.1 Theorien zu Religion und Moderne
Säkularisierungstheorie
Theorie der Individualisierung und spirituellen Revolution
Markttheorie
2.2 Die allgemeine Theorie religiös-säkularer Konkurrenz Vorbemerkungen
Vorläufer der Theorie
Analytische Soziologie
Religion, religiöse Organisationen, Religiosität
Definitionen
Die sich wandelnde Vorteilhaftigkeit von Religion
Soziale Konkurrenz
Religiöse und säkulare Anbieter und kollektive Akteure
Ressourcen und Machtverteilungen
Strategien
Individuelles Handeln
Externe Einflussfaktoren
Effekte des Konkurrenzgeschehens
2.3 Sozio-historische Konkretisierung
Religiös-säkulare Konkurrenz in der industriellen Gesellschaft
Der Wechsel des Konkurrenzregimes der 1960er Jahre
Religiös-säkulare Konkurrenz in der Ich-Gesellschaft
Konkurrenzbeziehungen
2.4 Hypothesen
Übergang zur Ich-Gesellschaft
Individuelle Anpassungen
Grossgruppen
Anbieter
3 Vier Gestalten des (Un-)Glaubens
3.1 Eine Typologie auf zwei Ebenen
3.2 Institutionelle
3.3 Alternative
3.4 Distanzierte
3.5 Säkulare
4 Identität und Sozialstruktur 4.1 Typen, Subtypen und Identität
Identität – kategorial, kollektiv, personal
Konfessionelle Identität
Religiös-spirituelle und säkulare Identität
Positiv- und Negativbeschreibungen: Ich/Wir vs. die Anderen
4.2 Soziodemografische Merkmale der Typen
Der institutionelle Typus: Etablierte und Freikirchliche
Der alternative Typus: Esoterische und Sheilaisten/alternative Kunden
Der distanzierte Typus
Der säkulare Typus: Indifferente und Religionsgegner
5 Glauben, Wissen, Erfahren, Handeln 5.1 Institutionelle Religiosität
Etablierte
Freikirchliche
5.2 Alternative Spiritualität
Esoteriker
Sheilaisten und alternative Kunden
5.3 Distanzierte Religiosität
Distanziert-Institutionelle
Distanziert-Alternative
Distanziert-Säkulare
5.4 Säkularität
Indifferente
Religionsgegner
6 Werte und Wertewandel 6.1 Die Typen und ihre Werte
Institutionelle
Alternative
Distanzierte
Säkulare
6.2 Wertewandel und Religiosität
Wie Religion an «Wert» und Legitimationsfunktion verliert
Die Kritik an «alten» Werten und deren Verbindung zur Religion
Die Freisetzung «neuer» Werte |6|
7 Kirchen, Freikirchen und alternativ-spirituelle Anbieter 7.1 Drei Typen von Anbietern
Grosskirchen, Freikirchen, alternativ-spirituelle Anbieter
Verankerung und Ausstrahlung der drei Anbieter
7.2 «Heilsgüter» und «Nutzen» der Angebote
Kirchen: Kraft, Halt, Tradition und ein Nutzen für andere
Freikirchen: Leben mit Jesus und anderen Christen
Alternativ-spirituelle Anbieter: Spirituelles Wachstum und Problembehebung
7.3 Das Mitgliedschaftsverhältnis zum religiös-spirituellen Anbieter
Grosskirchen: Bleiben oder Austreten
Freikirchen und alternativ-spirituelle Anbieter: wettbewerbsstarke Mitglieder- und Kundenmärkte
7.4 Die Wahrnehmung der religiös-spirituellen Anbieter
Das Image der Grosskirchen: sinnvoll, aber veraltet und konservativ
Kirchliche Pfarrer und Priester: von altmodisch bis «cool»
Das Image der Freikirchen und ihrer Pastoren: von lebendig bis gefährlich
Das Image alternativ-spiritueller Techniken und Anbieter: von neutral bis aussergewöhnlich
8 Die Wahrnehmung und Bewertung von Religion(en) 8.1 Wahrnehmung und Bewertung von «Religion an sich»
Wahrheitsrelativismus und «Gleichheit» der Religionen
Kriterien für die Einschätzung «guter» oder «schlechter» Religion
Die Rückkehr der Religionskritik
8.2 Wahrnehmung und Bewertung spezifischer religiöser Gruppen
Christentum
Katholizismus
Evangelisch-Reformierte
Buddhismus
Islam
Neue religiöse Gemeinschaften
8.3 Ursachen der Wahrnehmungen und Bewertungen
Religiöses (Sub-)Milieu
Massenmedien und Nahwelt-Diskurse
Persönlicher Kontakt
Politische Einstellung und Einstellung zu Ausländern
Alter und Generation
9 Der Wandel von Religiosität, Spiritualität und Säkularität 9.1 Der Übergang zur Ich-Gesellschaft
Ich-Gesellschaft und Wirtschaftswachstum
Ich-Gesellschaft und Kultur
Normierte vs. optionale religiöse Praxis
Normierte vs. optionale religiöse Sozialisation
Partnerwahl, Heiratsverhalten, Einfluss des Partners
Veränderungen des Coping
Ich-Gesellschaft und Geschlecht
Ich-Gesellschaft und Stadt/Land
9.2 Individuelle Anpassungen
Säkularisierendes Driften
Religiöse Individualisierung/Konsumorientierung
9.3 Effekte auf Typen und Milieus
Wachstum und Schrumpfen der Typen und Milieus
10 Schluss: Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft 10.1 Rückblick
Eine neue Beschreibung
Eine allgemeine Theorie
Eine spezifische Erklärung
10.2 Die Zukunft der Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft
11 Literatur
12 Anhang 12.1 Methode
Quantitative Teilstudie
Qualitative Teilstudie
Die Verbindung der qualitativen und quantitativen Teilstudien: Mixed Methods
Fragestellung
Operationalisierung
Sampling:
Vergleich der Samples MOSAiCH09 und RuM:
Analyse
Writing up
Das Erstellen der Typologie
12.2 Kurzporträts der Befragten (qualitative Stichprobe)
12.3 Tabellen
Kapitel 3 (Vier Gestalten des [Un-]Glaubens)
Kapitel 4 (Identität und Sozialstruktur)
Kapitel 5 (Glauben, Wissen, Erfahren, Handeln)
Kapitel 6 (Werte)
Kapitel 7 (Kirchen, Freikirchen und alternativ-spirituelle Anbieter)
Kapitel 8 (Die Wahrnehmung und Bewertung von Religion(en))
Autorinnen und Autoren
Anmerkungen |7|
Vorwort
Mit diesem Buch schliessen wir an eine Forschungsrichtung an, die vor mehr als 20 Jahren begann. 1989 wurde die erste gross angelegte Studie zur Religiosität in der Schweiz durchgeführt. Sie führte zur Publikation «Jede(r) ein Sonderfall? Religion in der Schweiz: Ergebnisse einer Repräsentativbefragung», die von Alfred Dubach und Roland Campiche herausgegeben wurde.1 Zehn Jahre später legte Roland Campiche die Nachfolgestudie «Die zwei Gesichter der Religion. Faszination und Entzauberung» vor, während Alfred Dubach und Brigitte Fuchs ihr Buch «Ein neues Modell von Religion. Zweite Schweizer Sonderfallstudie – Herausforderung für die Kirchen» publizierten.2 Mit dem vorliegenden Band wird die Serie fortgesetzt. Und wie schon in der ersten Studie ist es wieder eine Kooperation einer Lausanner und einer St.-Galler Forschungsgruppe, die sich an die Vermessung der Religiosität und Spiritualität der Schweizer Bevölkerung macht. Neu gegenüber den zwei Vorläuferstudien ist jedoch, dass wir in diesem Buch nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Daten verwenden, dass wir auch der alternativen Spiritualität und der Säkularität grosse Aufmerksamkeit schenken und eine neue Konkurrenztheorie religiös-sozialen Wandels vorschlagen.
Die unserem Buch zugrundeliegenden Daten wurden im Rahmen des Projektes «Religiosität in der modernen Welt: Konstruktion, Bedingungen und sozialer Wandel. Eine qualitative und quantitative Studie über individuelle Religiosität in der Schweiz» erhoben. Das Projekt wurde vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 58 unterstützt. In diesem Zusammenhang entstanden ein öffentlich zugänglicher Schlussbericht3 und ein vom SNF publiziertes Themenheft4.
Das vorliegende Buch wäre ohne vielfältige Unterstützung nicht möglich gewesen. Folgenden Personen möchten wir für ihre Unterstützung, Hilfeleistung und Kooperation herzlich danken: Ein erster Dank geht an die 1302 Interviewten, die uns teils in qualitativen, teils in quantitativen Befragungen berichtet haben, wie sie zu Fragen der Religiosität und Spiritualität stehen. |8|
Bettina Combet, Eva Marzi, Emilie Fleury und Julie Montandon haben ausgezeichnete zusätzliche Interviews und Transkriptionen für unser Projekt durchgeführt. Marianne Jossen hat Teile des Textes vom Französischen fachkundig ins Deutsche übersetzt. Ingrid Storm hat als Post-Doc Forscherin drei Monate lang am Observatoire des Religions en Suisse am Projekt mitgearbeitet und entscheidenden Einfluss auf die letztlich gewählte Typologie genommen. Durch ihre hervorragenden Einwände hat sie uns dazu gezwungen, zähneknirschend alles über den Haufen zu werfen und nochmals von vorne zu beginnen.
Der Schweizerische Nationalfonds hat uns optimal unterstützt. Besonders danken möchten wir den Mitgliedern der Leitungsgruppe des SNF 58, insbesondere Christoph Bochinger und Christian Mottas. Es war äusserst angenehm, für ein nicht ganz einfaches Projekt auf die effiziente und umsichtige Leitung des Gesamtprogramms zählen zu können.
Bei der Erarbeitung des quantitativen Zusatzfragebogens und bezüglich der Auswertung der ISSP-Daten haben wir sehr gut mit FORS, insbesondere Dominique Joye, Marlène Sapin und Alexandre Pollien zusammengearbeitet. Bei der Rekrutierung der qualitativen Interviewpartner und -partnerinnen haben wir auf das Befragungsinstitut LINK zurückgegriffen und möchten Isabelle Kaspar und Ermelinda Lopez für eine ausgezeichnete Zusammenarbeit herzlich danken. Für die Bekanntmachung der Ergebnisse des Projektes haben wir mit Almut Bonhage, Célia Francillon, Xavier Pilloud und Urs Hafner ausgezeichnet kooperiert. Jean-Charles Rochat fotografierte das Titelbild. Ewald Mathys besorgte das vorbildliche Korrektorat. Markus Zimmer und Marianne Stauffacher vom Theologischen Verlag Zürich haben uns sehr professionell editorisch betreut und unsere ständigen Verzögerungen grosszügig in Kauf genommen. Verschiedene Personen haben Teile des Manuskripts in unterschiedlichen Phasen seiner Entstehung gelesen und kritisch kommentiert. Sie haben uns durch ihre z. T. hartnäckigen Einwände vor vielerlei Fehlern und Fallstricken bewahrt. Es sind: Christoph Bochinger, Olivier Favre, Denise Hafner Stolz, Stefan Huber, Daniel Kosch, Gert Pickel, Detlef Pollack, Ingrid Storm und Monika Wohlrab-Sahr. Stefan Rademacher hat das fertige Manuskript nochmals ganz durchgelesen und sorgfältig kommentiert. Die Diskussionen mit Urs Altermatt, Mark Chaves, Detlef Pollack, Philippe Portier, David Voas und Jean-Paul Willaime waren uns in kritischen Phasen des Projektes ebenfalls sehr wichtig.
Die Ergebnisse des Projektes sind an den ISSR-Kongressen in Aix-en-Provence und Turku, dem Kongress zu «Religions as Brands» des ISSRC (Lausanne) sowie bei Vorträgen am GSRL (Paris), am CSRES (Strasbourg), dem Soziologischen Institut der Universität Zürich und der Graduiertenklasse «Säkularitäten» der Universität Leipzig vorgestellt und diskutiert worden. Diese Diskussionen haben das Projekt stark bereichert. |9|
Für finanzielle Unterstützung danken wir der Faculté de Théologie et Sciences des Religions (FTSR), der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz, der Katholischen Kirche im Kanton Zürich, der Société Académique Vaudoise, dem Publikationsbeitrag SPI, der Stiftung Van Walsem und dem Département Interfacultaire d’Histoire et de Sciences des Religions (DIHSR).
Wie schon unsere Vorgängerprojekte so haben auch wir erfahren müssen, dass ein mehrjähriges Forschungsprojekt zu fünft mit zwei Forschungsteams, mehreren methodischen Zugangsweisen und verschiedenen beruflichen Veränderungen im Team alles andere als einfach ist. Insgesamt aber hat die Freude am gemeinsamen Forschen die gelegentlichen Irritationen bei Weitem aufgewogen, und wir sind stolz auf das gemeinsame Produkt.
Wie anfangs schon erwähnt, steht das vorliegende Buch in einer von Roland Campiche und Alfred Dubach begründeten Forschungstradition. Diesen beiden Pionieren ist unser Buch daher gewidmet.
Lausanne, August 2013
Jörg Stolz, Judith Könemann, Mallory Schneuwly Purdie, Thomas Englberger, Michael Krüggeler |10|
1 Einleitung
Jörg Stolz, Judith Könemann
The way to God is by our selves
Phineas Fletcher
Wie immer man die heutige Gesellschaft charakterisiert – keine soziologische Beschreibung wird darum herumkommen, dem einzelnen Menschen, dem Individuum, einen hervorragenden Platz einzuräumen. Nie zuvor hat der einzelne Mensch eine solche Vielzahl von Entscheidungen in ganz eigener Sache treffen können, sei es in schulischer, politischer, ökonomischer, den Lebensstil betreffender, sexueller – oder auch religiöser Hinsicht. Nie zuvor hatte er so viel selbst zu verantworten, so viel allein zu bewältigen und zu verarbeiten, wenn seine Lebenspläne nicht gelangen. Nie zuvor schliesslich musste der Einzelne den Sinn seines Erlebens und Tuns so sehr aus sich selbst und aus den Konsequenzen seiner Entscheidungen schöpfen. In diesem Sinne leben wir heute in einer Ich-Gesellschaft.
1.1 Zentrale Fragestellung
Auf den kürzesten Nenner gebracht, analysiert unsere Studie, welchen Einfluss die so gekennzeichnete Ich-Gesellschaft auf Religiosität, Spiritualität und Säkularität ausübt. Genauer formuliert, geht es uns darum zu erforschen:
welche zentralen religiös-sozialen Typen in der Gesellschaft auszumachen sind. Als Typen bezeichnen wir dabei grosse Gruppen von Menschen, die sich durch gemeinsame Wahrnehmungen, Werte und sozialstrukturelle Merkmale wie auch soziale Grenzen auszeichnen;5
welche religiösen und spirituellen Glaubensüberzeugungen, Praktiken, Werte und Wahrnehmungen diese religiös-sozialen Typen aufweisen; |11|
wie sich die Religiosität, Spiritualität und Säkularität der Typen in den letzten Jahrzehnten verändert haben und wie dieser Wandel zu erklären ist.
Jedes Kapitel unseres Buches liefert einen spezifischen Teil der Antworten auf diese Fragen.
1.2 Bisherige Antworten
Natürlich liegt schon jetzt eine umfangreiche Literatur vor, die versucht, die religiös-sozialen Veränderungen der letzten Jahrzehnte in westeuropäischen Ländern zu beschreiben und zu erklären. Die gegenwärtig bekanntesten Theorien sind die Säkularisierungstheorie, die Individualisierungstheorie und die Markttheorie.6 Gemäss der Säkularisierungstheorie haben Elemente der Modernisierung dazu geführt, dass Religion sowohl im öffentlichen als auch im privaten Leben immer unbedeutender wird.7 Gemäss der Individualisierungstheorie ist es nicht etwa zu einer Abnahme der Religiosität gekommen, sondern dazu, dass die Religiosität immer individueller und vielgestaltiger wird.8 Die Markttheorie schliesslich benutzt ökonomische Einsichten, um religiöse Veränderungen zu erklären. Ihr gemäss leben wir zunehmend in einem religiösen Markt mit religiösen Anbietern (Kirchen) und religiösen Kunden (Gläubige). Da der religiöse Markt in europäischen Ländern stark reguliert sei (d. h. kein freier Markt herrsche), würden sich die Menschen immer mehr von Religiosität entfernen. Erst wenn der Markt liberalisiert würde und neue Anbieter auf den Markt kämen, könne es wieder zu einem religiösen Aufschwung kommen.9 Alle drei Theorien überzeugen jedoch – wie wir in diesem Buch zeigen werden – nur zum Teil. Vor allem gelingt es ihnen nicht, die Gesamtheit der Phänomene befriedigend zu erklären, die Tatsache also, dass wir sowohl religiösen Niedergang als auch Aufschwung sehen, mehr religiöse Individualisierung, aber auch mehr Fundamentalismus, mehr religiöse Freiheit, aber auch mehr religiöse Indifferenz. Genau an dieser Stelle setzt unser eigener Beitrag an. Wir versuchen, eine befriedigendere Antwort auf die oben gestellte Leitfrage zu geben, und zwar mit einer Typologie, einer Theorie und einer These. |12|
1.3 Eine neue Typologie
Ein erster Teil unserer Antwort auf die Frage, wie die Menschen in der Ich-Gesellschaft Religiosität, Spiritualität und Säkularität erleben, besteht in einer neuen Typologie. Auf einer abstrakten Ebene unterscheiden wir vier Typen: die Institutionellen, die Alternativen, die Distanzierten und die Säkularen. Jeder der Typen lässt sich anschliessend in Untertypen unterteilen. Der Sinn der Typologie besteht zunächst einmal darin, die komplexe Welt zu vereinfachen. Wer aufmerksam zuhört, wie heute Menschen in der Schweiz und anderen westeuropäischen Ländern von ihrer Religiosität, Spiritualität oder Religionslosigkeit berichten, wird zunächst mit einer riesigen Vielfalt konfrontiert. Dazu nur einige wenige Beispiele: Die 50-jährige Witwe Mima hat sich unter dem Eindruck verschiedener Todesfälle in der Familie von der katholischen Kirche distanziert. Aus ihr selbst nicht ganz verständlichen Gründen war sie auf das Schicksal, Gott und die Kirche wütend. Ganz anders Barnabé, ein 58-jähriger Landwirt. Er hat sich als junger Mann zum christlichen Glauben bekehrt, ist mit seiner Frau einer Freikirche beigetreten und bekleidet heute in dieser Gemeinde das Amt des Ältesten. Keinerlei Stabilität dieser Art findet man in der noch vergleichsweise kurzen Lebensgeschichte der 24-jährigen Studentin Julie. Sie wurde katholisch erzogen, durchlief eine atheistische Phase, fühlte sich dann von Esoterik und Buddhismus angezogen und interessiert sich seit dem plötzlichen Tod ihres Vaters wieder für das Christentum, nun allerdings das orthodoxe. Der 39-jährige Ingenieur Siegfried erzählt nochmals eine ganz andere Geschichte. Als er sich mit seiner Frau fragte, ob sie ihre zwei Kinder taufen lassen wollten, fiel die Antwort negativ aus. So zog das Paar die Konsequenz – und trat aus der Kirche aus. Betrachtet man die hier genannten Religiositätsformen im biografischen Kontext, so fällt zunächst das je Einzigartige jeder Person auf. Vermehrt man jedoch die Beispiele, so zeigt sich, dass im Hintergrund der einzelnen Lebensgeschichten immer wiederkehrende soziale Formen auszumachen sind, die sich als Typen und Milieus beschreiben lassen. In diesem Buch versuchen wir zu zeigen, dass Mima, Barnabé, Julie und Siegfried verschiedenen gut unterscheidbaren religiös-sozialen Typen und Milieus angehören, mit deren Hilfe wir besser verstehen, welchen religiösen Wandel die Schweiz in den letzten Jahrzehnten durchlaufen hat. Wichtig ist hierbei die Idee, dass wir die zentralen Eigenschaften, wie sie die eingangs gekennzeichnete Ich-Gesellschaft hervorbringt, in allen Typen wiederfinden. In allen Typen etwa erzählen uns die Menschen, wie sie sich in Bezug auf ihre Glaubensansichten und Praxis ganz auf sich selbst verlassen. Die Inhalte, Praxisformen und Glaubensansichten der einzelnen Typen unterscheiden sich dann jedoch drastisch. |13|