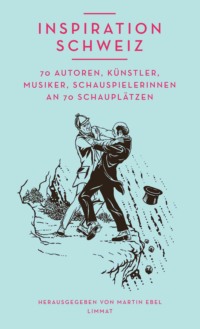Buch lesen: "Inspiration Schweiz"
Über dieses Buch
Sie kamen als Flüchtlinge, Touristen oder Ruhebedürftige. Sie suchten Freiheit, Abenteuer oder Zuflucht: Künstler aus der ganzen Welt. Und vieles ist ihnen die Schweiz über die Jahrhunderte gewesen, Exil, Arbeitsplatz, gelobtes Land, Kurort, Heimat, Station der Bildungsreise und schliesslich, einmal im Land, eine Quelle der Inspiration. Maler oder Schriftsteller, Musiker oder Filmemacher, sie alle liessen sich in der Schweiz zu Werken anregen, die wir noch heute bewundern.
70 Mal sind Redaktoren und Mitarbeiter des «Tages-Anzeigers» diesen Schweizer Inspirationen nachgegangen. Von A wie Andersen bis Z wie Zelda Fitzgerald, von A wie Ascona bis Z wie Zizers ist daraus ein faszinierendes künstlerisches Porträt der Schweiz entstanden.

Martin Ebel, geboren 1955 in Köln, ist seit 2002 Literatur-Redaktor des «Tages-Anzeigers». Er studierte in Köln, Freiburg i. Br. und Paris und promovierte mit einer Arbeit über den Kollaborationsschriftsteller Pierre Drieu la Rochelle.
Er war und ist Mitglied diverser Literatur-Jurys. Autor von «Allein das Zögern ist human. Zum Werk von Markus Werner», und Herausgeber von «Nackt gebadet, gejauchzt bis zwölf. Weltliteratur in Zürich – 50 Porträts».
Inspiration
Schweiz
70 Autoren, Künstler, Musiker, Schauspielerinnen an 70 Schauplätzen
Herausgegeben von Martin Ebel
Illustrationen von Lea Küchler
Mit Beiträgen von Pierfrancesco Basile, Barbara Basting, Monika Burri, Jean-Martin Büttner, Martin Ebel, Bernhard Echte, Martin Halter, Daniela Janser, Guido Kalberer, Alexandra Kedves, Luzius Keller, Susanne Kübler, Joachim Laukenmann, Christine Lötscher, Simone Meier, Thomas Meyer, Peter Müller, Walter Obschlager, Roland Schäfli, Christoph Schneider, Fritz Senn, Urs Strässle, Marlies Strech, Paulina Szczesniak, Andreas Tobler
Limmat Verlag
Zürich

The blue Rigi
Die Schweiz als Inspiration
«Inspiration Schweiz» möchte zu einer Schweizerreise der besonderen Art einladen. Es ist nicht die klassische «Grand Tour» entlang der kanonischen Orte, die der einstige Tourist gesehen haben musste, sondern eine Reise durch die Kulturgeschichte, wie sie sich in der Schweiz niedergeschlagen hat – nachdem sie ihre Inspiration hier empfangen hat. Die Schweiz hat Dichter und Maler, Komponisten und Filmemacher in erstaunlicher Zahl zum Schaffen und Schöpfen angeregt, und sie haben sich revanchiert mit grossen Kunstwerken. Was ist nicht alles in der Schweiz entstanden! Die «Meistersinger» und die «Duineser Elegien», der «Zarathustra» und Tschaikowskys «Violinkonzert», dazu Bilder, die in den bedeutendsten Museen hängen. Zu vielen anderen Werken ist hier ein Keim gesetzt worden, der dann andernorts aufging.
Warum in der Schweiz? Die wenigsten der hier versammelten «Inspirierten» sind ja gebürtige Schweizer. Was zog sie hierher?
Die einen kamen als Touristen, als Erlebnishungrige, als Naturfreunde auf der Suche nach erhabenen oder erhebenden Landschaften. Oder nach sportlichen Herausforderungen: Sherlock-Holmes-Erfinder Conan Doyle steckte seine Landsleute mit seiner Begeisterung für das Skifahren an. Emil Nolde bestieg Jungfrau und Matterhorn, Johannes Brahms immerhin den Niesen.
Andere fanden in der Schweiz eine Zuflucht, waren in ihrer Heimat verfolgt aus politischen, religiösen, finanziellen Gründen. Erasmus von Rotterdam kam im 16. Jahrhundert nach Basel als ein früher – und prominenter – Immigrant. Viele folgten in den nächsten Jahrhunderten bis in unsere Tage, auch wenn die meisten keinen «Namen» haben. Der Maler Gustave Courbet verliess Frankreich, um einer exorbitanten Schadenersatzforderung zu entgehen, Patricia Highsmith wich dem französischen Finanzamt aus. Charlie Chaplin hatte genug von den USA und deren Hatz auf wirkliche oder vermeintliche Kommunisten und liess sich am Genfer See nieder, wo ihn nur noch die Schiessübungen am Sonntag störten.
Mancher Schweizbesucher hatte auch medizinische Motive: Guy de Maupassant wollte seine Syphilis kurieren, Erich Kästner seine Lungenkrankheit. Beiden half ihr Aufenthalt in Leukerbad und Agra nicht, und der alkoholkranken Zelda Fitzgerald nicht die (damals noch sehr rüde) Therapie in der Klinik von Les Rives de Prangins. Arbeitsmigranten gab es auch schon in der Vergangenheit. Hegel, Fichte und Hölderlin kamen als Hauslehrer hierher, Gottfried Semper als oberster Baumeister der Schweiz. Somerset Maugham war während des Ersten Weltkriegs Agentenführer in einem Land, das «vor Spionen wimmelte». Schliesslich lockte die spektakuläre Kulisse immer wieder Filmregisseure in die Berge, während Casanova – wen wunderts – überall nur Venushügel sah.
Nicht jeder war und nicht jede wurde glücklich in der Schweiz. «Oh Gott, welch ein wundervolles Land», rief Charles Dickens aus, Rousseau wurde sein Exil auf der St. Petersinsel zur «glücklichsten Zeit» seines Lebens. Aber in der Schweiz lache nie jemand, bemängelte Ingeborg Bachmann. Selbst die Gebildeten könnten nicht dialektfrei sprechen, monierte Somerset Maugham, Alphonse Daudet schimpfte über schlechten Service und diebische «Saaltöchter», Gottfried Semper störte sich am Gremienwesen und daran, dass jeder «Wicht» sich in seiner «Nullität» den Bedeutendsten ebenbürtig dünke. Auch die Berge gefielen ihm nicht, sie verstellten bloss die Aussicht.
Nun, die Menschen sind verschieden, und sie machten unterschiedliche Erfahrungen in ihrem Gastland. Die Schweiz ist ja schon in sich verschieden, was sich mit ihren Besuchern und dem, was diese schufen, noch vervielfältigte. Diese Vielfalt spiegelt die Schweizerreise dieses Buches wieder.
«Inspiration Schweiz» ist nicht als kompaktes Buchprojekt entstanden, sondern als Zeitungsserie im «Tages-Anzeiger». Diese wiederum ist die Nachfolgerin der Serie «Geschrieben in Zürich», die sich auf einen Ort und eine Kunstgattung konzentrierte und mit fünfzig Kapiteln 2007 unter dem Titel «Nackt gebadet, gejauchzt bis zwölf» im Verlag Nagel & Kimche erschienen ist. Wegen der grossen Beliebtheit bei den Lesern lancierten wir 2008 eine neue Reihe, diesmal mit Blick auf die ganze Schweiz und alle Kunstsparten. Der Reihe lag kein fertiger Plan zugrunde, sie ist von Folge zu Folge entstanden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, auf Systematik oder auch nur auf Proportionalität. Leitlinie war mal der Wunsch der jeweiligen Autoren, über einen Künstler zu schreiben, mal der Vorschlag des Herausgebers. So erklärt sich, was alles fehlt oder zu bemängeln wäre: Es sind nicht arg viele Frauen vertreten (ein Manko, das allerdings jedes kulturhistorisch orientierte Werk behaftet); es gibt ein deutliches Übergewicht der Literatur (daran sind der Herausgeber und die Mitarbeiter schuld, deren Neigung sich hier niederschlug); auch die Kantone sind nicht gleich gut vertreten (dafür ist die Kulturgeschichte verantwortlich, die bestimmte Städte und Landschaften bevorzugte; anders als die Schweiz im Ständerat konnten wir hier nicht für eidgenössischen Ausgleich sorgen).
Ist nicht der Kunstbegriff auch recht weit gefasst mit Kapiteln zu Cäsar, Casanova, Bebel und Einstein? Nun, Cäsar und Casanova gelten als hervorragende Stilisten, Bebel ist ein geistiger Vater der Sozialdemokratie, und Einsteins Relativitätstheorie hat für das Denken moderner Schriftsteller ebenso grosse Bedeutung wie das «Kant-Erlebnis» für Heinrich von Kleist. Der Kulturbegriff dieses Buches entspricht mit Deep Purple, Hildegard Knef, Karl May und Luis Trenker im Übrigen dem, den längst jedes zeitgemässe Feuilleton pflegt.
Natürlich fehlen Namen über Namen! Bei einigen eigentlich unverzichtbaren Autoren, deren Aufenthalt für sie wie für die Schweiz wichtig war – von Büchner über Thomas Mann bis zu Brecht und Musil –, haben wir dennoch verzichtet, weil sie schon in der vorangehenden Serie und dem entsprechenden Buch berücksichtigt waren. (Aus diesem Buch haben wir sechs Kapitel übernommen.)
Wem der Sinn nach enzyklopädischer Vollständigkeit steht, der greife zu einem Lexikon. Alle anderen seien herzlich eingeladen zu unserer Schweizerreise. Die er, wenn sie ihn angeregt hat, durch eigene «Inspirationen» ergänzen und erweitern kann. Ein vollständiges Buch «Inspiration Schweiz» wäre wohl ein unendliches Buch. Denn wer weiss, wo gerade jetzt Dichter, Maler, Musiker von einer Schlucht, einem Seepanorama, einer Altstadtgasse oder in einem Asylzentrum den entscheidenden Anstoss für ein bahnbrechendes Werk empfangen?
Martin Ebel
Der Denker von der
Bäumleingasse

Erasmus von Rotterdam
Erasmus von Rotterdam fand in Basel alles, was er brauchte: Drucker und Schnellpost, Burgunder und kluge Gesprächspartner, einen wärmenden Kamin.
Erasmus von Rotterdam war nicht nur der erste politische Asylant der Schweiz, sondern auch der erste Intellektuelle von europäischem Format. Der Sohn eines Pfarrers aus Gouda hatte die geistlichen Weihen empfangen, aber er war weder fürs Priesteramt noch fürs Kloster geschaffen. Erasmus war Weltbürger, Lebe- und Weltmann, eine Art Voltaire oder auch Enzensberger des Humanismus: geistreich, ironisch, streitlustig und doch immer auf Ausgleich und kommunikative Verständigung bedacht. Und ungeheuer produktiv: Um die hundertfünfzig Bücher soll er geschrieben haben und ausserdem dreissig bis vierzig Briefe jeden Tag.
Er ging keinem Disput mit religiösen Fanatikern und scholastischen Haarspaltern aus dem Weg; seine ketzerischen Ansichten hätten ihn leicht auf den Scheiterhaufen bringen können. Aber Erasmus war viel zu elegant, vieldeutig und vorsichtig, als dass er sich hätte festlegen lassen.
Und er hatte mächtige Freunde. Wenn es brenzlig zu werden drohte, zog er sich gern in ein «kaltes Schneckenhaus der geistigen Unabhängigkeit» (Stefan Zweig) zurück; so liess er etwa 1523 in Basel seinen todkranken, verzweifelten Freund Ulrich von Hutten vor seiner Tür schmoren.
Seinen Ruhm konnten derlei unschöne Vorfälle nicht mindern, im Gegenteil. Deutsche, Engländer und Franzosen wollten Erasmus als einen der Ihren vereinnahmen. Päpste, Kaiser und Könige suchten seinen Rat und belohnten ihn mit Ehrenpensionen, Pfarreien oder auch (imaginären) Bistümern auf Sizilien. Zwingli und Luther wollten den «Goliath» für die Sache der Kirchenreform gewinnen. Erasmus war nicht unempfänglich für Schmeicheleien und alles andere als ein Held. Mut, sagte er einmal, ziert den Schweizer Söldner; der Gelehrte brauche Ruhe. Aber er liess sich nicht kaufen oder einschüchtern.
Erasmus hatte an den bedeutendsten Hochschulen Europas gelehrt – Sorbonne, Oxford, Cambridge, Padua, Bologna, Löwen – und in den wichtigen Metropolen seiner Zeit gelebt, in Venedig, Florenz, Rom, Paris, London. Er stand mit den grossen Geistern seiner Zeit, von Thomas Morus bis Luther, auf vertrautem Fuss und hatte zu allem etwas zu sagen: Fürsten- und Kindererziehung, Gnadenwahl und Bauernkrieg, Grammatik und Bibel, Diät und Dummheit. «Adagia», seine Zitatsammlung antiker Schriftsteller, wurde zum unentbehrlichen Vademecum intellektueller Snobs; sein berühmtes «Lob der Torheit» («Nur wer im Leben von der Torheit befallen ist, kann wahrhaft Mensch genannt werden») erlebte noch zu seinen Lebzeiten 36 Auflagen. In seinen «Colloquia familiaria» plauderte er über verlauste Gasthausbetten und die Vorteile des Frühaufstehens, gebildete Frauen und seine kratzbürstige Basler Haushälterin Margarete Büsslin.
«Wo ich meine Bücher habe, ist meine Heimat»: Dass dieser ruhelose Kopf fast zehn Jahre in Basel lebte, länger als in jeder anderen Stadt, spricht für die Stadt. Basel war damals ein Hort religiöser Toleranz und humanistischer Gelehrsamkeit. In der Mitte Europas gelegen, leidlich weise regiert, frei von Krieg, Pest und Inquisition, hatte Basel alles, was ein Meisterdenker vom Kaliber Erasmus’ brauchte: kluge Gesprächspartner wie Oekolampad, Beatus Rhenanus und Glarean. Aber auch edlen Burgunder, Schnellpost, Bibliotheken und nicht zuletzt einen Drucker von Weltrang.
Erasmus verlegte in Johann Frobenius’ Kontor seine Bücher und machte das Verlagshaus zur Qualitätsmarke. Im Gegenzug bekam er ein Heer von Redaktoren, Schreibern und Boten für seine ungeliebte Fronarbeit als Herausgeber antiker Autoren und Kirchenväter sowie Kost und Logis gestellt. So nahm Erasmus zwischen 1514 und 1536 immer wieder bei Frobenius Quartier: erst im Haus zum Sessel, dann im Haus zur alten Treu am Nadelberg (wo Hans Holbeins berühmtes Erasmusporträt entstand), zuletzt im Haus zum Lufft; das heutige Erasmushaus in der Bäumleingasse 18 beherbergt, passend, ein Antiquariat.
Der Mann war ein anspruchsvoller Gast; seine Abneigung gegen Schmutz und Lärm, Ungeziefer und pöbelhafte Manieren waren legendär. Um die üblen Gerüche der Basler Altstadtgassen zu meiden, nahm er weite Umwege in Kauf.
Sein Gastgeber Frobenius tat alles für ihn: Der ewig fröstelnde Erasmus bekam Pelze, Bettdecken und einen Kamin, weil er angeblich allergisch gegen Herdfeuer war, dazu teure Kerzen, weil das Flackerlicht des Kienspans seinen nächtlichen Studien abträglich war, und natürlich Wein und Fleisch an allen Tagen. Für sein kränkelndes «Körperchen» hatte Erasmus einen päpstlichen Dispens erwirkt.
In Basel fand Erasmus seine Ruhe, aber letztlich doch kein Schlaraffenland oder gar das Paradies der Freiheit. Als die Stadt 1529 ins Lager der Reformation wechselte, musste er für sechs Jahre ins Exil ins nahe Freiburg im Breisgau ausweichen, was in Anbetracht der Flöhe, des sauren Weins und der katholischen Frömmler eine Zumutung war. 1535 kehrte der verlorene Sohn, schwer gezeichnet von Gicht und Rheuma, nach Basel zurück und wurde mit allen Ehren wieder aufgenommen. Nach seinem Tod am 12. Juli 1536 wurde er im protestantischen Münster begraben: eine seltene Ehre für einen Freigeist, der dem Papsttum nie abgeschworen hatte.
Seither kann man, wie Stefan Zweig in seiner Biografie schrieb und das Basler Stadtmarketing jederzeit bestätigt, «Erasmus nicht mehr denken ohne Basel und Basel nicht ohne Erasmus».
Martin Halter
«Vor diesem Bild kann manchem der Glaube verloren gehen»

Fjodor Dostojewski
Ein Bild im Kunstmuseum Basel spielt eine zentrale Rolle in dem Roman, den Dostojewski in der Schweiz 1867/68 begann: «Der Idiot».
Anna Grigorjewna war erst die Stenotypistin Dostojewskis. Sie half ihm, in 24 Tagen den Roman «Der Spieler» zu Papier zu bringen und so einen Knebelvertrag mit seinem Verleger zu vermeiden. Die gemeinsam durchgestandene Prüfung hatten den Autor und seine 25 Jahre jüngere Sekretärin zusammengeschweisst: Im Februar 1867 wurde in St. Petersburg geheiratet.
Zwei Monate später waren die Dostojewskis auf der Flucht vor den Gläubigern. Nach Berlin und Dresden war Baden-Baden die dritte Station ihres Exils. Nach entsetzlichen Verlusten im Spielcasino musste Dostojewski abreisen, ohne dass er die verpfändeten Kleider seiner Frau hatte auslösen können. Die Spielverluste und die immer häufiger werdenden epileptischen Anfälle ihres Mannes versuchte Anna Grigorjewna «mit philosophischer Kaltblütigkeit» zu ertragen, wusste sie doch seit einigen Wochen, dass sie schwanger war.
Ende August 1867 reisten die Dostojewskis von Baden-Baden über Basel nach Genf, wo sie für die nächsten Monate Wohnsitz nahmen. Warum gerade Genf? «Kann ich das wissen? Ist’s nicht ganz gleich?», kommentierte Dostojewski gegenüber Freunden die Wahl seines neuen Aufenthaltsortes.
Obwohl er sich am «wunderbaren» See mit seinen «malerischen» Ufern erfreuen konnte, wurde er kein Freund der Stadt Calvins. Wiederholt beklagt er sich in seinen Briefen über die Bise und die ständigen Wetterumschwünge. «Tagelang stürmt es hier, und selbst an den gewöhnlichsten Tagen wechselt das Wetter drei- und viermal. Und dies soll ich mit meinen Hämorrhoiden und meiner Epilepsie aushalten!»
Kaum zum Aushalten fand Dostojewski auch die Schweizer. «Wenn Sie eine Ahnung hätten, wie unehrlich, gemein, unglaublich dumm und unentwickelt die Schweizer sind!», schrieb er einem Freund. Auch Anna Grigorjewna ärgerte sich über die Selbstzufriedenheit und den «einfältigen Patriotismus» der Schweizer. Am schlimmsten empfanden die Dostojewskis aber die Unsauberkeit dieser «Barbaren», die sich mangels öffentlicher Bäder nur selten wüschen. «Der Kirgise in seiner Jurte wohnt sauberer!», berichtete Dostojewski «ganz entsetzt» nach Russland.
Trotz seiner Beschwerden konnte Dostojewski den Aufenthalt in Genf für die Arbeit an einem neuen Roman nutzen: Unterbrochen von einigen Abstechern in die Spielcasinos von Saxon-les-Bains nahm er in Genf den «Idiot» in Angriff, also jenen Roman, der damit beginnt, dass der Epileptiker Myschkin nach einem längeren Klinikaufenthalt in der Schweiz nach St. Petersburg zurückkehrt. Noch während der Zugfahrt lernt er Rogoschin kennen, der im Kampf um die ebenso schöne wie dämonische Nastassja Filippowna zu seinem Widersacher wird.
Von zentraler Bedeutung im Roman ist ein Bild, das Dostojewski während der Durchreise im Kunstmuseum Basel gesehen hatte: «Der Leichnam Christi im Grabe» (1521/22) von Hans Holbein dem Jüngeren. Zwei Meter lang und gerade mal dreissig Zentimeter hoch, zeigt dieses Gemälde im Extremformat einen geschundenen, von der Verwesung im Gesicht und an den Wundmalen bereits stark gezeichneten Christus. Dostojewski war von dem Bild derart fasziniert, dass er unerlaubterweise auf einen Stuhl stieg, um die Details des über Kopfhöhe hängenden Gemäldes besser sehen zu können.
Mit Faszination und Schrecken wird das Bild auch im «Idiot» betrachtet: «Vor diesem Bild kann manchem der Glaube verloren gehen», erklärt Myschkin, als er im Zimmer Rogoschins eine Reproduktion des Gemäldes entdeckt. Und der Student Ippolit stellt die provokative Frage, wie die Jünger angesichts des verwesenden Leichnams glauben konnten, dass Christus auferstehen werde?
Der Einzige, dem im Roman das Bild wirklich zu gefallen scheint, ist der Agnostiker Rogoschin. Gerade er macht sich am Ende des Romans daran, ein Gegenbild zu «erschaffen»: Er ermordet Nastassja Filippowna, entkleidet sie und bahrt sie christusgleich auf seinem Bett auf.
Den entstehenden Verwesungsgeruch bekämpft er erfolgreich mit einigen Flaschen «Schdanowscher Lösung», einem Mittel gegen üble Gerüche. Da er die Leiche zudem mit Tüchern bedeckt, deutet äusserlich nichts auf den Mord hin, und so glaubt Myschkin, als er von Rogoschin ins Zimmer geführt wird, Nastassja Filippowna schlafe.
Nachdem der Mörder gestanden hat, verbringen die beiden die Nacht am Bett der Toten, die mit ihrem scheinbar unversehrten Körper Hoffnung auf Auferstehung und ein besseres Jenseits zu geben scheint. Aber in einem Roman, den Walter Benjamin treffend mit einem «ungeheuren Kratereinsturz» verglichen hat, gibt es keine Hoffnung: Als am Tag darauf die Zimmertür von der Polizei geöffnet wird, ist Rogoschin im Fieberwahn, Myschkin in Apathie versunken.
Auf den Knien betend, verbrachte Dostojewski die Nacht vom 4. auf den 5. März 1868. Gegen fünf Uhr morgens wurde er durch den Schrei eines Kindes erlöst: Er war Vater eine Tochter geworden. Die Freude Dostojewskis war riesig: Ein Monat nach der Geburt berichtet er einem Freund, das Kind habe «bis hin zu den Stirnfalten» bereits alle seine Züge und liege in seinem Bettchen, «als schaffte es einen Roman!»
Acht Tage nach der Taufe, am 24. Mai 1868, starb Sonja «Sonetschka» Dostojewski an einer Lungenentzündung. Ausser sich über die Überheblichkeit des Arztes, die Unerfahrenheit der Kinderfrau und das ungünstige Klima, das er für den Tod seiner Tochter mitverantwortlich machte, verliess Dostojewski mit seiner Frau das «verdammte Genf» und siedelte nach Vevey, schliesslich nach Italien über. Hier schloss er im Januar 1869 seinen Roman ab und kehrte über Prag und Dresden im Juli 1871 nach St. Petersburg zurück.
In die Schweiz kam Dostojewski noch einmal: Im August 1874 reiste er nach Genf und besuchte das Grab seiner Tochter auf dem Friedhof Plainpalais, wo heute noch eine Gedenkplatte an sie erinnert.
Andreas Tobler