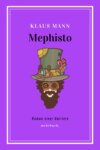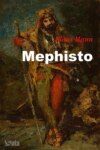Buch lesen: «Klaus Mann - Das literarische Werk», Seite 15
Während sie schon einschlief, dachte sie noch: ›Komisch, diese kurz geschorenen Haare am Nacken und an den Schläfen … Die müssen aber ziemlich stark kitzeln, wenn man das Gesicht an sie legt … Hat er mir nicht erzählt, daß er in Berlin ein Schupo war? Ich kann ihn mir recht gut vorstellen in der grünen Uniform …‹
Es regnete in Strömen. An Spazierengehen war nicht zu denken. Zum Kino hatten Tilly und Ernst keine Lust. Sie waren überhaupt bei weitem nicht so lustig wie den Abend zuvor. Beide schauten viel vor sich hin, oder der eine dem anderen ins Gesicht, ohne zu reden. Wenn die Gier in ihren Blicken zu deutlich wurde, senkten sie die Augen, wie beschämt. Aber bald ertappten sie sich wieder dabei, daß der eine versunken saß in das Bild des anderen. Nach dem Essen blieben sie noch eine Weile in der halbdunklen Wirtsstube sitzen. Endlich war es Tilly, die sagte: »Wir sollten gehen.« Er antwortete nicht gleich. Unersättlich ließ er die Blicke über ihr Antlitz wandern. ›So was Hübsches habe ich lange nicht gesehen‹, dachte er. ›So was Schönes sehe ich lange nicht wieder. Merke dir, was du siehst, damit du es nicht gleich wieder vergißt, dummer Kerl! – Ihre Stirn, alabasterweiß, ernst gerahmt vom schlichten rötlichen Haar. Wie brav und fromm ihr Haar in der Mitte gescheitelt ist – und dazu der große, weiche, schlampige Mund, und die langen, schräggestellten feuchten Augen. Und dieses schlichte dunkle Kleidchen, das sie heute trägt – die nackten Arme kommen so reizend unterm dunklen, leichten Tuch hervor, und die Form ihrer Brüste hebt sich so deutlich ab.‹ – Er merkte, daß sie sich zusammenzog, weil er sie anstarrte. Es war ihm peinlich, er sagte, gleichsam um Entschuldigung bittend: »Ja, es wird wirklich Zeit …« Keiner von beiden wußte, wofür es Zeit war und wohin sie gehen wollten.
Auf der Straße war wieder sie es, die zu reden begann. »Es regnet immer noch.« Ihre Stimme klang traurig. Er sagte tröstlich: »Aber nur noch ein bißchen. Und es wird wohl bald aufhören.« – Tilly, mit einem betrübten Blick nach oben: »Der Himmel ist doch so schwarz.« Dann schwiegen sie wieder und gingen.
Nach einer Pause fragte sie ihn: »Wo wohnen Sie eigentlich?«
»Bei einem Kameraden«, antwortete er, nicht ganz ohne Stolz. »Drüben im Niederdorf – das ist wohl der älteste Teil von der Stadt. Sehr nettes Zimmer; aber ein bißchen eng. Dorthin kann ich keinen Besuch mitbringen. Sie dürfen wohl bei sich auch keinen Besuch haben?«
»Natürlich nicht«, sagte Tilly.
Daraufhin schlug er vor: »Wir könnten ja in ein kleines Hotel gehen.«
Nun meinte Tilly doch, sich ein wenig entrüsten und die empfindliche Dame spielen zu müssen. »Was fällt Ihnen ein!« Sie versuchte, ihre Stimme spitz zu machen. Es mißlang. Sie lächelte.
Er nahm ihren Arm. »Ich dachte nur – weil es so regnet …«
Sie wurde gleich wieder mitleidig. »Und Sie haben gar keinen Mantel! Mein Gott, Sie werden ja pudelnaß!« – Er trippelte vorsichtig unter dem aufgespannten Regenschirm, den sie hielt. Mit seinem hochgeschlagenen Rockkragen, das triefende Haar in der Stirne, sah er ziemlich erbarmungswürdig aus. Aber er lachte. »Ich fühle mich wohl … Sauwohl fühle ich mich!« Er drängte den Körper an sie, sein nasses Gesicht war nahe an ihrem.
Sie sprach nachdenklich: »Ich weiß ein kleines Hotel, gar nicht weit von hier. Die Besitzer kennen mich dort … Aber dürfen Sie denn überhaupt in einem Hotel übernachten?« fiel ihr plötzlich ein. »Sie haben mir doch erzählt, daß Ihre Papiere nicht in Ordnung sind.«
Er lachte wieder. »Nein, die sind allerdings ganz und gar nicht in Ordnung. Aber niemand wird sie zu sehen verlangen.«
Sie blieb ängstlich. »Man kann Pech haben, es könnte eine Kontrolle geben. Sie sind hier neuerdings furchtbar scharf hinter den Fremden her.«
»Wenn man nur eine Nacht in einem Hotel ist, wird man nie kontrolliert«, erklärte er zuversichtlich. »Erst die zweite Nacht ist gefährlich.«
»Mir scheint doch, es ist schrecklich gewagt, was wir tun – ganz abgesehen von allem anderen, was es sonst noch ist.« – Sie waren vor dem Hotel stehengeblieben.
Es regnete wieder stärker. Tilly schaute in das gleichmäßig niederfallende, strömende, rauschende Wasser. »Es ist wie eine Sintflut«, sagte sie leise. Und Ernst: »Sie sollte alles wegwaschen – alles wegspülen, das sollte sie. Ersaufen müßte das ganze Pack, etwas anderes verdient es nicht mehr …« Und plötzlich lachend, fügte er hinzu: »Nur wir dürfen übrig bleiben – nur wir zwei!« Er wandte ihr das vergnügte, vom Regen gebadete Gesicht zu.
Sie blieben noch eine Weile nebeneinander unter dem offenen Schirm stehen, als wagten sie sich nicht ins Hotel, oder als fühlten sie sich hier draußen sicherer. Schließlich traten sie ein.
Die Wirtin musterte sie etwas mißtrauisch; stellte jedoch keine Fragen, weder nach den Pässen noch nach dem Gepäck, sondern sperrte ihnen schweigsam ein Zimmer auf. »Numero 7 ist das einzige, das ich heute abend frei habe«, sagte sie mürrisch. Es war ein langer und schmaler Raum, mehr einem Korridor als einer Schlafstube ähnlich. Die beiden Betten standen mit den Kopfenden gegeneinander gerückt; eines neben dem anderen hätte kaum Platz gehabt. Als die Wirtin hinaus war, bemerkte Ernst: »Das sieht auch nicht übermäßig sauber hier aus … Die Flecke an den Wänden stammen von zerdrückten Wanzen«, stellte er sachverständig fest. »Hoffentlich ist keine übrig geblieben. – Wie heißt denn die schöne Wirtin?« – »Ich weiß es nicht, wie sie heißt«, sagte Tilly. – »Hast du mir nicht erzählt, daß du sie kennst?« – »Ja, ich kenne sie. Aber ich habe ihren Namen vergessen.« – »Das scheint ja keine sehr intime Bekanntschaft zu sein.« Ernst war etwas enttäuscht. Er stand vorm Spiegel und trocknete sich den Kopf mit einem Handtuch. Sie bemerkte, daß seine Haare dünn wurden – schütteres Haar, und die Farbe war wie ausgebleicht von vielen Wettern: ein fahles Blond, Stürme und Regengüsse schienen ihm den Glanz genommen und es fast entfärbt zu haben.
»Mir gefällt das Zimmer ganz gut«, sagte Tilly, die hinter ihm stand. »Aber kalt ist es!« Sie schauderte. Ernst hörte, daß ihre Zähne aufeinanderschlugen. Er wandte sich um. Ihr Gesicht war blaß, rötlich glühte nur die Nasenspitze. »Du hast einen Schnupfen.« Er legte ihr die Arme auf die Schultern. Sie zitterte und wußte, daß es nicht vor Kälte war.
Hilflos sagte sie: »Jetzt gehe ich wohl besser nach Hause …«
Er antwortete gar nicht, sondern zog sie an sich.
Sie versuchte, sich frei zu machen. »Aber ich habe keine Zahnbürste mit, und keinen Pyjama …« – »Ich auch nicht!« Er hielt sie fest. »Wozu brauchen wir eine Zahnbürste …? Kannst du mir vielleicht verraten, wozu wir eine Zahnbürste und einen Pyjama brauchen?«
»Aber es geht nicht … Es geht nicht …« Sie zitterte stärker. Nun fürchtete sie auch, es könnte ein Asthmaanfall kommen. Er hatte die Arme fester um sie geschlossen. Da gestand sie: »Ich war schon so lange nicht mit einem Mann zusammen …«
Er blieb stumm. Sprachlos und lächelnd legte er seine Stirne an ihre. Es vergingen Sekunden – oder viele Minuten, sie wußten es nicht. Das Schweigen hatte schon zu lange gedauert, als er mit gedämpfter Stimme wieder zu sprechen begann. »Komisch sehen die Augen von einem anderen Menschen aus, wenn man sie so dicht vor den eigenen Augen hat! Sie scheinen ganz nah beieinander zu liegen und ganz groß zu werden – wie Eulenaugen … Genau wie Eulenaugen!« wiederholte er erstaunt – und sie mußte plötzlich lachen über dieses Wort. Sie lachte heftig und krampfhaft, ohne aber ihre Stirn dabei von seiner zu lösen. Sie blieben stehen, mit herabhängenden Armen jetzt, und es schien, als wären ihre Stirnen aneinandergewachsen.
»Eulenaugen!« kicherte Tilly. »Ist doch zu idiotisch! Warum sollte ich denn Eulenaugen haben? – Du hast übrigens auch welche … Aber helle Eulenaugen. Helle Eulenaugen sind auch nicht feiner.«
Immer noch lachend zog sie endlich ihre Stirn zurück. Sie tat es mit einer Geste, als müßte sie ihre Stirne wegreißen von seiner, an der sie festgewachsen war. Dabei schrie sie ganz leise und berührte mit dem Zeigefinger ihre Stirn, gerade zwischen den Augenbrauen, als gäbe es dort eine blutige Stelle. Ihr lachender Mund bekam einen klagenden Zug. Es war, als liefe Blut von ihrer Stirn zu den Lippen. Vielleicht schmeckten ihre Lippen das Blut. Vielleicht verzogen sie sich deshalb so schmerzlich und angewidert. Aber sie hörte nicht auf zu lachen.
Rückwärts gehend tat sie ein paar Schritte, die taumelig waren – als wäre sie nicht nur verwundet, sondern auch betrunken. Sie setzte sich auf das Bett, ohne es anzusehen oder den Kopf zu wenden; ihre Augen blieben auf den Mann fixiert.
»Eulenaugen …« wiederholte sie, und ihr kleines Gelächter klang einem Schluchzen sehr ähnlich. »Zu dumm …« Aber plötzlich wurde sie ernst. Eine leichte Röte lief, wie der Widerschein eines vorbeiziehenden Lichts, über ihr weißes Gesicht. Mit einer merkwürdig trockenen Stimme – als wäre ihre Kehle ausgedörrt und sie hätte keinen Speichel mehr im Munde – sagte sie: »Ich glaube überhaupt, daß ich es gar nicht mehr kann.« Ernst, der noch immer mitten im Zimmer stand, fragte, seinerseits plötzlich heiser: »Was solltest du nicht mehr können?« – Da erwiderte sie, schamlos und sanft, mit einer zugleich traurigen und verlockenden Gebärde zu dem nicht sehr sauberen Bett: »Das … Ich habe es sicher schon ganz verlernt …«
Er lächelte nicht; sein Gesicht blieb ernst, und es gab einen beinah zornigen, brutalen Zug um seinen Mund, als er sagte: »Das verlernt man nicht.«
Er war bei ihr und bog ihren Oberkörper nach hinten. Sie ließ es geschehen, Angst und Krampf waren fort. Sie bekam den Blick eines Kindes, das sich verirrt und sehr viel Schrecken ausgestanden hat – nun aber ist es dort angekommen, wo es keine Gefahren mehr gibt: keine Gefahren mehr für diesen schönen Moment. Es darf die Glieder lockern, den Mund hinhalten, auch die Augen dürfen sich endlich schließen. Nachgeben dürfen, stillhalten dürfen, diese Liebkosungen annehmen und erwidern dürfen. Dies ist die Stunde, liebe arme Tilly, die dich entschädigen und trösten soll für viele Monate und mehrere Jahre, da du einsam warst und wenig Freude kanntest. Nun entschädigt und tröstet sich dein atmender, erbarmungswürdiger, hilfloser, schöner Körper. Es trösten und entschädigen sich dein Mund, dein Haar, in dem seine Finger spielen, deine Füße, die so müde gewesen sind, deine Hände, die auf den Tasten der Schreibmaschine oft nicht weiterkonnten; dein ganzer Leib, den er nimmt.
Nun hat er dich einmal geliebt, er wird dich noch zweimal oder viermal lieben; denn die Nacht ist lang, und er hat lange keine Frau gehabt. Eine so Hübsche wie dich wird er auch zunächst nicht mehr finden. Er liebt dich sehr, er begehrt dich mit starker Gier, er ist dir dankbar, daß du ihm dies gewährst; aus der Dankbarkeit könnte Zärtlichkeit werden. – Halte stille, sogar wenn es schon ein wenig wehe tut! Dieses ist deine schöne Stunde, die Nacht des Trostes und der Entschädigung. Unsere Welt aber ist so eingerichtet, daß selbst Trost und Entschädigung nicht ganz schmerzlos bleiben, etwas Schmerz ist in alles gemischt – halte still, arme Tilly. Du weißt es ja, dein Freund hat keine Aufenthaltserlaubnis in diesem Lande, morgen kann er schon ausgewiesen sein, vielleicht siehst du ihn nie mehr. Noch ist er bei dir, halte still! Für den Augenblick ruht er aus – sieh, sein mageres, etwas fleckiges und etwas ramponiertes Gesicht auf dem Kissen! Aber gleich wird er dich wieder packen, die Nacht ist lang – ungewiß, was der Morgen bringt; wir leben in wirren Verhältnissen, allerlei mißliche Überraschungen sind an der Tagesordnung, hübsche arme Tilly!
Ernst atmete tiefer. Schlief er schon? Tilly liebkoste ihn mit den Augen, weil die Hände müde waren. – ›Bleibe bei mir! Bitte, geh nicht weg! Ich habe mich so lang nach dir gesehnt! Nicht nach dir eigentlich, sondern nach dem Konni oder nach seinem Freund H.S. Die sind nicht gekommen, aber du bist hier, und du bist beiden verwandt, bist der Bruder von beiden – ich umarme den verlorenen Konni und den anderen, fremden, den ich nie gesehen habe, da ich dich umarme. Du weißt ja nicht, wie schlimm und arg alles gewesen ist, ehe du kamst. Du kannst es dir gar nicht vorstellen.‹
›Warum soll ich es mir denn nicht vorstellen können?‹ antwortete er stumm. ›Ich habe es doch keineswegs besser gehabt. Glaubst du vielleicht, es ist ein Vergnügen, ohne Paß durch die Länder zu ziehen, immer in Angst vor der Polizei, wie ein Verbrecher? – Und ich habe eigentlich nichts besonders Schlimmes getan, außer dem bißchen Schwarzarbeit in Prag. In Berlin war ich ein Schupo, sehr respektabel in der schönen grünen Uniform. Ich gehörte zum Staat, ich war ein Teil seiner Macht, einer seiner vielen Repräsentanten, und alle sahen mich achtungsvoll an. Meine ganze Schuld war, daß ich diesen Staat verteidigen wollte, und daß ich mich nicht abgefunden habe mit dem Neuen … Warum sollte ich mir nicht vorstellen können, wie dreckig es dir ergangen ist? Da müßte ich aber beschämend wenig Phantasie haben!‹
Und sie darauf: ›Keiner weiß doch, was der andere auszustehen hat. Das kann niemand ermessen, es bleibt das Geheimnis, welches jeder mitnimmt. Immerhin gibt es manchmal die Stunden des Trostes und der Entschädigung.‹
Da war er wieder bei Kräften und zog sie an sich heran.
Erst gegen Morgen schliefen sie ein. Sie blieben im gleichen Bett, obwohl es viel zu schmal für sie beide war. Sie schliefen aneinandergeschmiegt, als es an die Tür klopfte. Da mochte es halb sechs Uhr morgens sein. Beim ersten Klopfen erwachte keiner von beiden. Tilly fabrizierte sich aus dem klopfenden Geräusch an der Türe ganz schnell einen Traum. So leicht werden ja große Träume aus kleinen Geräuschen: nur ein Klopfen ist da, aber im Traum vollzieht sich blitzschnell eine lange Geschichte, in die das Klopfen paßt, zu der es gehört. Eine Mauer wird gebaut, das verursacht Lärm. Tilly träumte, daß eine hohe rote Mauer gebaut wurde – vielleicht war es die Mauer zu dem Gefängnis, in das man Ernst sperren würde, zur Strafe, weil er ohne Paß in der Schweiz war und weil er hier mit ihr geschlafen hatte. Die Mauer wuchs, das Geräusch steigerte sich tobend. Tilly fuhr auf; es hatte stärker geklopft.
Auch Ernst war inzwischen erwacht. »Es hat geklopft«, sagte Tilly, mit den Handrücken vor ihren verschlafenen Augen. – »Das merke ich«, versetzte Ernst ziemlich unfreundlich. Während es noch immer klopfte, sagte er, mit einer vor Müdigkeit ganz heiseren Stimme: »Man muß wohl aufmachen.« Sein Gesicht sah alt und verfallen aus – fahl, mit hängenden Zügen – und er hatte einen angewiderten Zug um den Mund, während er das Bett verließ und langsam durchs Zimmer ging. »Ich komme schon«, sagte er zu dem Unbekannten, der sich draußen immer heftiger bemerkbar machte. Aber Ernst sprach so leise, daß die Person vor der Türe ihn keinesfalls verstehen konnte.
»Du solltest dir etwas überziehen«, mahnte Tilly, denn er stand nackt da – nackt und ein wenig zitternd vor dieser verschlossenen Türe, die zu öffnen er noch ein paar Sekunden lang zögerte. »Du wirst dich erkälten«, sagte das Mädchen im Bett. So verschlafen sie war – daß er zitterte, bemerkte sie doch, und sie sah auch die Gänsehaut auf seinen Armen und auf seinem Rücken. Aber da hatte er die Türe schon aufgemacht.
Vor ihm stand ein Herr in dunklem Überzieher, mit steifem, schwarzem Hut, einem hohen, blendend weißen Kragen und schwarzen, blankgewichsten Stiefeln, die unter hellen Beinkleidern sichtbar wurden. Er trug eine gelbe Aktentasche unter dem Arm und sah aus wie ein übelgelaunter Geschäftsreisender.
Der Herr musterte, mit einem kalten, feindlichen Blick durch den Zwicker, den nackten jungen Menschen, der ihm gegenüberstand. Die korrekte Figur des Herrn drückte von den Stiefelspitzen bis zum Scheitel Mißbilligung aus. Er stand einige Sekunden lang unbeweglich, und auch Ernst, der Zitternde, rührte sich nicht. Der Herr betrachtete, ausführlich und unbarmherzig, diese frierende Nacktheit. Er schien die Rippen zählen zu wollen, die sich abzeichneten unter der gespannten Haut. Er mißbilligte das zerzauste Haar und das verstörte Gesicht des jungen Menschen; er nahm Anstoß an den gar zu sichtbaren Rippen, dem totalen Mangel an Bauch – Menschen, die in einer anständigen Beziehung zur bürgerlichen Weltordnung leben, müssen einen etwas gepolsterten Bauch zeigen – und er empfand Ekel sowohl als Entrüstung angesichts der provokanten Entblößung des Geschlechts.
»Fremdenpolizei«, stellte er sich unheilverkündend vor. »Ziehen Sie sich bitte sofort etwas an!« Während Ernst stumm zu seinen Sachen ging, sprach der Mann mit der Aktentasche – wobei sein ungnädiger Blick an dem benutzten und dem unbenutzten Bett vorbei zum Fenster ging: »Zeigen Sie Ihre Pässe!«
Tilly erschrak so sehr, daß sie einen stechenden Schmerz in der Magengegend empfand und meinte, ihr Herz müßte aussetzen zu schlagen. Sie spürte, daß ihr der Atem sekundenlang wegblieb. Ein Asthmaanfall bereitete sich wohl vor … Trotzdem war ihr klar, daß sie sich nun äußern und in Aktion treten müsse, um Ernst zu retten – oder doch, um die Katastrophe, die ihn bedrohte, aufzuschieben. Sie ließ eine kokette Piepsstimme hören, die sie immer dann verwendete, wenn sie Herren von der Polizei oder Ladenbesitzer, bei denen sie Schulden hatte, rühren und versöhnen wollte. »Ach, wie dumm!« machte sie, töricht lächelnd. »Ich habe meinen Paß nicht bei mir!«
Der Herr von der Fremdenpolizei vermied es, sie genau anzusehen. Er hatte schon festgestellt, daß sie hübsch war, und er wollte sich keineswegs durch ihre Reize bestechen lassen. »Wo wohnen Sie?« fragte er barsch.
»In Rüschlikon«, plapperte sie, eifrig wie ein Schulmädchen. Und sie redete weiter: »Meine Mama, Frau von Kammer, hat eine kleine Wohnung dort. Ja, ich bin polizeilich gemeldet …« Der Herr unterbrach sie: »Sind Sie mit diesem Mann hier verheiratet?«
Tilly ließ nicht von ihren traurigen kleinen Versuchen, mit dem Beamten zu kokettieren. »Gewiß«, sagte sie, wobei sie die Schultern hochzog und sich zu allerlei niedlichen Grimassen zwang, die ihrem Gesicht weh taten. »Das heißt: beinah verheiratet – so gut wie verehelicht … Er ist ein Vetter von mir … Ein Jugendfreund außerdem … Wir sind schon seit langem verlobt …«
»Also nicht verheiratet«, stellte unerbittlich der Beamte fest, und er machte sich Notizen in ein dickes schwarzes Wachstuchheft, welches er aus seiner Aktentasche geholt hatte. »Haben Sie keinerlei Ausweispapiere bei sich?«
»Oh doch«, schwatzte sie. »Es wird sich schon etwas finden – dies und das, eine Visitenkarte oder so. Wenn Sie nur so freundlich wären, mir dieses Täschchen herüberzureichen …«
Der Beamte gab ihr stumm die Tasche, auf die sie gedeutet hatte. Tilly kramte aufgeregt; ließ eine alte kleine Puderdose auf den Fußboden fallen – der Beamte überlegte sich eine Sekunde, ob er sich bücken solle, um sie aufzuheben, unterließ es dann aber. Tilly mußte schließlich betrübt konstatieren: »Nicht einmal eine Visitenkarte ist da! – Aber hier!« rief sie mit kläglicher Munterkeit, »hier – eine kleine Tischkarte! Sie stammt von einem Diner bei Herrn und Frau Ottinger. Entschuldigen Sie, es ist kein recht seriöses Ausweispapier; aber immerhin, Sie sehen doch meinen Namen …«
Der Beamte betrachtete mit ungerührter Miene die kleine Karte. Auf ihr war abgebildet ein junges Mädchen, das an einer Schreibmaschine sitzt; man sah nur den Rücken. Das alberne Bildchen war umrahmt von einem Kranz aus Rosen und Vergißmeinnicht. Darunter stand Tillys Name in verschnörkelten Buchstaben.
»Sie waren bei Herrn Ottinger eingeladen?« erkundigte sich der Herr, um eine Nuance freundlicher.
»Natürlich«, bestätigte Tilly geschwind. »Ich bin sehr oft dort, beinahe jeden Tag. Frau Ottinger ist immer sehr freundlich zu mir. Auf keinem ihrer musikalischen Jours darf ich fehlen …«
Der Beamte schnitt ihr das Wort ab. »Das gehört nicht zur Sache!« – obwohl ihn doch gerade dieser Klatsch aus den besseren Kreisen lebhaft interessierte.
Das Verhör, das Tilly über sich ergehen lassen mußte, zog sich noch eine Weile hin. Der Beamte erledigte es mit Gewissenhaftigkeit; trotzdem war von Anfang an deutlich, daß er mit dem jungen Mädchen milde verfahren würde. Sein geübter Instinkt hatte begriffen, daß ihre Angaben mindestens zum größten Teil der Wahrheit entsprachen. Er notierte sich ihre Geburtsdaten, den Namen ihrer Mutter und die Adresse. Als sie ihm gestand, daß sie mit einem Ungarn verheiratet war, ward sein Gesicht noch ernster und fast ein wenig verwirrt. Er erinnerte sich wohl der heuchlerischen Angaben, die sie vorhin über Jugendfreundschaft und Verlobung mit dem nackten jungen Mann gemacht hatte. Außerdem fand er ihren exotischen Namen übertrieben schwer auszusprechen. Abschließend sprach er, tadelnd, aber nicht ganz ohne väterliches Wohlwollen: »Es macht immerhin einen merkwürdigen Eindruck – eine verheiratete junge Frau mit einem Fremden im Zimmer …« Dann zuckte er die Achseln, als wollte er sagen: Was geht es mich schließlich an? – und wendete sich an Ernst.
Der hatte sich inzwischen in das zweite, unbenutzte Bett gelegt. Das peinliche war, daß er sich stellte, als wäre er schon wieder eingeschlafen. Eine hoffnungslose, absurde kleine Komödie – da er ja gerade noch, nackt und wach, durchs Zimmer geschritten war. Der Beamte ließ sich überhaupt nicht auf sie ein. Zwischen ihm und Ernst begann der schreckliche Dialog.
»Ihren Paß, bitte!« – Ernst, den Schlaftrunkenen mimend: »Wie beliebt?« – Der Beamte, entschieden schärfer: »Ihren Paß!« – »Den habe ich nicht bei mir.« – »Wo haben Sie ihn!« – »Bei … bei Bekannten …« – Der Beamte, sehr höhnisch: »Bei Bekannten, aha!« Plötzlich auf ihn losfahrend: »Sie besitzen wohl gar kein gültiges Ausweispapier?!«
Nun versuchte Ernst sein Glück mit einer wehleidigen Miene und mit einer etwas künstlich pathetischen Sprechweise. »Herr Kommissar – jetzt sage ich Ihnen die ganze Wahrheit. Mein Paß ist abgelaufen. Ich habe auch keine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Ich bin ein politischer Flüchtling.« – Daraufhin der Beamte, höflich, aber bestimmt: »Stehen Sie auf und kommen Sie mit mir!« Ernst sagte noch, völlig sinnloserweise: »In Berlin bin ich eine Art von Kollege von Ihnen gewesen – auch von der Polizei … Ich bin unschuldig in diese Lage gekommen …« Der Herr blieb unnahbar. »Das können Sie alles auf der Wache erzählen. Ziehen Sie sich an!«
Tilly mischte sich ein. »Wenn ich vielleicht für meinen Freund irgendwie garantieren könnte …« Auf diesen Vorschlag hin hatte der Beamte nur eine abwinkende Gebärde und einen Blick, der mehr gelangweilt als böse war. Ernst hatte damit begonnen, sich anzuziehen. Während er in die Socken fuhr – dicke, gestrickte Wollsocken, mit Löchern an den beiden Stellen, wo die großen Zehen sitzen – wollte er wissen: »Muß ich gleich wieder über die Grenze?« Seine Stimme kam schleppend, sein Gesicht sah sehr grau und müde aus. – »Das werden Sie alles erfahren«, sagte der Beamte.
Ernst stand schon in seinen Kleidern da. Der Beamte erkundigte sich – mehr der Form halber und sehr verächtlich: »Gepäck ist wohl nicht vorhanden?« Ernst schüttelte betrübt den Kopf. Er schien nicht verzweifelt, nicht einmal erregt; nur angewidert und traurig. Was ihm jetzt widerfuhr, war keine Sensation, kein Abenteuer. Er mußte stets damit rechnen, und es war schon gar zu häufig erlebt worden.
Mehr erschüttert war Tilly. Während Ernst schon von ihr fort und zur Türe ging, rief sie ihm flehend zu: »Wenn ich dir nur irgendwie behilflich sein könnte! Bitte, ruf mich an, sowie du weißt, was mit dir geschieht, oder laß mich anrufen!« Er nickte schweigend. Der Beamte deutete durch strenges Räuspern seine Ungeduld an. Tilly – um Ernst nur noch einen Augenblick zurückzuhalten – brachte hervor: »Laß mich bitte nicht ohne Nachricht! Ich warte auf eine Nachricht von dir!«
Der Beamte hatte die Türe geöffnet. Da rief Ernst und versuchte ein Lächeln: »Adieu, Mädchen! Es ist hübsch gewesen! Adieu!« Er hob die Hand, um zu winken. So hebt sie einer, der schon nicht mehr in diesem Zimmer steht, sondern weit entfernt … Der Beamte ließ ihm mit einer etwas schauerlichen Höflichkeit den Vortritt. Hinter ihnen schloß sich die Türe. Und Tilly, die leise aufschrie, begriff: ›Den sehe ich nicht mehr wieder. Auch Nachrichten kommen nicht mehr von ihm. Der ist weg. Den sehe ich nicht mehr.‹
Die Tränen liefen ihr übers Gesicht. Dabei kämpfte sie gegen den Asthmaanfall. – ›Bleibe bei mir! Bitte, geh nicht fort! Ich habe mich so lang nach dir gesehnt – nun darf es nicht so schnell vorüber sein!‹
Ein paar Minuten später ertappte sie sich dabei, daß sie an sich selbst und ihre Zukunft dachte. ›Wahrscheinlich werde ich nun auch ausgewiesen. Nur dem Umstand, daß ich die Ottingers kenne, verdanke ich es, daß er mich nicht sofort mitgenommen hat … Wohin gehe ich dann? Nirgends kriege ich doch Aufenthaltserlaubnis … Meinst du, es ist ein Vergnügen, ohne Paß durch Europa zu ziehen?‹ – Da hörte sie wieder die Stimme ihres Geliebten, der jetzt dem Beamten auf die Wache folgen mußte. Als sie daran dachte, konnte sie sich nicht rühren, vor Erbarmen, Traurigkeit und Liebe.
Eine halbe Stunde später war sie angezogen und verließ das Zimmer, um hinunterzugehen. Mitten auf der Treppe blieb sie stehen. Beinah wäre sie umgesunken. Ihr war übel, alles drehte sich vor den Augen. ›Hoffentlich bekomme ich einen Kaffee‹, war alles, was sie noch denken konnte.
In der Schankstube sah es traurig aus. Alle Stühle waren auf die Tische gestellt, mit den Beinen nach oben. Ein unfrisiertes Mädchen hantierte mit Besen und Tuch. Die Fenster waren weit aufgerissen; eisige, graue Morgenluft kam herein. Trotzdem blieb der Geruch nach altem Zigarrenrauch und vergossenem Bier zäh im Raum.
Nein, sagte die Unfrisierte – der Kaffee war noch nicht gemacht. »Um sieben Uhr wird er fertig sein. Sie können ja warten.«
Vor sieben Uhr hatte Tilly ohnedies keinen Zug nach Rüschlikon. Sie setzte sich hin, um zu warten. ›Was wird die Mutter sagen, wenn ich frühmorgens ankomme? Ich muß mir irgendeine gute Ausrede einfallen lassen, um sie zu beruhigen …‹ Jetzt war sie aber viel zu müde, um die gute Ausrede zu finden.
Das Mädchen, während sie den Staub von den Schränken wischte, bemerkte: »Die Polizei war ja hier.« – Tilly, die Stirn in den Händen, murmelte: »Das habe ich bemerkt.« Ihr war furchtbar krank und elend zumute.
Das Mädchen, den Besen zornig erhoben wie eine Waffe, erklärte: »Sie erwischen immer die Falschen. Unsereiner muß immer dran glauben. Den großen Halunken geschieht nichts. Die kommen durch.« Sie schwang den Besen, als wäre er eine Lanze – ein leichter, tödlicher Pfeil, den die Zürnende der ungerechten Welt ins Antlitz schleudern wollte.
Das Leben hat viele Inhalte, und es bringt mit sich mancherlei Erschütterungen. Niemals wird es nur von einem Ereignis, von einem Umstand bestimmt. Die Emigranten denken nicht immer, nicht ohne Unterbrechung daran, daß sie sich im Exil befinden und ein gewisses Regime in der Heimat hassen oder sogar bekämpfen. Nicht stets und pausenlos können sie »Emigranten im Hauptberuf« sein – es wäre gar zu quälend und übrigens einfach langweilig. Zwar ist ihr Leben weitgehend beherrscht von der einen großen, alles verändernden Tatsache: dem Exil. Indessen hören einige große Gefühle nicht auf, das Menschenherz zu beschäftigen: Ehrgeiz und Liebe, Einsamkeit und Hunger, Freundschaft und die Angst vorm Tode – oder die Sehnsucht nach ihm …
Die Zeit vergeht, im Exil wie zu Hause. Menschen finden sich und verlieren sich; haben Erfolge oder Mißerfolge; werden krank, verfallen Lastern, werden wieder gesund oder sterben; verwelken oder blühen auf.
Meisje zum Beispiel – das ährenblonde Kind halb holländischer, halb deutscher Abkunft; erst als Gärtnerin, dann als Krankenschwester ausgebildet – war aufs erfreulichste erblüht und jeden Tag immer noch ein wenig schöner geworden. Sie hieß nun Frau Dr. Mathes und hatte eine Stellung als Nurse in einem englischen Krankenhaus zu Paris. Dort war auch Mathes als Arzt tätig. Beide hatten kolossales Glück gehabt, sie wurden von allen beneidet. Daß solcher Neid der Freunde und Kollegen sich in durchaus gutmütigen Grenzen hielt, lag daran, daß dies junge Paar sich weiter als besonders brav und hilfsbereit erwies. Auch der Doktor hatte sich entschieden zu seinem Vorteil verändert, unter Meisjens energisch-weiblichem Einfluß. Er sah nun viel adretter und zivilisierter aus; sein Blick war fast nie mehr glasig, und der rotblonde Schnurrbart hing ihm nicht mehr feucht und fransig auf die Oberlippe.
Dr. Mathes und sein Meisje hatten bei der Schwalbe Hochzeit gefeiert; Fräulein Sirowitsch und Nathan-Morelli saßen dabei und tauschten Blicke voll Wehmut. Auch zwischen ihnen war seit längerem von Eheschließung die Rede. Nathan-Morelli – einst spöttisch und beinah unzugänglich – hatte sich derartig an die kluge, ernste Dame gewöhnt, daß er nun seinerseits Wert darauf legte, die Liaison mit ihr zu legalisieren. Nun aber hielt sie es für passend, sich ein wenig rar zu machen und noch etwas zu zieren. Sie stand auf eigenen Füßen, sorgte für sich selber, war auf niemanden angewiesen. Seit dem Frühling 1935 leitete sie einen großen Pressevertrieb – ein Bureau, in dem außer ihr zwei Mädchen und ein junger Mann beschäftigt waren und dessen Funktion darin bestand, die holländischen, französischen, englischen, schweizerischen Zeitungen mit journalistischem oder photographischem Material zu versorgen. Einer der Autoren, mit dem die Sirowitsch regelmäßig zu tun hatte, durch den sie gut verdiente und den sie ihrerseits nicht schlecht verdienen ließ, war Helmut Kündinger.
An der deutschen Tageszeitung, die in Paris erschien, hatte er einen guten Posten. Man schätzte seine gewandte Feder, seinen zugleich soliden und beweglichen Geist; die Artikel, die von ihm stammten, waren beliebt. Besonders wurde Kündingers Ansehen bei den Kollegen dadurch gesteigert, daß auch französische Gazetten sich für seine Beiträge interessierten. Nicht nur in Provinzblättern, sondern auch in Pariser Zeitungen tauchte ab und zu sein Name auf. So weit hatten es nur wenige exilierte deutsche Journalisten gebracht. Übrigens war Kündinger nun auch politisch tätig und galt als Verfasser oder Mitverfasser zahlreicher Broschüren und Manifeste, die entweder im Ausland oder, illegal, im Reiche wirken sollten. Hier war es vor allem Theo Hummler, mit dem er zusammenarbeitete.