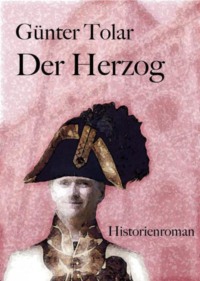Buch lesen: "Der Herzog"
Günter Tolar
DER HERZOG
Historienroman
Allen Menschen gewidmet, die ich in der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe verlor. Es waren 18 Jahre – und sehr viele gute Freunde.
Geschrieben 1989 – 2007
KAPITEL 0
Die Geschichte beginnt so schrecklich trivial. Anfangs der 1980er-Jahre wurde in Wien wieder einmal ein Palais von seinen Vorbesitzern geräumt zwecks gewinnbringender Veräußerung, vermutlich an einen russischen Financier. Bei solchen Aktionen wird natürlich alles Mögliche gefunden, besonders Dachböden sind ein potentieller Fundort längst verschollener Kostbarkeiten. Aber nicht alles, was man da findet, ist auch wirklich gleich als kostbar oder gar wertvoll erkennbar. Unter anderem fand sich da ein mit einer groben gelblichen, ziemlich faserigen Hanfschnur zusammen gebundener Packen von 19 recht dicken, unterschiedlich großen Heften. Genau genommen waren es keine Hefte, sondern grob geheftetes Papier. Die Schnur war mit einer Masche zu gebunden, konnte also leicht geöffnet werden. Die 19 Hefte waren voll beschrieben in einer kleinen und auf den ersten Blick ziemlich unfertig wirkenden Handschrift. Das sei es wohl ein Tagebuch, meinte der Finder, ein Angestellter der professionellen Räumungsfirma. Die Frau, die bei der Räumung dabei war, um vielleicht doch die eine oder die andere Kostbarkeit zu retten, sah sich das Tagebuch kurz an, stellte fest, dass ad hoc nicht einmal genau erkennbar war, von wem und wann es geschrieben worden war – und gab es frei zur Entsorgung. Ein Freund des Autors (oder Herausgebers) dieses Buches ist ein sehr eifriger und neugieriger Nachlass-Stöberer. Er nahm jedenfalls diesen Packen von 19 Heften an sich. Er tat dies mit voller Erlaubnis aller zuständigen Personen und Stellen. Man händigte ihm das Konvolut aus mit der Bemerkung: „Zum Anschauen, und wenn es nichts ist, schmeiß es weg.“
Der Autor hat sich’s angeschaut und kam bald aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Unsere Situation ist nun so einfach, wie sie nur sein kann - und so kompliziert, wie sie nur sein kann.
Das Einfache:
Ein Graf Joseph Moritz von Dietrichstein hat ein Tagebuch hinterlassen. Das Bemerkenswerte an diesem Tagebuch ist, dass wir einen sehr persönlichen Blick auf die ersten 30 Jahre des 19. Jahrhunderts bekommen. Noch bemerkenswerter aber ist, dass das Tagebuch hauptsächlich die Freundschaft und schließlich Beziehung des Joseph Moritz zu einer Figur von höchster politischer Brisanz erzählt: Zum Herzog von Reichstadt.
Das Komplizierte:
Joseph Moritz von Dietrichstein ist eine historisch völlig bedeutungslose Figur, er muss also mehr oder weniger mühsam erklärt werden, damit verständlich wird, wie er überhaupt mit dem Herzog von Reichstadt in einen so engen Kontakt kommen konnte.
Der Herzog von Reichstadt war immerhin eine der hierarchisch und, wenn man das Wort verwenden will, blutmäßig höchstrangig angesiedelte Person, die die Geschichte jemals zu bieten hatte. Eigentlich hieß er Napoléon François Charles Joseph Bonaparte, als (nie als solcher amtierender) Kaiser der Franzosen trug er den Namen Napoleon II. Er war der einzige Sohn Napoleons I. und der Kaiserin Marie Louise. Und diese Marie Louise war immerhin die Tochter des österreichischen Kaisers Franz des I. Der (spätere) Herzog wurde am 20. März 1811 in Paris geboren und noch am Tag seiner Geburt zum ‚König von Rom’ ausgerufen. Napoleon I. ernannte nach seiner Abdankung 1814 seinen Sohn zum Nachfolger. Marie Louise ging mit dem damals dreijährigen ‚jungen Napoleon’ zurück an den Hof ihres Vaters nach Österreich. Am 28. Juni 1815, zehn Tage nach der Schlacht von Waterloo, wurde der Herzog in Abwesenheit von treuen Bonapartisten als Napoleon II. zum Kaiser der Franzosen ausgerufen, aber nach weniger als einer Woche offiziell wieder abgesetzt. 1818 erhielt er das böhmische Herzogtum Reichstadt. 1830, nach dem Sturz König Karls X., hatte der nunmehrige Herzog zwar die Volljährigkeit erreicht, war aber bereits zu stark an Tuberkulose erkrankt, als dass er noch um die Thronfolge hätte kämpfen können. Der Herzog starb am 22. Juli 1832 in Schönbrunn. Sein Nachfolger als Familienoberhaupt der Bonapartes wurde sein Vetter Napoleon III.
Die Frage, die aber unser vorliegendes Vorhaben betrifft, lautet:
Wie kam der unbedeutende Joseph Moritz von Dietrichstein überhaupt zum Herzog von Reichstadt?
Das ist leicht erklärbar. Sein Vater Fürst Moritz Joseph Johann von Dietrichstein-Proskau-Leslie war als Erzieher für den gesamten ‚Bildungsgang’ des Herzogs von Reichstadt bis 1832 zuständig. Vater Dietrichstein war, als er den Herzog ‚übernahm’, vierzig Jahre alt, Generalstabsoffizier, Diplomat, Freund Beethovens und Schuberts, später – nach dem Tod des Herzogs - auch Hofmusikrat und Direktor der beiden Hoftheater.
Seinem ganzen Naturell nach war Dietrichstein als Lehrer und Erzieher mit der Pedanterie ausgestattet, wie sie von ihm verlangt wurde und wie sie Bedingung war für seine Stellung als Erzieher des Königs von Rom und späteren Herzogs von Reichstadt. Metternich selbst traf im Auftrag des Kaisers die Auswahl und hatte zuerst den Grafen Vecchioli vorgesehen. Des Herzogs Mutter Marie Louise und der Kaiser selbst entschieden aber für Dietrichstein. Weil Dietrichstein nicht seine Wahl war, mutmaßt man, dass Metternich die Bedingung der ‚äußersten Pedanterie’ stellte und nicht anstand, für jeden Fehler, den der Zögling machte, den Erzieher zur Verantwortung zu ziehen. Denn eines war klar: Der Zögling machte schon von seiner Herkunft her keine Fehler. Des Erziehers Pedanterie musste also nicht nur eine höchst flexible, sondern auch eine vorauseilende sein. Er musste alle Fehler, Launen, Streiche, Aktionen und Reaktionen des ihm anvertrauten königlichen Blutes vorausahnend abfangen. Dazu musste er gute Gründe vorweisen können, denn der Herzog begann sehr bald zu fragen, warum dies erlaubt und dies nicht erlaubt sei.
Der Herzog hatte aufgrund seiner historisch bedingten Isolation nur wenige Ansprechpartner. Dazu kam, dass er sehr bald bemerkte, dem Grafen Dietrichstein hierarchisch um einiges überlegen zu sein. Er fragte daher ungestüm und forderte die Antworten gleichsam als ein ihm zustehendes Recht, er sah es als Pflicht des Gefragten, nun gefälligst zu antworten.
Wir finden das alles in dem Tagebuch seines Sohnes Joseph Moritz, den 19 mehr oder weniger großen Heften, aus den Spinnweben des alten Dachbodens eines alten Wiener Palais gerettet.
Wir haben es dabei mit zwei ‚Kategorien’ von Tagebuch zu tun. Das eine ist das begleitende Tagebuch, in dem also das Erlebte mehr oder weniger tagtäglich aufgezeichnet wurde. Als zweite ‚Kategorie’ haben wir den Bericht ‚Was vorher geschah’ vor uns liegen. Joseph Moritz begann im Jahr 1831, dem Jahr, in dem er seinen 30. Geburtstag beging und ein Jahr vor dem Tod des Herzogs, alles Bisherige aufzuarbeiten.
In den ersten 2 Kapiteln werden wir vorerst aus dem echten Tagebuch zitieren, um dem geneigten Leser die Möglichkeit zu bieten, sich einzulesen. Ab dem 4. Kapitel beginnt dann die komplette Aufarbeitung der vorangegangenen Jahre durch Joseph Moritz von Dietrichstein.
Alle Einteilungen, die wir hier schildern, sind nicht etwa das Ergebnis von Mutmaßungen oder Spekulationen, sondern entstammen samt und sonders den Notizen des Menschen, der uns jetzt durch zwei Leben führen wird: Sein eigenes und das des Herzogs von Reichstadt.
KAPITEL 1
„Er fragt und fragt“, klagte Vater heute wieder, und das Abendmahl wollte ihm so gar nicht munden. „Er treibt den Foresti schier zur Verzweiflung!"
Der frühere Hauptmann Johann Baptist Foresti war der zweite Lehrer des Herzogs und wurde erster, als der vorherige erste Lehrer Matthäus von Collin im Jahr 1824 gestorben war. Der ‚Franz’ im Folgenden ist übrigens der Herzog von Reichstadt.
„Was will er denn wissen?", erlaubte ich mir zu fragen, wohl wissend, daß der Franz mit purer Absicht so viel fragte und seine Lehrer gerne transpirieren sah.
Vater fuhr auf: „Frag’ Er jetzt nicht auch noch! Ich möcht’ wenigstens daheim einmal nicht dauernd gefragt werden!“
Dann vertiefte er sich doch in die Suppe, die Haut an der Oberfläche wieder, wie er’s immer tut, über den Löffel ziehend, daß es mir ekelte.
Ich muß dem Franz sagen, er soll ihn nicht so quälen, dem Vater schmeckt die Suppe nicht mehr.
Dabei hatte Vater Dietrichstein eine wunderschöne Möglichkeit, sich abzureagieren, seine Musik. Joseph Moritz hat ihn diesbezüglich sehr bewundert.
Es war wundersam, wie er das Thema, das ihn seit einigen Tagen verfolgt hat, oder das vielmehr er seit einigen Tagen verfolgt hat, heute in eine ganz neue Form brachte. Und wieder eigentlich in keine neue Form, sondern in die endgültige. Wie er vor allem ein Seitenthema fand, in so direktem Wege, als wäre es schon seit dem ersten Tage des Auftauchens des Hauptthemas vorhanden gewesen und mußte jetzt nur noch gespielt werden. Ich habe in Florenz halbfertige Statuen des Meisters Michelangelo gesehen. Die halb aus dem Marmor herausgehauenen Figuren geben einem das Gefühl, als wären sie schon immer in dem Stein drinnen gewesen, völlig fertig, der Meister half jetzt nur, sie zu befreien. Und es sah aus, als würden die Figuren selbst fest mithelfen. Sie wirkten, so halb im Stein, so halb aus dem Stein, als wollten sie mit Kraft, ja mit Gewalt dem Künstler in die Hand arbeiten. So wirkte das Thema auf mich, als es mein Vater aus seiner dunklen Vorhandenheit hervorzauberte. Er schrieb es sogleich auf und verwahrte die Noten in seinem Geheimarchiv. Nur ich weiß, daß dort nichts Geheimes zu finden ist, als seine gesammelte Musik.
Einiges aus dem 'Geheimarchiv' wurde später, als Dietrichstein sich beruflich ganz der Musik widmete, aufgeführt. Joseph Moritz aber dürfte die Aufführungen der Werke seines Vaters nicht mehr erlebt haben.
Habe heut’ dem Franz (zur Erinnerung: Franz ist der Herzog) von diesem wundersamen Erlebnis erzählt, woh1 wissend, daß die Kunst nicht das ist, womit er sein Leben zu erfüllen gedenkt.
Seine Antwort aber überraschte mich: „Siehst du, Jomo“, -
‚Jomo‘ ist die vertrauliche Abkürzung von ‚Joseph Moritz‘, die nur der Herzog verwendete, wie, das erfahren wir noch – „da ist etwas entstanden. Und immer sind es die Väter, die etwas entstehen lassen. Deiner und meiner. Meine Musik sind die Schlachtenpläne meines Vaters.“
Dann wollte er läuten, tat es aber nicht, sondern winkte mich in das Bibliothekszimmer. Unter der Türe wartete er auf mich, legte seinen Arm um meine Schulter, drückte sie mit der Hand, preßte mich impulsiv an sich, nur so nebenbei, denn sein Augenmerk war schon auf den Tisch gerichtet, auf den wir zustrebten. Ich spürte dennoch mit vibrierender Aufmerksamkeit seinen schmalen Körper, die Magerkeit, die Härte des Brustkorbes, die Rippen. Ganz im Gegensatz zu der Wärme, die in seiner Bewegung lag und der Wärme, die sein harter, zarter Körper ausstrahlte. Er ist nur ein wenig größer als ich, wirkt aber mit seinen 1 Meter 90 doch wie ein Riese.
Franz wies auf den Tisch, auf dem Pläne ausgebreitet waren, umgeben von ausführlichen Beschreibungen von den verschiedensten Händen. Auf all das deutete er mit großer Geste: „Ich höre Austerlitz, ein faszinierendes Stück Kunst. Genauer geordnet, als je eine deiner Symphonien es sein kann.“
Ich wagte das zu bezweifeln und meinte, das sei doch immerhin Krieg. In Falle Austerlitz' sogar ein stattgefundener Krieg, mit vielen wirklichen Toten.
„Jomo“, belehrte er mich, „jede Änderung in dieser Welt wird durch Krieg vorbereitet. Im nachfolgenden Frieden wird dann das festgeschrieben, was der Krieg entschieden hat. Das Neue, mein lieber Jomo, kommt aus dem Krieg. Der Krieg besteht aus Schlachten. Schlachten muß man gewinnen, wenn man das Nachfolgende mitbestimmen will.“
„Aber dein Vater, Franz“, wollte ich einwenden, wußte aber nicht so recht, ob ich in meiner Freiheit so weit gehen durfte, ihn darauf hinzuweisen, daß Napoleon doch allerhand, und zuletzt alles, verloren hatte und somit auch die Schuld an der jetzigen Situation des Herzogs trug.
„Ich weiß“, unterbrach mich Franz, obwohl ich selber gar nicht weitergeredet hätte, „mein Vater hat zu viel gewollt. Die Geschichte wird ihn zum Größenwahnsinnigen oder zum Großen, ja Größten machen. Die Geschichte wird erst einmal aufgeschrieben, dann bewertet, du weißt."
Ob Joseph Moritz diese weitschauende Aussage des Herzogs wirklich verstand, gibt er uns nicht preis. Seine Beschreibung widmete sich stets mehr dem Menschlichen zwischen den Beiden. So gelingt es Joseph Moritz im folgenden Absatz sehr schnell, die Schilderung des sachlichen Gespräches in den Bereich des dabei Gefühlten hinüber gleiten zu lassen.
„Er war zu genial.“
Franz lächelte jetzt.
Und er wiederholte: „Er war genial.“
Er sagte es mit der Pedanterie, die mich an meinen Vater erinnerte. Es war seiner feinen Aufmerksamkeit für die Sprache nicht entgangen, daß man zwar genial sein konnte, aber nicht genialer und nicht zu genial.
Im Lächeln seufzte er wie unter schwerer innerer Last.
„Sein Wollen, sein Können, reichten aus für zwei, für mehrere Leben.“
Dann hielt er inne. Ich sah von der Seite, daß eine Träne über seine rechte Wange lief. So nahe waren seine Empfindungen beisammen, eben hat er noch gelächelt, und schon hat ihn die Liebe zu seinem Vater, den er nie gekannt hat, berührt. Franz sah mich an, wollte sprechen, konnte nicht gleich, hielt still, um sich zu fassen.
Es war eine Zeit, in der Männer, Jünglinge, sich nicht schämten, auch einmal zu weinen. Wie viele „heiße Tränen“ wurden in der Zeit der Romantik auch von Männern vergossen…
Ich kann nicht, wie Vater mein Empfinden in Musik fassen. Ich kann nicht Fassung erringen durch die Kunst. Ich kann nicht dichten, was ich wahrhaftig empfinde, ich schreibe es nieder, aber es bringt mir keine Fassung. Collin dichtete Empfundenes. So viel, wie der dichtet, kann er gar nie empfunden haben. Welch ein Überfluß aber doch! Mein Vater atmet tief ein, geht in sich, und macht Ordnung in allem, worin er lebt, auch in dem, was er empfindet. Da wird dann Musik draus. Wie aber soll aus meinen Tränen, die den Polster tränken, Musik werden? Oder ein Kunstwerk? Wie kann ich Tränen formen?
Eine schwere Last von Empfindungen, zu deren Ordnung ihm, wie er meinte, die Gabe fehlte - und er litt unter dem vermeintlichen Wissen, seiner Empfindungen nie Herr werden zu können. Er schrieb auf, was er erlebte und brachte es in eine Fassung, die ihm selber fehlte. Denn es war der tödliche Irrtum des Joseph Moritz, nicht zu erkennen, dass das, was er da schrieb, die Fassung war, die er suchte.
Bald aber hatte Franz wieder sein Innerstes beruhigt und sagte leise: „Schreib’ ein Musikstück, Jomo. Mach’ ein Gedicht. Du kannst das. Ich beneide dich. Denn ich -“, er hielt noch einmal inne, sodaß ich erkannte, daß hier die Wurzel seines augenblicklichen Schmerzes lag, „- ich werde wohl nie eine Schlacht schlagen.“
Damit umarmte er mich und legte seinen Kopf an meine Schulter; ein heftiges Schluchzen schüttelte ihn. Ich konnte nicht anders, ich weinte ebenfalls, ihn fest an mich drückend. Den armen, mageren, sinnlosen Thronfolger auf niemandes Thron.
Einer erkannte den anderen genau, aber keiner erkannte sich selber. Beide waren sie Söhne von Vätern, die ihren Kindern keine Chance ließen, der Herzog in der historischen Vollkommenheit Napoleons, die abschließend und für alle Nachkommen tödlich war, Joseph Moritz durch vorgelebtes wohlgeordnetes, vollkommenes Innen- und Außenleben eines kompletten Vaters. Zwei empfindsame junge Männer waren sie, denen niemand half, ihr Leben zu bewältigen. Es waren ihnen nur die Handgriffe beigebracht worden, die man tätigen musste, wenn die Äußerlichkeiten des Tagesablaufes eine Handlung verlangten. In sich hatte jeder der beiden seine eigene Traurigkeit. Die eigenen Gedanken fanden keinen anderen gemeinsamen Ausdruck, als die Traurigkeit. Diese Traurigkeit, die dann bewusst und quälend fühlbar wurde, wenn die Verlassenheit des Einzelnen ihre kalten Ringe um sie legte.
Franz löste sich, wischte eine Träne aus seinem Gesicht, lächelte, als er meine Tränen sah, wischte sie mit der anderen Hand zart aus meinem Antlitz, dann sagte er: „Wir zwei. Was soll aus uns werden?“
Ich verließ Franzens Gemächer auf dem gewohnten Weg, ging nach Hause, suchte in der Bibliothek meines Vaters nach einem Dichter, der mir eine Form oder eine Sprache vorzugeben imstande war. Ich habe schon so oft gesucht und wie jedes Mal fand ich auch diesmal keinen. Also verschreibe ich mich dir, meinem Tagebuch.
Man hätte dem Joseph Moritz sagen müssen, dass Gedichte vielleicht gar nicht diese Aussagekraft gehabt hätten, wie sie sein Tagebuch bietet. Joseph Moritz wusste wirklich nicht, was für ein guter Schreiber er war, als er dieses sein Tagebuch schrieb. Niemand hat es zu seinen Lebzeiten gelesen, wer also hätte es ihm sagen können?
Joseph Moritz schreibt, er habe die Gemächer des Herzogs auf dem ‚gewohnten Weg‘ verlassen. Wir kennen die Gemächer des Herzogs, aber wir wissen nur sehr ungefähr, wo Joseph Moritz auf der Straße landete, wenn er den Herzog verließ. Wir kennen aber überhaupt nicht den Weg, den er innerhalb der Hofburg genommen hat. Er wird wohl immer ein Geheimnis bleiben, blieb er doch auch dem Erzieher, den Lehrern, ja sogar Metternich und seinem Wachapparat verborgen. Nicht einmal ein historisch wirklich gebildeter und gut informierter Museumsführer war in der Lage, diesen Geheimweg zu rekonstruieren.
Ich war um einige Minuten später als sonst in Franzens Gemächer geeilt. Der *** war nicht zur Minute da. Franz war zutiefst beunruhigt.
Wer dieser *** ist, erfahren wir noch, wer allerdings dahinter verborgen ist, erfahren wie von Joseph Moritz selber nie. Wir können es aber ahnen. Doch davon später.
„Wenn sie dich erwischen, dann...“
„... Gnade uns Gott“, vollendete ich.
„Gnade dir Gott“, wies er mit dem Finger auf mich, mit tiefer Unruhe und bleichem Antlitz.
„Aber wer weiß“, und er hielt inne, nachdenklich vor sich hinschauend, „ein dichtes Netz kann auch schützen.“
Dieser zusammenfassende Einblick in das Tagebuch des Joseph Moritz von Dietrichstein sollte uns ein wenig die Methodik zeigen. Die Vertiefung folgt erst, wenn wir chronologisch vorgehen.
KAPITEL 2
Joseph Moritz wurde aus beruflichen Gründen oft auf Reisen geschickt. Die wirtschaftliche Expansion drängte nach Süden, sehr zum Gefallen des Joseph Moritz, der viel lieber nach Süden als nach Norden reiste. Wenn ihn eine Reise gar noch in ein Land führte, in dem Kunst zu sehen war, war die Unannehmlichkeit der langwierigen Anreise und der oft sehr langweiligen Handelsgespräche mehr als aufgehoben.
Am schönsten ist die Kunst dort, wo sie gemacht wird. Und am allerschönsten ist sie, wenn sie so beschaffen ist, daß sie nur dort und nirgends anders gemacht werden kann.
Joseph Moritz führte selbstverständlich auch auf diesen Reisen sein Tagebuch.
So stand ich auf der Piazza della Signoria vor dem Palazzo Vecchio in Florenz. Die vielen schönen Menschen. Die vielen schönen Statuen. Nackt. Hier denke ich innig an dich, Franz, der du dies hoffentlich niemals lesen wirst. Ich halte Zwiesprache mit dir angesichts der vielen Schönheit, die sich hier so unverhüllt zeigt. Freiheit, die nichts Wildes, nichts Ungezogenes und nichts Verbotenes hat. Freiheit, die so herrlich erlaubt ist. Die Freiheit, die wir beide, Franz, nicht haben.
Ich erröte bei dem Gedanken, daß du dies jemals lesen würdest.
Und doch...
Der Herzog wusste allerdings von der Existenz dieses Tagebuches.
Im Spätherbst 1829 finden wir eine Notiz, die das bestätigt.
„Joseph Moritz“, mahnte mich der Franz heute - er nennt mich immer beim ganzen Namen, wenn er besonders scherzhaft oder besonders ernst sein will - „du hast die letzte Zeit wohl mehr mit deinem Tagebuch gesprochen als mit mir.“
Dieses Gespräch fand statt zu einer Zeit, in der der Kontakt zwischen den Beiden abgerissen und eben wieder in Gang gekommen war.
Ich bin erschrocken.
„Woher weißt du?“, fragte ich.
„Du selbst hast es mir erzählt“, lächelte er und strich mir mein Haar aus der Stirn, das ich französisch nach vorne trug.
„Wann habe ich dir das erzählt?“
Ich kann mich wirklich nicht erinnern.
Er aber lachte jetzt fast: „Soeben hast du es mir erzählt. Du hast mir nicht widersprochen!“
Die Röte schoß mir ins Gesicht, ich stieß ihn weg von mir. Er aber zog mich wieder zu sich heran, drückte mein ihm zugewandtes Ohr fest an seinen Mund und flüsterte: „Du bist der Mensch für ein Tagebuch. Du hast zu viele Gedanken, die man nicht aussprechen kann und zu viele Geschichten, die du niemand erzählen kannst. Habe ich recht?“
Anstelle einer Antwort drückte ich ihn so fest an mich, daß mein Herz zerspringen wollte vor lauter Klopfen. Aber ich wußte schon, es wird nicht zerspringen, nicht wenn es vor Freude klopft.
Im Kommenden finden wir sehr überraschend die Situation geschildert, in der sich die Beiden bei dem Gespräch befanden.
Mit einmal aber löste sich der Franz von mir, verließ unser Lager, wandte sich, kaum draußen, zu mir um und antwortet meinem wohl staunenden Blick: „Man muß aufhören können. Eine Tugend, die mein Vater nicht hatte.“
Schnell und geübt im Ankleiden war er sogleich wieder ganz Herzog im Privatgemach.
So blieb mir die beschämende Rolle, mich vor dem Franz nun meinerseits zu restaurieren. Er sah mir dabei so frech lachend zu, daß ich mich abwenden mußte, um nicht vor Scham zu vergehen. Wenn ich mich nach meinen Beinkleidern bücken mußte, wurde mein Ansatz zu einem Bäuchlein allzu deutlich sichtbar. Ich wendete mich also genau so weit ab, bis ich die Sicherheit wähnte, daß er meinen wunden Punkt jetzt nicht mehr sähe.
„Auch schön“, klang es da hinter mir mit höchst vergnügter Stimme.
Ich blickte hinter mich und sah eben noch, wie der Herzog von Reichstadt meinem Hinteren eine Grimasse zuschnitt.
Joseph Moritz hat mehrmals in seinem Tagebuch gebeten, ihn durch die Preisgabe, also Veröffentlichung, allzu intimer Details nicht bloßzustellen. Es wird da immer wieder die Doppelseitigkeit von Joseph Moritz‘ innerer Einstellung zu seinen Notizen sichtbar. Einerseits ist das Tagebuch für niemandes Lektüre bestimmt. Andrerseits drängt es den Verfasser, sich so mitzuteilen, dass ein anderer ihn versteht. Und wer anders sollte das denn sein, als ein späterer Leser?
Der Franz aber, der ‚dies nie lesen‘ würde, bekam in Florenz einiges ‚mitgeteilt‘, voll aus dem sicheren Wissen heraus, dass er dies wirklich nie lesen würde. Er war auch so, er hat dieses Tagebuch nie gelesen. Zu viel Tod auf einmal verhinderte dies.
Wir sind noch immer in Florenz.
Ich kann ja sein, wo ich will, überall bist du mir gegenwärtig. Alles, was ich denke, denke ich durch deine Gedanken hindurch. So dachte ich an dich, Franz, beim Anblick des wunderschönen David, den Michelangelo vielleicht auch nach einem Vorbild gestaltet hat. Nach einem lebenden Vorbild, meine ich. Ich bin aber der festen Überzeugung, daß es ein so schönes Vorbild gar nicht gibt. Ein lebendes. Auch nicht gegeben hat. Das Gesicht vielleicht. Ich möchte damit nicht sagen, daß Davids Gesicht nicht schön sei, aber es hat so etwas Unheroisches, Privates, so gar nicht Nacktes. Da schaut einer, die Stirne runzelnd, auf den wunderschönen, schon fertigen nackten Körper einer Statue, deren Kopf noch nicht herausgehauen ist, und fragt: „Da soll mein Kopf drauf? Na schön!“
Michelangelo hat genau den Augenblick festgehalten, festgemeisselt und auf Davids Körper gesetzt. Das Kunstwerk, das genau den Abstand in sich birgt, der sich in einer Frage ausdrückt: „Mein Kopf auf diesen herrlichen Körper? Na schön!“
Anmaßung und Resignation.
Es sind ja deine Worte, Franz, die David da zu mir spricht. Und du bist es auch, der da vor mir steht. Nicht leiblich und auch nicht in Marmor, sondern dem ganzen Wesen nach. Die Vollendung, der Zweifel, die Ironie, der Humor, das Lächeln, die Gleichgültigkeit der Nacktheit... und alles in und aus meiner Liebe zu dir.
Anlässlich eines gemeinsamen Museumsbesuches hat Joseph Moritz dem Herzog von diesen seinen Empfindungen beim Anblick des David in Florenz erzählt. Es ist dies übrigens die einzige Erwähnung eines gemeinsamen kulturellen ‚Ausganges‘.
Die Replik des Herzogs zeigt seine wesentlich weniger von Ästhetik getragene Einstellung der Kunst und dem in ihr Dargestellten gegenüber.
... Franz fügte dem von mir als Florentinische Empfindung vorsichtig geschilderten Gedankenbild seinen eigenen Anhang hinzu: „Stell dir vor, ich, nackt auf diesem Sockel, mit meiner Gestalt und meinem langen - du weißt schon - in Florenz. Ich weiß nicht, ob die Leute mehr oder weniger hinschauen würden.“
Dann wies Franz auf eine nackte Männerstatue, die in einer Nische stand, und flüsterte: „Die Pimmel der Statuen sind alle so kurz und so fest."
Er dachte nach und fügte dann ganz ernst hinzu: „Das liegt wohl am Marmor. Der ist kalt. Und kalt zieht zusammen!“
Bei den letzten Worten stieß er mich unmerklich vertraulich an.
Ich war nicht wenig echauffiert ob der Kühnheit des Franz, so Intimes so keck in der Öffentlichkeit herauszusagen. Ich erinnerte mich aber auch der manchmal sehr mangelhaften Beheizung der Gemächer des Franz.
Diese Unterhaltung führten wir so, daß es für die anderen nach einem angeregten künstlerischen Diskurs aussehen mußte; zwei Schritte hinter uns war nämlich der Foresti; der war allerdings höchst unaufmerksam und auch gar nicht sonderlich angetan von den ausgestellten Kunstwerken, die der Franz zu besichtigen gewünscht hatte.
Es war uns halt eine Lust, öffentlich zu tändeln und niemand sieht’s.
Joseph Moritz und der Herzog trafen einander also auch manchmal offiziell und öffentlich. Es mag ihnen eine diebische Freude gemacht haben, ganz nahe an der möglichen Entdeckung ihres ‚Geheimnisses‘ zu wandeln, zu spielen, zu ‚tändeln’.
Der Herzog von Reichstadt hatte, trotz der strengen Etikette, die das Leben des Sohnes von Napoleon und Enkels Franz des I., einer hochnotpeinlichen Figur von historischer Brisanz, unterliegen musste, auch ein Privatissimum. Es wäre jetzt abgeschmackt, mit moralistisch gerunzelter Stirn die Frage zu stellen, warum sich dieses Privatissimum justament zwischen zwei Männern begab. Wie hätte die Sache denn ausgesehen, wenn anstelle des Joseph Moritz ein Mädchen gewesen wäre? Sie hätte gar nicht, wie Joseph Moritz, zehn Jahre älter als der Herzog sein müssen. Ein ‚aufgeflogenes‘ Verhältnis des Herzogs mit einer Frau, wäre einer Katastrophe gleichgekommen. Eine Männerfreundschaft hingegen war normal. Man könnte vielleicht fragen, warum niemand bemerkt hat, dass das mehr war als eine Männerfreundschaft. Damals hat niemand gefragt. Und wenn? Metternich allein hätte die Größe der ‚Katastrophe‘ festgelegt. Der Kaiser wäre vielleicht damit befasst worden; er hätte wahrscheinlich abgewunken. Skandale, die geheim bleiben, sind keine Skandale. Der junge Dietrichstein? Ein netter, begabter, tüchtiger junger Herr. Wenn der Herzog schon Gesellschaft pflegte, von der niemand wusste, dann hätte es schlechtere sein können. Der Kaiser hätte vielleicht zu höherer Aufmerksamkeit gemahnt - und hätte die Dinge laufen lassen. Die Zusammenkünfte der beiden wären dann wohl dem offiziellen Terminkalender des Herzogs einverleibt worden, hätten also das Flair des Geheimen, Privaten, Intimen verloren. Denn es waren ja die im Kalender des Herzogs vorgeschriebenen Mußestunden, in denen das Privatissimum stattfand, geheim, unter Umgehung der Wache, umgeben von dem, vom Herzog selbst zitierten, ‚Netz, das auch schützt‘.
Anders mochte die Situation auf Joseph Moritz‘ Seite aussehen. Seine Liebe zum Herzog ist sehr tief gegangen, jedenfalls tiefer, als es zwischen Männern üblich ist. Seine Liebe entspringt aus dem Romantischen, jenem Teil der Psyche also, der das Blut in Wallung bringt, zum Sieden, der Gedanken abschaltet und Körper zu einander zieht. Joseph Moritz entwickelte allerdings sehr bald auch ein, man würde heute sagen, von Sex gesteuertes Verhalten. Sex, der einmal dem rein Körperlichen diente und auch von dort gefordert wurde, und der, allerdings nur mit dem Herzog, aus der Liebe kam.
Seine eigene Rolle schildert Joseph Moritz in seinem Tagebuch mit immer mehr Offenheit, die bald jedwede Selbstschonung fallen ließ. Wie es allerdings mit dem Herzog wirklich stand, können wir nur versuchen, aus den Schilderungen des Joseph Moritz geschmackvoll und möglichst gerecht zu deuten. Wir haben, was diesen Teil des Lebens des Herzogs von Reichstadt betrifft, keine andere Quelle, als das Tagebuch des Joseph Moritz von Dietrichstein. Und der war, die vorigen Zitate haben es schon gezeigt, offensichtlich auch ein Dichter. Oft ohne es zu wissen, oft aber auch, weil er es so wollte. Er überlässt es unserer Auslegung, wo die Wirklichkeit aufhört und die Dichtung anfängt. Wenn er uns überhaupt Hinweise gibt, dann in begleitenden Worten, nie aber in der Schilderung eines Vorganges.
Der Dichter manifestiert sich ganz deutlich in der weiteren Schilderung aus Florenz.
Es mag ja vielleicht auch der rote Wein sein, dem ich hier in erhöhtem Maße zuspreche und der mich auf solche Gedanken bringt. Ich will aber nicht sagen, daß es nur der Wein sei, der mich an dich denken läßt, Franz. Ich weiß, daß du mich jetzt fragen würdest: „Denkst du immer nur dann an mich, wenn du trinkst?“
Aber vielleicht hättest du diese Frage gar nicht gestellt. Vielleicht ist es dir ganz und gar gleichgültig, ob ich an dich denke, oder nicht. Wahrscheinlich wäre es dir lieber, wenn deine Mutter mehr an dich dächte. Oder daß dein Vater noch lebte, daß er an dich denken könnte. Aber so, ohne Vater, ohne Mutter, wohin geht denn deine Liebe? Zu mir?