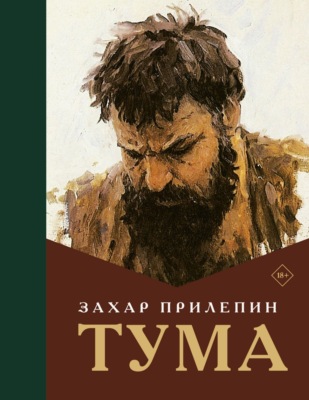Buch lesen: "Im Garten der Liebe"
Im Garten der Liebe
Barbara Cartland
Barbara Cartland E-Books Ltd.
Vorliegende Ausgabe ©2017
Copyright Cartland Promotions 1985
Gestaltung M-Y Books
1 ~ 1870
Der Herzog von Mortlyn wachte mit trockener Kehle und Kopfschmerzen auf. Das ärgerte ihn, denn er wußte, daß gestern abend auf Lady Bramwells Dinnerparty Champagner und Rotweinmarken serviert worden waren, die er seinen Gästen niemals zugemutet hätte.
Noch wütender machte es ihn, daß Lord Bramwell trotz seines Reichtums ein so schlechter Gastgeber war; und Lady Bramwell verfügte offenbar nicht über den nötigen Sachverstand - welche Frau hatte den schon? - um ihren Gästen erlesene Getränke zu kredenzen.
Obwohl es eine langweilige Party gewesen war, hatte er bis zum Schluß ausgeharrt, weil Doreen Bramwell ihm in einem unbewachten Augenblick zugeflüstert hatte, sie müsse etwas mit ihm besprechen, sobald die Gäste gegangen wären.
Der Herzog war erfahren genug, um sich zusammenreimen zu können, worum es ging, und er war mit sich ins Gericht gegangen, ob er gehen oder bleiben sollte.
Da sie jedoch zweifellos eine der schönsten Frauen der ganzen Gesellschaft war, hatte er schließlich ihrem flehenden Blick nachgegeben.
Und wirklich: Kaum waren die letzten Gäste gegangen, hatte sie ihn leidenschaftlich umarmt und ihm die makellos geformten Lippen zum Kuß geboten, und er hatte sich in das Unvermeidliche geschickt.
Jetzt stellte er ärgerlich fest, daß sein Kammerdiener ihn zwar um sieben Uhr geweckt, dann aber hatte weiterschlafen lassen, so daß er seinen morgendlichen Ausritt durch den Park versäumt hatte.
Während er nun seine müden Glieder reckte, faßte er den Entschluß, nicht wieder bei Lady Bramwell vorzusprechen, auch wenn sie das von ihm erwartete.
Es war eine leidenschaftliche Liebesnacht gewesen, die ihm alles geboten hatte, wonach der Körper eines Mannes verlangte, und doch hatte sie ihm nichts Neues gebracht.
Da der Herzog blendend aussah, zudem unermeßlich reich war und den Kreisen der Gesellschaft angehörte, die der königlichen Familie am nächsten standen, war er von Frauen umgarnt, verfolgt und gejagt worden, seit er Eton College verlassen hatte.
Mit seinen dreiunddreißig Jahren war er noch immer unvermählt, doch die ständigen Mahnungen und Bitten seiner Familie, sich doch endlich eine Gemahlin zu suchen, verhallten ungehört.
Er war zutiefst davon überzeugt, daß eine Ehe für ihn zwangsläufig in tödlicher Langeweile enden würde. Spätestens zwei Monate nach der Trauung rechnete er mit diesem Zustand.
»Ich bin glücklich und zufrieden mit meinem Leben«, hatte er gestern noch zu seiner Großmutter gesagt, die ihn wieder einmal ermahnt hatte, endlich für einen Stammhalter zu sorgen.
»Alles gut und schön, Wade«, hatte sie erwidert, »aber du weißt genauso gut wie ich, daß der Titel auf keinen Fall deinem mißratenen Cousin Giles in den Schoß fallen darf.«
»Natürlich nicht«, hatte der Herzog ihr beigepflichtet, »aber noch bin ich nicht im Greisenalter, und wenn es an der Zeit ist, werde ich bei meinem sprichwörtlichen Glück dafür gesorgt haben, daß dir mehrere Urenkel beschert werden.«
»Ich will sie aber gleich haben«, hatte die Herzoginwitwe eigensinnig entgegnet und den Herzog zum Lachen gereizt.
Der Herzog begab sich zum Fenster.
Die Sonne strahlte über den Bäumen im Park, und kein Wölkchen war am Himmel zu sehen.
Der Herzog stellte sich vor, wie die Schwäne auf dem Teich vom Mortlyn majestätisch ihre Bahn zogen, wie die farbenprächtigen Blumengärten in üppiger Blüte prangten und die Wälder wie ein dichter, geheimnisvoller Wall den Herrensitz umgaben.
»Ich werde aufs Land fahren«, entschied er und läutete seinem Diener.
Eine halbe Stunde später beendete er unten gerade sein Frühstück mit einer Tasse Kaffee, als die Tür aufging und sein Privatsekretär erschien.
Mr. Watson, ein äußerst fähiger Mann, zuverlässig und intelligent, stand in seinen Diensten, seit er nach dem Austritt aus der Armee den Adelstitel übernommen hatte.
Er war der einzige Mensch, dem der Herzog bedingungslos vertraute.
»Ich bitte um Vergebung, Euer Gnaden stören zu müssen«, sagte Mr. Watson, »aber da ist eine Angelegenheit, die Eure Aufmerksamkeit erfordert.«
»Was gibt’s?« fragte der Herzog uninteressiert und fügte, seinem eigenen Gedankengang folgend, hinzu: »Schicken Sie Lady Bramwell das übliche Blumenbukett, und teilen Sie ihr mit, daß ich ihrer Einladung für heute abend bedauerlicherweise nicht Folge leisten könne, weil ich aufs Land fahre.«
Mr. Watson machte sich eine Notiz und hob dann fragend die Brauen.
»Wollen sich Euer Gnaden tatsächlich nach Mortlyn begeben?«
»London langweilt mich«, erwiderte der Herzog. »Mittlerweile müßten die Pferde, die ich letzte Woche gekauft habe, eingetroffen sein, und ich möchte sie ausprobieren.«
»Sehr wohl, Euer Gnaden. Ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen. Vermutlich wollt Ihr im Phaeton reisen?«
»Allerdings«, erwiderte der Herzog, »mit dem neuen Fuchsgespann.«
Er wollte sich erheben, da fiel ihm noch etwas ein.
»Welche Angelegenheit erfordert meine Aufmerksamkeit, Watson?«
»Es handelt sich um Mortlyn.«
Der Herzog runzelte die Stirn.
»Nichts Unangenehmes, hoffe ich!«
Mortlyn, der Sitz seiner Ahnen, lag ihm sehr am Herzen; er liebte den riesigen georgianischen Herrensitz, dessen Palast von zwanzigtausend Morgen Land umgeben war. Der Herzog rühmte sich, jeden Winkel dieses stattlichen Besitzes, der seinesgleichen im ganzen Land suchte, zu kennen.
»Wie ich Euer Gnaden vergangene Woche mitteilte«, sagte Mr.Watson, »ist der Vikar von Mortlyn verstorben.«
»Ja, ich erinnere mich«, bemerkte der Herzog. »Sie haben doch einen Kranz geschickt, nicht wahr?«
»Natürlich, Euer Gnaden, und ich wollte Euch bitten, Miss Linton, der Tochter des Vikars, ein Häuschen auf Eurem Besitz zur Verfügung zu stellen.«
Der Herzog sah seinen Vertrauten erstaunt an, dann sagte er: »Es wäre sicher möglich, obwohl das eigentlich nicht üblich ist.«
»Mr. Hunter, der sich, wie Euer Gnaden sich erinnern werden, um die Altenheime, die Pensionäre und die Siedlungen kümmert, hat den ,Taubenschlag‘ vorgeschlagen.«
»Den Taubenschlag?« wiederholte der Herzog erstaunt. »Wie kommt Hunter denn darauf?«
»Er hält das kleine Landhaus für sehr geeignet, Euer Gnaden.«
»Für eine Pfarrerstochter?« rief der Herzog entgeistert aus. »Das scheint mir doch ein höchst unpassender Vorschlag zu sein.«
Der Taubenschlag war ein wunderhübsches Landhaus, das er sehr mochte. Es war klein, aber eines der ältesten und stilvollsten Bauten des gesamten Besitzes.
Ursprünglich war es als Auszugshäuschen vorgesehen, hatte sich aber für die Herzoginwitwen als zu klein erwiesen. Während der Regentschaft George IV. hatte, man ihnen ein geräumigeres Gebäude hergerichtet.
Der Herzog erinnerte sich daß eine seiner Großtanten bis zu ihrem Tod im Taubenschlag gewohnt hatte. Seitdem stand der Taubenschlag leer, war aber zweifellos weiterhin gepflegt und instandgehalten worden.
Die Idee, jemand aus dem Dorf sollte dieses Haus bewohnen, kam ihm reichlich vermessen vor.
»Welche besonderen Verdienste könnten diese Pfarrerstochter befähigen, im Taubenschlag zu residieren?« fragte er.
Mr. Watson zögerte und suchte offensichtlich nach den richtigen Worten, um es ihm zu erklären.
»Sie hat sich der Pflege und Instandhaltung des Heilkräutergartens angenommen, Euer Gnaden«, sagte er dann.
»Wäre das nicht eigentlich die Aufgabe der Gärtner gewesen?« entgegnete der Herzog befremdet.
»Sie hätten nicht über das Wissen verfügt, das Miss Linton sich erworben hat.«
»Und nur weil sie an dem Heilkräutergärtchen interessiert ist, das ich zugegebenermaßen seit Jahren nicht mehr besichtigt habe, steht ihr Ihrer Meinung nach ein Haus wie der Taubenschlag zu?«
Mr. Watson bewegte sich unruhig und zeigte zum Erstaunen des Herzogs zum ersten Mal, seit er ihn kannte, so etwas wie Unsicherheit und Nervosität.
»Heraus mit der Sprache, Watson«, forderte er ihn auf. »Sagen Sie mir die Wahrheit. Was steckt dahinter?«
Mr. Watson lächelte verlegen wie ein ertappter Schulbub.
»Die Wahrheit ist, Euer Gnaden«, sagte er, »daß Miss Linton im Dorf gebraucht wird.«
»Was macht sie denn so unentbehrlich?« wollte der Herzog wissen. »Unterrichtet sie an der Sonntagsschule und besucht die Alten und die Kranken? Gütiger Himmel, Watson, in einem so kleinen Dorf kann es davon doch nicht viele geben!«
»Es gibt sehr wenige, Euer Gnaden, und das ist Miss Lintons Verdienst.«
»Was wollen Sie damit sagen? Das verstehe ich nicht!« entgegnete der Herzog unwillig.
Wieder hatte er das Gefühl, daß ausgerechnet der geradlinige Watson sich vor einer klaren Aussage drückte.
Um seinen Sekretär herauszufordern, fuhr er nicht ohne Schärfe fort: »Ich habe keineswegs die Absicht, den Taubenschlag irgendeiner langweiligen Betschwester zu überlassen, damit sie im Wohnzimmer Bibelstunden abhalten kann.«
Dabei stellte er sich das kleine Haus mit den bleigefaßten bunten Glasscheiben, der niedrigen Balkendecke und den zauberhaften Stilmöbeln vor, und die Erinnerung daran bestärkte ihn in seiner Ablehnung.
»Das trifft auf Miss Linton ganz gewiß nicht zu«, lautete Mr. Watsons Erwiderung. »Es gibt wohl weit und breit keinen Menschen, der so beliebt und so gefragt ist wie sie.«
»Warum?« fragte der Herzog.
»Weil sie die heilsame Wirkung von Kräutern genau kennt, Euer Gnaden, und wenn sich einer der Dorfbewohner verletzt hat oder wenn er krank ist, dann geht er zu ihr, wie vorher zu ihrer Mutter, als diese noch lebte, und wird geheilt. «
Mr. Watson holte tief Luft, als müßte er für das, was er noch hinzufügen wollte, seinen ganzen Mut zusammennehmen: »Sie wird von den Leuten als weiße Hexe verehrt, Euer Gnaden.«
»Gütiger Gott!« entfuhr es dem Herzog. »Wollen Sie mir etwa weismachen, daß es in unserem Zeitalter noch Menschen gibt, die an Hexen glauben?«
»Ich habe weiße Hexe gesagt, Euer Gnaden, denn wo die Kunst der Ärzte versagt, entwickelt Miss Linton geradezu magische Heilkräfte.«
Der Herzog lehnte sich zurück.
»Vermutlich«, sagte er gedehnt, »hängt das damit zusammen, daß sich auf dem Lande alter Aberglaube länger hält und die Leute sich aus Mangel an Abwechslung alle möglichen verrückten Dinge einbilden, über die man sich anderweitig nur lustig macht.«
»Ich glaube kaum, daß sich irgendjemand jemals über Miss Linton lustig gemacht hat.«
Der Herzog horchte auf. Daß sich sein Privatsekretär derart für jemanden ins Zeug legte, war ungewöhnlich, pflegte er doch sonst mit seinem Lob über andere noch sparsamer umzugehen als sein Herr.
»Ich will Ihnen sagen, was ich tun werde, Watson«, faßte der Herzog deshalb einen Entschluß. »Da ich ohnehin vorhatte, mich nach Mortlyn zu begeben, werde ich Miss Linton persönlich aufsuchen und dann entscheiden, ob ich sie für würdig befinde, eines unserer Häuschen zu bewohnen.«
»Euer Gnaden werden gewiß die richtige Entscheidung treffen«, entgegnete Mr. Watson und machte damit deutlich, daß er nach wie vor den Taubenschlag für die geeignetste Unterkunft hielt.
Beim Herzog rief das so etwas wie eine Trotzreaktion hervor. Niemals würde er irgendeiner faden Pfarrerstochter erlauben, sich dort häuslich niederzulassen, nahm er sich fest vor.
Er wollte das Frühstückszimmer gerade verlassen, als Mr. Watson ihm hastig nachrief: »Da wäre noch etwas, Euer Gnaden!«
»Was denn noch?« fragte der Herzog.
»Mr. Pearce, Euer Gnaden Rechnungsführer, beauftragte mich, Euch davon zu unterrichten, daß Mr. Digby in den vergangenen zwei Wochen Schecks über nicht weniger als viertausend Pfund eingelöst hat.«
»Viertausend Pfund! Was, zum Teufel, hat der Bursche damit vor?«
Er erwartete darauf keine Antwort von Watson, denn er wußte es auch so. Sein Neffe Oliver Digby, der Sohn seiner älteren Schwester, war in Liebe zu einer bildhübschen, aber sehr anspruchsvollen Salonschönheit entbrannt, die es verstand, ihren Verehrern das Geld sehr schnell aus der Tasche zu locken.
»Viertausend Pfund sind entschieden zu viel«, stellte der Herzog bei sich fest.
Er begab sich in die Halle, blickte noch einmal über die Schulter zurück und sagte in scharfem Ton: »Schicken Sie einen Stallknecht zu Mr. Oliver, und lassen Sie ihm ausrichten, daß ich ihn unverzüglich zu sprechen wünsche!«
»Sehr wohl, Euer Gnaden.«
Der Herzog begab sich in sein stilvoll eingerichtetes Arbeitszimmer im Erdgeschoß, von dem aus die Gärten hinter dem Haus einzusehen waren. Es war mit unzähligen Büchern und einer Sammlung von Jagdbildern an den Wänden ausgestattet, um die der Herzog von seinen Freunden beneidet wurde.
In seinem Arbeitszimmer nahm er hinter seinem geräumigen Schreibtisch Platz, auf dem ein Stoß Briefe auf seine Unterschrift wartete.
Eine steile Falte hatte sich auf seiner Stirn gebildet.
Ohne Zweifel war Oliver zu einem Problem geworden.
Er hatte seiner Schwester Violet, die ihrem Gemahl nach seiner Ernennung zum Provinzgouverneur nach Indien gefolgt war, in die Hand versprochen, sich bis zu ihrer Rückkehr um ihren Sohn zu kümmern.
Erwartungsgemäß hatte sich dieser gutaussehende junge Mann nach seiner Studienzeit in Oxford kopfüber in die Vergnügungen gestürzt, die ihm aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung geboten wurden. Der Herzog hatte verständnisvoll gelächelt, als ihm zu Ohren kam, daß sein Neffe mit seinen Freunden wilde Saufgelage veranstalte und sich in Nachtklubs austobe. All das war von einem lebenslustigen jungen Mann, der zum ersten Mal in seinem Leben von der Leine gelassen wurde, zu erwarten gewesen. Der Herzog war ohnehin immer der Meinung gewesen, daß seine Schwester ihren einzigen Sohn viel zu sehr verzärtelt hatte und es höchste Zeit wurde, einen richtigen Mann aus ihm zu machen.
Aber viertausend Pfund waren ein kleines Vermögen, selbst für einen begüterten Mann wie seinen Schwager, Lord Digby.
»Am besten wäre gewesen, sie hätten Oliver mitgenommen«, stellte der Herzog bei sich fest.
Doch seine Schwester meinte, Oliver solle die gesellschaftliche Stellung einnehmen, die ihm zustand, und Gelegenheit haben, ein nettes Mädchen kennenzulernen, um eine standesgemäße Verbindung einzugehen.
Oliver hatte sich jedoch mehr für hübsche Freudenmädchen interessiert, die in den Nachtklubs und Ballhäusern anzutreffen waren, und all die ehrgeizigen Mütter mit heiratsfähigen Töchtern enttäuscht, die ihn auf die Liste der begehrtesten Junggesellen gesetzt hatten. Vergebens hatten sie auf Bällen und Empfängen auf sein Erscheinen gelauert.
Der Herzog unterzeichnete seine Geschäftspost und warf dann einen schiefen Blick auf den Stapel Briefe, den Watson in weiser Voraussicht ungeöffnet auf dem Schreibtisch aufgebaut hatte. Sie stammten samt und sonders von Damen der Gesellschaft, die den Herzog bezichtigten, ihnen das Herz gebrochen zu haben.
Dabei bestand für den Herzog das eigentliche Vergnügen an seinen Liebesaffären darin, dem Wild nachstellen zu müssen, bevor er es zur Strecke brachte.
Er hatte sich schon oft gefragt, weshalb er so schnell gelangweilt war, und war zu der Erkenntnis gelangt, daß er sich ständig auf der Suche nach etwas befand, das er selbst nicht recht in Worte zu kleiden vermochte. Eine schöne Frau wirkte durchaus anziehend auf ihn, und ihre Nähe löste eine gewisse Erregung in ihm aus, aber das Bedauerliche war, daß er am nächsten Morgen jedes Mal ernüchtert und enttäuscht war, statt glücklich und beschwingt zu sein.
»Was ist nur los mit mir?« fragte er sich oft, wenn er im Morgengrauen eines der Häuser in seiner Nähe verließ und sich auf den Heimweg begab.
So auch nach der leidenschaftlichen Liebesnacht mit der schönen Doreen. Sie würde ihn, wie alle Frauen, die er verlassen hatte, bedrängen und anflehen, zu ihr zurückzukehren, bis sie endlich einsehen würde, daß auch sie ihn nicht halten konnte.
Zuweilen empfand er es selbst als absonderlich, daß sein Herz kalt blieb, während jede Frau, mit der er eine Liebesnacht verbracht hatte, das ihre an ihn zu verlieren schien.
Er mochte nicht länger über Lady Bramwell und die ungeöffneten Liebesbriefe auf dem Schreibtisch nachdenken und war deshalb erleichtert, als der Butler »Mister Oliver Digby, Euer Gnaden«, meldete.
Sein Neffe stürmte ins Zimmer.
»Guten Morgen, Onkel Wade«, begrüßte ihn Oliver ein wenig atemlos. »Verzeih, daß ich dich warten ließ, aber ich habe noch fest geschlafen, als dein Diener bei mir anklopfte.«
»Ich habe nichts anderes erwartet«, gab der Herzog trocken zurück. »Da ich im Begriff bin, aufs Land zu fahren, wollte ich vorher noch einmal mit dir sprechen.«
Oliver sah ihn forschend an.
»Weshalb?«
»Ich glaube, du kennst die Antwort«, entgegnete der Herzog. »Dir dürfte doch klar sein, daß du zu viel Geld ausgibst.«
Oliver warf sich in einen der bequemen Armsessel.
»Das Leben in London ist heutzutage mächtig teuer«, sagte er dann mürrisch.
»Besonders wenn jemand namens Connie dahintersteckt, wie?« fragte der Herzog ironisch.
»Du weißt also über Connie Bescheid?«
»Das dürfte kein Geheimnis mehr sein. Ganz London weiß inzwischen von deiner Liaison mit ihr und daß sie zu kostspielig für dich ist.«
»Sie ist reizend und sehr amüsant«, begehrte Oliver auf.
»Zum Wucherpreis von viertausend Pfund«, ergänzte der Herzog nüchtern.
Oliver sprang auf, trat ans Fenster und starrte blicklos hinaus in den Garten.
»Also gut«, sagte er schließlich mißmutig, »wenn du deshalb Theater machst, muß ich mich wohl von ihr trennen.«
»Es geht nicht darum, daß ich Theater mache«, erwiderte der Herzog, »ich denke an deinen Stiefvater, der letztendlich für die Rechnung aufkommen muß.«
Oliver fuhr herum.
»Du wirst es ihm doch nicht verraten?«
»Das mußt du schon selbst tun«, entgegnete der Herzog, »sobald die Bank sich weigert, deine Schecks einzulösen, weil du dein Guthaben aufgebraucht hast.«
»Verdammt!« rief Oliver wütend aus. »Warum kann ich nicht über eigenes Geld verfügen und muß Papa wegen jedes Pennys anbetteln?«
Der Herzog wußte genau, daß sein Schwager vor seiner Abreise nach Indien eine großzügige Unterhaltszahlung für Oliver veranlaßt hatte und der Vorwurf des jungen Mannes daher nicht gerechtfertigt war, aber er äußerte sich nicht dazu.
»Mein Vorschlag wäre«, sagte er stattdessen, »daß du mich nach Mortlyn begleitest.«
»Aufs Land? Was, zum Teufel, soll ich da?« fragte Oliver entgeistert.
»Ich habe vergangene Woche ein paar Pferde gekauft«, erklärte ihm der Herzog, »die ich gern zureiten möchte.«
Oliver dachte einen Augenblick nach, dann sagte er: »Vor der Abreise müßte ich noch mal bei Connie vorbeischauen und ihr das Halsband schenken, das sie sich so sehr wünscht und ich ihr versprochen habe.«
»Kannst du dir’s leisten?«
»Natürlich nicht«, erwiderte Oliver, »aber ich hab’s nun mal versprochen.«
Es war ihm anzusehen, daß er nicht wußte, wie er sich verhalten sollte und zwischen dem Respekt vor seinem Stiefvater und der Zuneigung zu seiner Herzensdame, die er nicht enttäuschen wollte, hin und her gerissen wurde.
»Erspar dir die unnötige Ausgabe«, riet ihm der Herzog, »und verschanz dich hinter dem Befehl deines Vormunds, ihn aufs Land zu begleiten.«
»Woher willst du das wissen?« fragte Oliver mißtrauisch.
Eine Weile war es still zwischen ihnen, dann bemerkte der junge Mann das spöttische Lächeln seines Onkels, und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen.
»Meine Güte, das darf doch nicht wahr sein!« rief er aus. »Verdammt noch mal, gibt es denn in ganz London keine schöne Frau, die dir nicht irgendwann einmal verfallen war?«
Wie ein Kompliment hörte sich das nicht gerade an. Oliver begab sich zur Tür, riß sie auf und sagte dann in rüdem Ton: »In fünfzehn Minuten bin ich marschbereit, um Euer Gnaden in sein Provinzkaff zu begleiten.«
Lautstark schlug er die Tür hinter sich ins Schloß. So entging es ihm, daß der Herzog leise lachte.
Dieser hatte es sich zum Prinzip gemacht, sich niemals mit einer Frau einzulassen, die sich für ihre Liebesdienste bezahlen ließ. Da er über einen ansehnlichen Reichtum verfügte, erwarteten die Schönen, die seine Gunst genossen, natürlich irgendwelche kostbaren Geschenke von ihm. Die Auswahl pflegte er Mr. Watson zu überlassen, der über einen erlesenen Geschmack und das nötige Fingerspitzengefühl für diese Dinge verfügte.
Der Herzog hatte schon seit langem aufgehört, die vielen Pelzkragen, Muffs, Brillantcolliers, Ohrringe, Handtaschen, Sonnenschirme und Fächer zu zählen, die er bezahlt hatte und die ihn im Laufe der Jahre ein kleines Vermögen gekostet hatten.
Oliver wird mit der Zeit auch dahinterkommen, daß Frauen immer mehr von einem Mann fordern, als er sich eigentlich leisten kann, überlegte er. Für den Jungen würde es jedenfalls gut sein, sich eine Zeitlang in Mortlyn austoben zu können.
Die Reise zum herzoglichen Stammsitz, die nun beide Männer antraten, nahm über zwei Stunden in Anspruch, obwohl der Herzog auch diesmal bemüht war, seinen eigenen Rekord zu brechen.
Der Anblick des stattlichen Gebäudes versetzte ihn wie jedes Mal, wenn die Kutsche in flotter Fahrt durch die uralte Eichenallee rollte, in Entzücken.
Grüne Rasenflächen erstreckten sich vor dem schönen Gebäude bis zum See hinunter, und wie immer konnte der Herzog sich nicht sattsehen an dem zauberhaften Anblick.
Unterwegs hatten er und Oliver nur wenige Worte gewechselt. Seine ganze Aufmerksamkeit galt dem flotten neuen Gespann, das er mit bewundernswertem Geschick lenkte und um das er von anderen jungen Adligen glühend beneidet wurde.
Als sie die Brücke über den See passiert hatten und vor dem Hauptportal ankamen, rief der Reitknecht vom Bocksitz hinter ihnen aus: »Euer Gnaden haben sich wieder mal selbst übertroffen! Fünf Minuten unter der Zeit!«
»Fünf Minuten?« bemerkte der Herzog. »Ich hatte gehofft, zehn oder fünfzehn Minuten herausgeholt zu haben.«
»Das werden Euer Gnaden früher oder später auch noch schaffen«, meinte der Lakai zuversichtlich und sprang vom Sitz, bevor die Räder der Kutsche zum Stillstand kamen.
Er hätte sich nicht so zu beeilen brauchen, denn jetzt waren schon zwei Stallburschen zur Stelle, um die Pferde am Zügel festzuhalten, und mehrere Lakaien in der herzoglichen Livree hatten Aufstellung genommen.
Der Herzog begab sich langsam nach oben und wurde in der Halle von seinem alten Butler begrüßt.
»Morgen, Graves«, erwiderte der Herzog den Gruß seines Getreuen. »Alles in Ordnung?«
»Es ist uns eine große Freude, Euer Gnaden so bald schon wiederzusehen«, entgegnete der Butler mit einer tiefen Verbeugung. »Der Champagner steht im Arbeitszimmer bereit, und in fünfzehn Minuten kann der Lunch serviert werden.«
»Wunderbar«, sagte der Herzog erfreut. »Mr. Oliver und ich sind ziemlich hungrig, denn wir sind ohne Rast von London durchgefahren.«
»Du hast recht, Onkel Wade. Ich habe heute morgen nicht gefrühstückt und sterbe vor Hunger«, ließ Oliver vernehmen.
»Dein Frühstück hätte nach der durchzechten Nacht zweifellos aus einem Brandy und Sodawasser bestanden, also ist es besser so«, bemerkte der Herzog.
»Du hast gut reden«, erwiderte Oliver. »Jedermann weiß, daß du wenig trinkst, aber es ist schwer, nein zu sagen, wenn sich ringsum alle den Kanal vollaufen lassen!«
Der Herzog lachte. Er erinnerte sich sehr wohl an die Zeit, als er sich kopfüber ins Vergnügen des Londoner Gesellschaftslebens gestürzt hatte.
Irgendwann hatte er jedoch erkannt, daß das seinem sportlichen Ehrgeiz nicht zuträglich war. Seine Pferde waren ihm immer über alles gegangen.
Er galt aber auch als hervorragender Faustkämpfer und, obwohl das aus der Mode gekommen war, als geübter Schwertfechter, der sich schon mit mehreren europäischen Meistern im Kampf gemessen hatte.
Oliver hätte gut daran getan, sich ebenfalls irgendeiner Sportart zu widmen, die den Körper stählte, fand der Herzog, aber zwingen konnte man ihn dazu natürlich nicht. Deshalb behielt er auch seine Gedanken für sich, als Oliver bis zum Lunch drei Gläser Champagner hinuntergestürzt hatte, während der Herzog noch beim ersten Glas war.
Später unternahmen sie einen Rundgang durch die Stallungen, doch Oliver konnte das Gähnen kaum unterdrücken. Der Herzog schlug ihm vor, sich ein paar Stunden aufs Ohr zu legen, um dann für den Ausritt in den kühlen Abendstunden fit zu sein, und Oliver war sofort einverstanden.
Der Herzog ließ einen der neuerworbenen Hengste für sich satteln und begab sich allein auf einen kurzen Ritt durch die Gegend. Das Pferd war frisch und ungebärdig und ließ nichts unversucht, dem neuen Herrn seinen Willen aufzuzwingen. Es war die übliche Kraftprobe zwischen Mensch und Tier, die den Herzog immer wieder aufs Neue reizte. Nach nur einer Stunde hatte er den Hengst völlig unter Kontrolle.
In der Ferne tauchte der Kirchturm des Dorfes auf, und er erinnerte sich an das Gespräch mit Mr. Watson. Spontan beschloß er, diese Miss Linton persönlich aufzusuchen und sich selbst eine Meinung darüber zu bilden, ob sie nun eine »weiße Hexe« war oder nicht.
Er hatte den Verdacht, daß es sich um eine ziemlich verdrehte Person handelte. Wahrscheinlich gaukelte sie ihren wundergläubigen Mitmenschen etwas vor. Von ihrem verstorbenen Vater wußte er nur, daß der Pfarrer ein kluger Mann gewesen war.
Während er sich nun der Kirche näherte, überlegte er, daß Miß Linton vermutlich ziemlich betagt war, keinen Mann abbekommen hatte und sich nun mit Kräuterheilkunde, Gesundbeterei und anderem Hokuspokus befaßte. Auf so etwas konnte Klein-Mortlyn jedoch gut verzichten. Das Dorf verfügte über ein Spital und Armenhäuser sowie eine Schule.
Da das Dorf immer sozusagen im Schatten des Palastes sein Dasein gefristet hatte, war ihm nach Ansicht des Herzogs ein gewisser altväterlicher Charme erhalten geblieben, der es von allen anderen zum herzoglichen Besitz gehörenden Siedlungen unterschied.
In diesem Zusammenhang faßte er den Entschluß, die Pfarrstelle in Mortlyn mit einem würdigen Nachfolger für den verstorbenen Vikar zu besetzen.
Vorschläge würden ihm zwar vom Bischof unterbreitet werden, doch die Entscheidung, wen er einstellte, behielt er sich vor.
Nicht ohne ein schlechtes Gewissen Mr. Watson gegenüber, der es übernommen hatte, in den übrigen Pfarrgemeinden den Geistlichen einzustellen, der seiner Meinung nach am geeignetsten war. Da er über eine ausgezeichnete Menschenkenntnis verfügte, hatte er bisher stets die richtige Wahl getroffen.
In Klein-Mortlyn wollte der Herzog jedoch selbst entscheiden, wer die Nachfolge des verstorbenen Vikars antreten sollte.
Die Kirche war normannischen Ursprungs und befand sich am Rande eines Parks. Sie war von uralten, verwitterten Grabsteinen umgeben, die aus den Gräbern aufragten, und der Herzog stellte voller Genugtuung fest, daß die meisten Gräber mit Blumen geschmückt waren.
Seit er denken konnte, hatte er das Dorf immer als einen Teil des Palastes und seiner Gärten angesehen, wie es vor ihm auch sein Vater getan hatte.
Er erinnerte sich, daß es in seiner Kindheit einmal ein schreckliches Donnerwetter gegeben hatte, weil das Gras auf dem Kirchhof zu hoch gewesen war. Sein Vater hatte beim Kirchgang jedes Unkraut am Wegesrand bemerkt und dem Friedhofsgärtner eine entsprechende Rüge erteilt.
Das Pfarrhaus schloß sich an den Kirchhof an und war ein anheimelndes altes Gebäude, das über eine schmale Auffahrt zu erreichen war.
Die Büsche davor standen in voller Blüte, und der Herzog betrachtete wohlgefällig die gepflegten Blumenbeete vor dem Pfarrhaus.
Niemand ließ sich blicken, um sein Pferd zu übernehmen, aber er entdeckte neben der Haustür einen Haltepfosten und schlang den Zügel um den eisernen Haltering. Danach betrat er die Veranda und stellte fest, daß die Eingangstür offenstand. Daneben befand sich ein Klingelzug, den er kräftig betätigte, doch aus dem Haus drang kein Laut.
Er stellte sich vor, daß nach dem Tode des Vikars eine alte Dienerin oder eine Frau aus dem Dorf dessen Tochter zur Hand ging und möglicherweise bereits nach Hause gegangen war.
Der Herzog betrat die kleine Diele. Alles blitzte vor Sauberkeit, und ein Duft von Bienenwachs und Lavendel erfüllte die Luft. Eine Schale Hyazinthen, die am Fuße der Eichentreppe ein Tischchen zierte, verströmte ebenfalls einen betäubenden Duft. Es sprach zweifellos für Miss Linton, daß das Haus in einem so tadellosen Zustand war.
Der Herzog begab sich zu einer Tür, die zum Wohnzimmer führte. Es war niemand darin, aber die Möbel waren geschmackvoll aufgestellt, und auf allen Tischen standen Vasen mit frischen Blumen.
Die Tür unter der Treppe mußte seiner Schätzung nach in die Küche führen, also begab er sich in die entgegengesetzte Richtung. Er öffnete die nächste Tür, die offensichtlich ins Arbeitszimmer des Vikars führte, denn die Wände waren mit Bücherregalen bedeckt. Am Ende eines kurzen Durchgangs gelangte er zu einem weiteren Raum, und als er die Hand auf die Klinke legte, glaubte er jemanden sprechen zu hören. Ohne anzuklopfen, trat er ein. Das, was sich in diesem Raum seinen Blicken bot, traf ihn völlig unerwartet.
Es gab einen großen Tisch in der Mitte und wenig andere Möbel. Überall standen Käfige und Kisten herum, und an einem kleinen Tisch in Fensternähe stand eine junge Frau. Die Sonne schien durchs Fenster und verlieh ihrem Haar einen goldenen Schimmer. Sie war mit etwas beschäftigt, das dem Herzog ein Vogel zu sein schien.
Dann hörte er sie mit sanfter Stimme sagen: »Nicht bewegen, und keinen Laut!«
Unwillkürlich blieb er wie angewurzelt stehen, obwohl er es nicht gewöhnt war, daß jemand in diesem Ton mit ihm sprach.
Nach einer Minute etwa wandte die Frau sich um, und jetzt konnte er deutlich erkennen, daß sie einen jungen Schwan hielt, dessen Flügel sie offenbar geschient hatte.