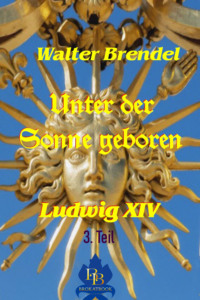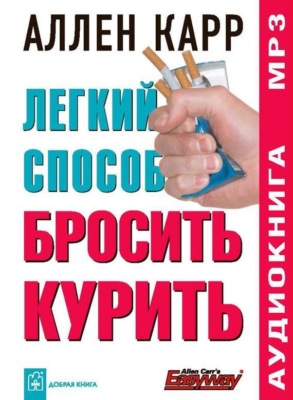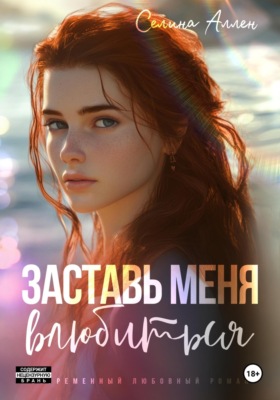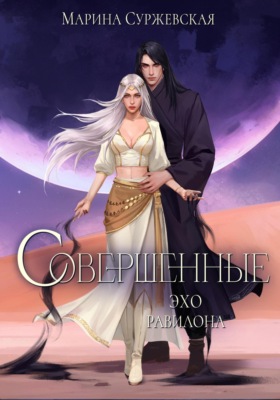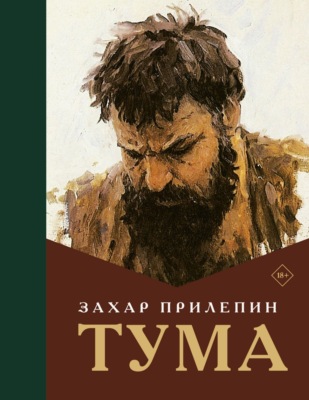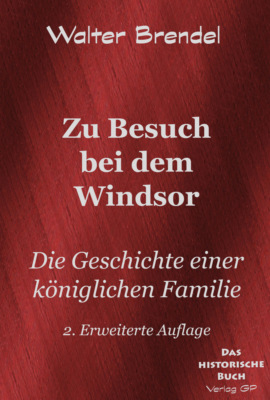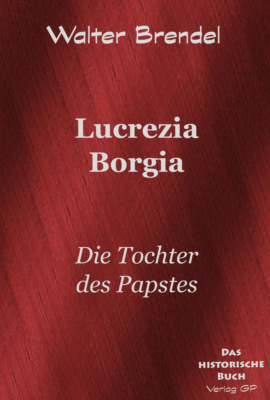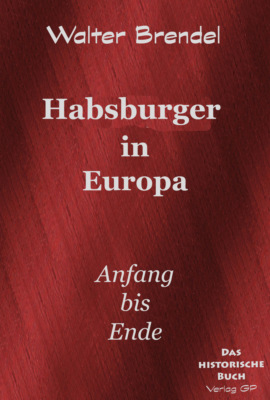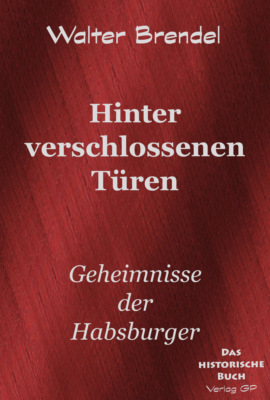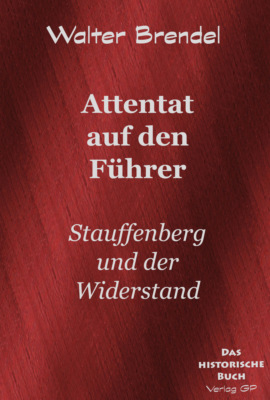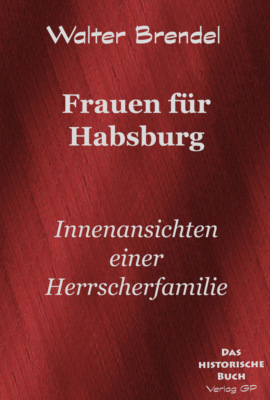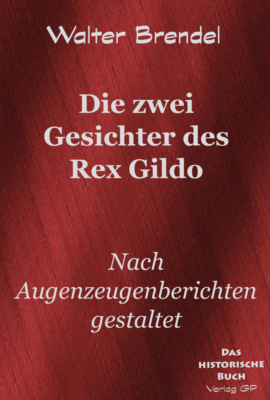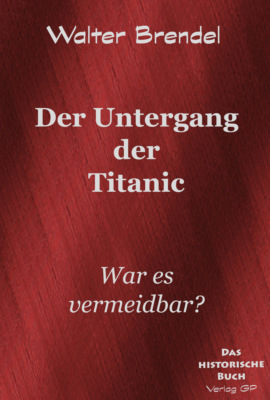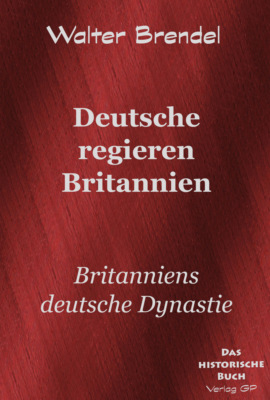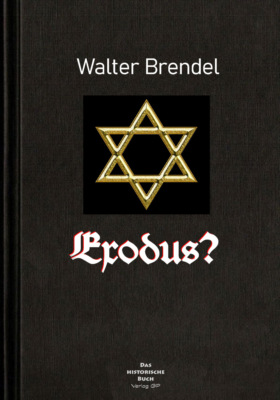Buch lesen: "Unter der Sonne geboren - 3. Teil"
Walter Brendel
Unter der Sonne geboren
Ludwig XIV.
3. Teil
Inhalt
Innenpolitik
Außenpolitik - Kriege
Glaubenskämpfe
Künstler am Hofe
Das große Sterben
Zusammenfassung
Innenpolitik
Die Kloake von Paris
Paris ist ein Moloch: laut, schmutzig, eine halbe Million Bürger, ein Dutzend Ermordete und Ertrunkene pro Nacht. Der Polizeichef kämpft gegen die Verbrecher.
Aufbau des Ordnungssystems
Die Mitglieder eines königlichen Rats können so etwas nicht hin-nehmen und befassen sich zu dieser Zeit mit der Reform der städtischen Ordnung. Der Rat beschneidet kurzerhand die Rechte des bisherigen Zivilleutnants und überträgt seine Macht auf einen neuen Posten: den Generalleutnant, der formal der Stadt, de facto aber dem König untersteht. Damit dehnt Ludwig XIV seinen Einfluss auf die Hauptstadt aus. Am 15. März 1667 ernennt er Nicolas de La Reynie zum lieutenant general depolice.
Der 41-jährige fromme Christ stammt aus einer Familie, die seit Generationen Juristen und königliche Beamte hervorbringt. Er war Richter in Bordeaux, ehe er nach Paris zog. La Reynie hat keine familiären Bindungen an den Adel der Hauptstadt. Er kann der Arbeit für seinen König nachgehen, ohne Rücksichten nehmen zu müssen.
Doch der Generalleutnant steht vor einer kaum zu bewältigenden Aufgabe. Das Edikt, mit dem sein Posten geschaffen wurde, zählt auf 22 Zeilen seine neuen Pflichten auf: Überwachung der Straßenreinigung, Feuerbekämpfung, Hochwasserschutz, Versorgung der Stadt, Inspektion der Metzger, Markthallen, Jahrmärkte, Hotels, Kneipen und Spielhöllen, Kontrolle der Gewichte und Maßeinheiten, Untersuchung illegaler Versammlungen und Ruhestörungen.
Als Richter urteilt er zudem in Fällen von unerlaubter Bettelei, Prostitution oder Streitigkeiten zwischen den Eltern eines Lehrlings und dessen Meister. La Reynie ist der erste moderne Polizeichef Europas. Und noch mehr: Er bewältigt die gleichen Aufgaben, für die in späteren Jahrhunderten ein Bürgermeister zuständig sein wird.
Der neue Polizeileutnant bezieht eine Amtsstube im Chatelet, der ehemaligen Burg, die als Gericht, Gefängnis und Folterkammer dient. Er stürzt sich mit Eifer in seine Arbeit. La Reynie besucht Gefangene, liest Romane, um zu entscheiden, ob sie als pornografisch oder verleumderisch verboten werden müssen. In Zeiten schlechter Ernten verhandelt er mit den Getreidehändlern, um Hungerunruhen zu vermeiden.
Streng ist der Polizeileutnant mit seinen Untergebenen. Vor allem dann, wenn sie ihren Vorurteilen folgen und nicht den Fakten: Auch der ärmste Pariser kann erwarten, dass La Reynie seinen Fall untersucht, ihn manchmal sogar persönlich anhört.
Als Erstes aber versucht der Leutnant, seine Ordnungstruppen neu zu organisieren. Die Pariser vergleichen ihre Stadt mit einem finsteren Wald: Jede Nacht werden gut ein Dutzend ertrunkene oder er-mordete Menschen in die städtische Leichenhalle im Chatelet eingeliefert.
La Reynie stockt die Nachtwache auf, von 120 Mann auf 400. Ihr Gehalt wird mehr als verdoppelt.
Dafür müssen sie jeden Tag von der Dämmerung bis zwei Uhr nachts auf Streife gehen, bewaffnet mit Pistole und einer schweren Laterne. Sie bewegen sich in Gruppen von vier oder fünf Polizisten und auf Befehl ihres Chefs stets auf neuen, unvorhersehbaren Routen. In späteren Jahren werden sie blaue Uniformen erhalten.
Ihre Dienstmoral lässt dennoch zu wünschen übrig: Schon bald wird La Reynie verbieten, den Männern an jenen Tagen ihren Sold auszuzahlen, an denen sie zur Streife eingeteilt sind - damit sie sich nicht schon vor Sonnenuntergang betrinken.
Mit dem Amt des Generalleutnants führt Ludwig XIV auch die Schlamm- und Laternensteuer ein. Denn als La Reynie ernannt wird, gilt Paris als schmutzigste Stadt der Welt. Der Dreck in den Straßen stinkt nach Schwefel, Fußgänger ruinieren sich Schuhe und Kleidung. „Das haftet wie Pariser Schlamm“, sagen die Hauptstädter.
La Reynie zwingt die Hausbesitzer, jeden Abend vor ihren Grundstücken zu kehren. Zweimal im Jahr müssen sie ein Prozent von dem abgeben, was ihr Gebäude an Miete abwirft. Von dem Geld bezahlt der Polizeileutnant Unternehmer, die täglich mit Karren durch die Straßen ziehen und dabei Glöckchen läuten. Sie schaufeln die Dreckhaufen in ihr Gefährt und nehmen die Fäkalien entgegen, die ihnen die Bewohner in Körben oder Eimern heraustragen.
Doch die Hauptstädter gewöhnen sich nur langsam an die Sauberkeit, und noch bis ins nächste Jahrhundert werden viele an der Tradition festhalten, den Nachttopf einfach aus dem Fenster zu kippen. Mancher kommt dabei zu Tode, weil er sich zu weit hinauslehnt und auf die Straße fällt oder sich mit wütenden Passanten duellieren muss.
Eine andere Neuheit dagegen begeistert die Pariser. La Reynie kauft rund 5000 Laternen, dazu jedes Jahr 200 000 Pfund Kerzen. Die Lichter werden alle 20 Meter auf Höhe des ersten Stocks zwischen den Häusern oder an den Wänden aufgehängt. Einmal im Jahr wählen die Anwohner einer Strecke von zehn Laternen einen Anzün-der. Dieser muss jeden Abend mit einem Korb voller Talgkerzen durch die Straße gehen und die Laternen bestücken. Er läutet eine kleine Glocke, damit die Hausbesitzer die Lichter rechtzeitig herunterlassen.
Beim Klingeln versammeln sich die Pariser an den Fenstern oder bleiben staunend stehen, um dieses Schauspiel jeden Abend von neuem zu bewundern: Wie die Laterne herabschwebt, leuchtend wieder hinaufgezogen wird und die Nacht erhellt. An der Hauswand flackert beruhigend der Schatten des eisernen Hahns, der als Zeichen der Wachsamkeit oben auf den Laternen sitzt.
ZEHN JAHRE nach dem Amtsantritt des Polizeileutnants wird La Reynie in einem Loblied gepriesen: „Paris ist dank seiner umsichtigen Sorge und seiner klugen Verordnungen heute die schönste und zivilisierteste Stadt der Welt.“
Vermutlich steigt er manchmal auf den Turm des Chatelets hinauf, eines der höchsten Gebäude von Paris, um seine Stadt zu betrachten, hinabzublicken in das Gewimmel seiner Schützlinge. Der Ausblick muss ihn dann noch immer erstaunen. Und auch besorgen: Die Stadt scheint fast zu bersten. Lebten zu Beginn des Jahrhunderts 200000 Menschen in Paris, nähert sich ihre Zahl nun bereits einer halben Million.
Die alten Grenzen gelten nicht mehr: 1670 hat König Ludwig befohlen, die mittelalterlichen Stadtmauern zu schleifen und die Wassergräben aufzufüllen - um Platz zu schaffen für neue Straßen. Von seinem Ausguck kann La Reynie vielleicht sehen, wie die Arbeiten im Norden bereits voranschreiten, wie anstelle der alten Befestigungen breite Wege angelegt, an ihren Rändern Bäume gepflanzt werden. An dem Namen für diese Straßen, Boulevard, erkennt man, dass sie den Platz eines militärischen Bollwerks einnehmen.
Hinter den geschleiften Stadtmauern wachsen die faubourgs, die Vorstädte. Viertel entstehen, wo einst Felder waren: Saint-Antoine im Osten, Saint-Denis im Norden, Saint-Michel im Süden.
Wenn La Reynie nach Südwesten schaut, blickt er auf die Dächer des jüngst fertig gestellten Invalidenheims. Bis zu 6000 ausgediente Soldaten verbringen hier ihren Lebensabend mit Handarbeiten und Gebeten. Eine bis dahin unbekannte soziale Einrichtung: Zwar gibt es seit dem Dreißigjährigen Krieg stehende Heere, deren Veteranen landeten bisher aber meist in Klöstern oder auf der Straße. Das neue Heim dient deshalb auch dazu, Paris von Bettlern zu befreien.
Kein Gebäude in Paris ist so großzügig angelegt, nicht einmal das Stadtschloss des Königs, der Louvre. Und selbst die Tuilerien, der größte Park der Stadt, können mit der Gesamtanlage des „Hotel des Invalides“ nicht konkurrieren. Einen solch verschwenderischen Umgang mit freier Fläche haben die Pariser noch nicht gesehen.
Direkt unterhalb des Chatelets fließt die Seine, die Lebensader der Stadt - und ihre Kloake. Die Bewohner der Ile de la Cite in der Mitte des Flusses lassen ihre Abwässer direkt in die Seine rinnen.
Der Schmutz des rechten Ufers sammelt sich in einem großen, halbkreisförmigen Abwassergraben, der sich stromaufwärts in der Nähe der Bastille in den Fluss ergießt, stromabwärts hinter den Tuilerien.
Auch die Bievre, ein kleines Flüsschen am östlichen Stadtrand, dient als Kloake. So schwimmen in der Seine die Asche und Seifen der Wäscherinnen, Blut und Schlachtabfälle der Metzger, der Urin, mit dem die Gerber die Tierhäute bearbeiten, die Farben, in welche die Färber ihre Stoffe tauchen.
Wasserverkäufer tragen Eimer von der Seine in die Straßen hinauf. La Reynie ordnet immer wieder an, dass sie ihr Nass aus der starken, nicht so verdreckten Strömung schöpfen sollen, doch die Wasserträger bevorzugen einen kleinen Seitenkanal, der günstiger gelegen ist - in den aber die Abwässer eines Krankenhauses fließen.
Wer sich ihr Wasser nicht leisten kann, geht zu einem der öffentlichen Brunnen. Ein Dutzend neue hat Ludwig bauen lassen, doch ihr Wasser ist nicht sauberer als das der Verkäufer. Es wird seit 1671 bei der Brücke von Notre-Dame aus dem Fluss gepumpt - ganz in der Nähe eines der betriebsamsten Hafenbecken der Stadt: An der Place de Greve, vor dem Rathaus, landen Flussschiffer Getreide an. Verbände aus bis zu 20 Kähnen werden die Seine hinaufgezogen oder gleiten sie hinab, dazwischen ankern Wassermühlen.
Im Sommer baden nackte Pariser im Fluss; und irgendwo überleben auch noch einige weiße Schwäne. Der Sonnenkönig hat sie aussetzen lassen, als Verzierung.
Durch die ihm anvertraute Stadt bewegt sich La Reynie wie jeder Mann von Stand mit der Kutsche. Einige greise Pariser können sich vielleicht noch an die ersten carrosses erinnern. Innerhalb weniger Jahrzehnte haben die neuen Gefährte die Stadt erobert. Inzwischen pressen sich Tausende Kutschen durch enge Gassen, die für Fußgänger und Maultiere gebaut sind. Ludwig XIV gibt jedes Jahr mehr als 50 000 Livres aus, um die Straßen zu pflastern und zu verbreitern.
Zu den privaten Gefährten kommen die zahlreichen Mietkutschen. Ihre Chauffeure haben einen schlechten Ruf, sie betrügen die Kunden und quälen ihre Tiere. „Paris ist das Paradies der Frauen, das Fegefeuer der Männer und die Hölle der Pferde“, sagen die Hauptstädter. Und singen einen Gassenhauer über die neuen Gefahren des Straßenverkehrs: „Bei jedem Schritt/marschiert der Tod gleich mit.“
Zwischen den ratternden Kutschen treiben Bauern ihre Tiere zum Markt, schlängeln sich Träger mit Sänften vorbei, fahren zweirädrige Gefährte, die an japanische Rikschas erinnern. Über ihnen ra-gen eiserne Ladenschilder weit auf die Straße hinaus. Ihr Quietschen mischt sich mit den Glöckchen der Straßenkehrer. Stadt-schreier preisen die neuesten Weine an, frisch eingetroffen bei den Wirten der Nachbarschaft.
Menschen schieben sich durch die Straßen, Waschfrauen mit Leinenbündeln, jugendliche Schornsteinfeger auf dem Weg zur Arbeit oder zurück in ihren Schlafsaal, den sie mit einem ältlichen Aufseher teilen. Dienstmädchen, Soldaten, Lakaien in Uniform, herausgeputzt mit Knöpfen, Litzen und Bändern.
Die Männer tragen den dreiteiligen Anzug aus Kniebundhose, Weste und langem Überrock, die Frauen Rock, Mieder und Schürze. Sie unterscheiden sich nur in der Qualität: Die Kleider der Reichen sind häufig aus teuren Materialien wie Baumwolle und Seide, die der Armen meist aus ausgeblichener Wolle, oft erworben bei einer Alt-kleiderverkäuferin.
Manch Armer trägt zudem ein rot-gelbes Zeichen auf der rechten Schulter. Er erhält eine kleine Summe von der Stadt und hat sich dafür verpflichtet, ein christliches Leben zu führen und nicht zu betteln.
Nur etwa jeder Vierte auf den Straßen stammt aus Paris; die Stadt wächst, weil ständig Menschen in die Kapitale strömen. Vielleicht drücken sie die Abgaben, die Ludwig den Dörfern auferlegt - anders als die meisten anderen Franzosen müssen die Pariser weder die Grundsteuer noch die Salzsteuer zahlen. Vielleicht aber träumen die Neubürger auch nur von einem leichteren, besseren Leben.
Die Massen müssen La Reynie Sorgen bereiten. Jeder der Neuankömmlinge braucht Arbeit, es ist nur ein kleiner Schritt zu Bettelei, Diebstahl und Prostitution. Wer sich einen Verbrecher dingen will, muss nur zum Pont-Neuf gehen. Dort, am Reiterstandbild von Ludwigs Großvater, lungern sie herum, die „Hofleute vom bronze-nen Pferd“: Beutelschneider, Gauner, Zuhälter, Prostituierte.
Die Gedanken des Königs
Ludwig will aus Paris eine Stadt des Wissens zu machen. Hier erscheint das „Journal des Scavans“ (Journal der Gelehrten“), die erste wissenschaftliche Zeitschrift der Welt. In der ersten Ausgabe des wöchentlich erscheinenden Magazins beschreiben die Autoren unter anderem die Geburt eines Monsters in Oxford (tatsächlich siamesische Zwillinge) sowie neuartige Teleskope und eine neue Ausgabe eines Werkes von Descartes.
Ludwig ist seit Generationen der erste französische Monarch, der keinen Hofastrologen beschäftigt. Stattdessen hat er im Süden der Stadt ein Observatorium bauen lassen, mit dem Längengrad von Paris als Symmetrieachse. Es ist seit einigen Jahren fertig und hat ein ausgezeichnetes Fernrohr. Im botanischen Garten wachsen 4000 Pflanzen, Dozenten geben Chemiekurse für die Pariser Bürger.
Denn die Bewohner scheinen die Begeisterung des Königs für die Wissenschaft zu teilen - wenn auch hauptsächlich für eine Spielart, die sie mit La Reynies Ordnungshütern in Konflikt bringen könnte: Es gebe in Paris so viele Alchemisten wie Köche, schreibt ein italienischer Besucher.
Einige von ihnen mag tatsächlich Wissensdurst treiben - die meisten aber sind Betrüger. Sie nehmen ihren Kunden Geld ab, mit dem Versprechen, schon bald wertlose Materialien in Gold verwandeln zu können. Oder sie nutzen ihre Experimente als Tarnung für Falschmünzerei.
Einige mögen sogar noch finstereren Geschäften nachgehen und neue Gifte entwickeln. Die Menschen erzählen sich Geschichten von imprägnierten Hemden und tödlichen Handschuhen, von geruch- und geschmacklosen Pülverchen. Auch Adelige schätzen Gift. Daspoudre de succession, das Erbschaftspulver, kann viele Probleme lösen. Doch wer tatsächlich einen Rivalen oder eine lästige Ehefrau loswerden möchte, kommt auch ohne neue Erfindungen aus: Quecksilberchlorid und Arsen gibt es in jeder Apotheke.
Und schließlich kann man sich auch an die zahlreichen Wahrsagerinnen wenden. Mehrere Hundert bieten in Paris ihre Dienste an, lesen aus der Hand oder aus einem Glas Wasser. Sie verkaufen Heilmittel gegen Hühneraugen oder Zahnschmerzen, brauen Tränke aus getrockneten Maulwürfen und pressen Öl aus Fröschen, für einen weißen Teint.
Die meisten Kunden, arme wie reiche, suchen Rat in Liebesdingen. Eine Frau, die unter ihrem Ehemann leidet, soll sein Hemd am Bild der heiligen Ursula reiben, damit er sie besser behandelt. Sie kann die Liebe auch fördern, indem sie der Weissagerin benutzte Leinentücher oder etwas Menstruationsblut bringt.
Doch viele Frauen wollen ihre Ehe gar nicht retten: Sie fragen vielmehr hoffnungsvoll, ob in ihrer Hand nicht etwas auf das baldige Ableben ihres Gatten hindeute. Man muss keine Hellseherin sein, um da die richtige Antwort zu wissen - und zu ahnen, dass die Kundin für etwas Hilfe beim Töten bezahlen würde. Neben harmlosem Mummenschanz betreiben einige Wahrsagerinnen deshalb auch das Geschäft mit dem Tod.
Für den Täter sind Giftmorde selten mit dem Risiko verbunden, erwischt zu werden. Zwar werden Verstorbene gelegentlich von Ärzten obduziert. Doch deren Diagnose ist unsicher. Die Absolventen der Pariser Universität lassen sich ihre Künste zwar teuer bezahlen, tatsächlich aber wissen sie kaum mehr als die Bader und die Apotheker, denen sich die Ärmeren anvertrauen.
Die Pariser Ärzte verschreiben Medizin aus Nattern, geben giftigen Wein als Brechmittel und lassen mit Begeisterung zur Ader. Die Kunst, die Venen mit einer kleinen Lanzette zu öffnen, wird unter Ludwig zu einem Markenzeichen der Medizin in der Hauptstadt.
Selbst der König muss darunter leiden: Nur knapp hat er als Neunjähriger einen mehrmaligen Aderlass überlebt, den die Doktoren während seiner Blatternerkrankung empfahlen. Und jetzt ist der Monarch seinem Leibarzt ausgeliefert, einmal im Monat muss er Abführmittel nehmen. Sie sollen gegen die giftigen „Dämpfe“ helfen, über die Ludwig klagt.
Der Tod ist allgegenwärtig. Familien legen ihre Verstorbenen vor die Haustür, wo Passanten das Kreuz über sie schlagen. Malaria wütet jeden Herbst in der Stadt, im Flusswasser schwimmen Typhusbakterien. Die ärmsten Toten werden in Massengräbern auf dem Friedhof beigesetzt, und vor allem im Sommer zieht Leichengeruch durch die Straßen, wenn die Totengräber die Gruben wieder einmal nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt haben.
Gelegentlich aber wird der alltägliche Tod zu einem Skandal, der die ganze Stadt beschäftigt. 1676 wird auf der Place de Greve Madame de Brinvilliers hingerichtet - die Tochter von La Reynies Vorgänger. Dessen Bauchschmerzen waren doch nicht auf die Gicht zurückzuführen, sondern auf Quecksilberchlorid: Die Marquise de Brinvilliers hat ihren Vater und ihre Brüder umgebracht.
Ihre Taten sind ans Licht gekommen, als Gerichtsvollzieher den Besitz ihres verstorbenen, hoch verschuldeten Liebhabers und Komplizen durchsuchten: Dabei stießen sie auf eine Schatulle mit Gift sowie leidenschaftliche Briefe der Marquise und einen Schuldschein, der zum Todeszeitpunkt ihres Vaters ausgestellt war. Nach vierjähriger Flucht wird Madame de Brinvilliers gefasst, verurteilt, geköpft und verbrannt.
Die Adeligen sind entsetzt: Offensichtlich schützen weder Geschlecht noch Rang davor, ein Verbrecher zu werden. Und die Gefährlichkeit des Erbschaftspulvers scheint gestiegen zu sein. Brinvilliers Morde fallen ja in die neue Zeit der Wissenschaft, da der König Akademien zur Forschung gründet, wo ständig Neues entdeckt wird und kluge Männer auch ohne Bibel erklären können, wie die Dinge zusammenhängen. Ist es nicht denkbar, dass diese neue Naturwissenschaft auch neue Gifte erschaffen kann, die keine Spuren hinterlassen oder vielleicht gar die Symptome normaler Krankheiten vortäuschen?
Über Jahre wird die Pariser Gesellschaft nicht mehr zur Ruhe kommen. Bei jedem plötzlichen Tod denkt sie ans Toxikum, selbst über bereits vor Jahren Verstorbene spekuliert sie. Offensichtlich kommen Giftmorde viel häufiger vor, als man bisher angenommen hat. Und kaum jemand glaubt, dass Madame de Brinvilliers eine Einzel-täterin war. Möglicherweise sind noch Komplizen auf freiem Fuß, unerkannt, bereit, wieder zuzuschlagen - und nach außen genauso ehrbar wie die Marquise.
Giftmorde
Was als die „Giftaffäre“ in die Geschichte eingehen sollte, wurde zufällig im Laufe einer Untersuchung entdeckt, die bei einigen Randfiguren der Unterwelt begonnen hatte, um sich allmählich bis in alle Schichten der Gesellschaft auszudehnen. Ludwigs fester Wille, die ganze Sache restlos aufzuklären, die Schaffung eines Sondergerichts, die große Anzahl der Verhaftungen, der hohe gesellschaftliche Rang vieler beteiligter Personen, die Dauer des Prozesses und nicht zuletzt sein jäher Abbruch sollten nicht nur in Frank-reich, sondern auch im Ausland großes Aufsehen erregen. Die Er-eignisse, die bei den Nachforschungen ans Licht kamen - bemerkte Madame de Sevigne bedauernd -, ließen ganz Europa erschauern und „Franzose“ zum Synonym für Giftmischer werden.
Im Grunde hätten schon die Ereignisse, die 1676 beim Prozess gegen die Brinvilliers bekannt wurden, ein Alarmsignal für die Ordnungshüter sein müssen. Doch die Verbrechen, um die es in diesem Prozess ging, waren so abscheulich, dass sie einzigartig erschienen und sich mit nichts vergleichen ließen. Die Marquise de Brinvilliers, Tochter eines hohen Richters und Gattin eines königlichen Offiziers, eine zarte, liebenswürdige Frau von sechsundvierzig Jahren, war vom Parlament, also dem Pariser Gerichtshof, zur Todesstrafe - Folter, Enthauptung und Scheiterhaufen - verurteilt worden. Man beschuldigte sie, aus niedrigen, eigennützigen Beweggründen ihren Vater und die beiden Brüder vergiftet sowie die Ermordung ihrer Schwester und ihrer Schwägerin geplant zu haben. Außer diesen Verbrechen hatte die Angeklagte sexuelle Exzesse gestanden, darunter sogar inzestuöse Verbindungen.
Die entsetzliche Geschichte rief allseitige Empörung hervor, und der Exekution der Giftmörderin wohnte eine große Menschenmenge bei. „Es ist geschehen; die Brinvilliers ist in der Luft, die wir atmen“, kommentierte Madame de Sevigne mit dem schwarzen Humor, dessen Meisterin sie war, und mit ihr tat ganz Frankreich einen Seufzer der Erleichterung, weil man sich von einem derartigen Ungeheuer befreit hatte. Damals konnte niemand ahnen, dass sich hinter diesem Ungeheuer eine ganze Welt verbarg, wo der Gebrauch von Gift gängige Praxis war. Freilich sollte diese Welt schon ein Jahr später Stück für Stück auftauchen, als eine neue gerichtliche Untersuchung eingeleitet wurde, die auf den glänzenden Hof des Sonnenkönigs düstere Schatten warf.
Begonnen hatte alles im Februar 1677 mit der Verhaftung von Magdeleine La Grange, einer Wahrsagerin, die beschuldigt wurde, mit Hilfe eines Priesters eine Scheinehe mit dem betagten Advokaten arrangiert zu haben, bei dem sie wohnte, um ihn dann zu vergiften und sein Vermögen zu erben. Es handelte sich um einen banalen Kriminalfall, der keine besondere Aufmerksamkeit erregt hätte, wenn die Angeklagte nicht behauptet hätte, sie wisse von einem Komplott, das den Tod des Königs und des Dauphins zum Ziel habe, und um eine Unterredung mit dem Kriegsminister gebeten hätte, dem mächtigen Marquis de Louvois. Als Ludwig XIV. von der Sache unterrichtet wurde, ließ er Madame La Grange aus dem Gefängnis von Vincennes in die Bastille verlegen, die den Staatsgefangenen vorbehalten war, und übertrug die Ermittlungen Nicholas Gabriel de La Reynie. Obwohl die Gefangene nur recht vage Enthüllungen machte, die eher an einen Kniff denken ließen, um Zeit zu gewinnen, kam La Reynie im Laufe der Ermittlungen zu der Überzeugung, dass es ein umfangreiches Netz von Kriminellen geben müsse, das die Stabilität des Staates bedrohte. Er fuhr also mit seinen Untersuchungen fort und vernachlässigte auch nicht das kleinste Indiz. Zu den ersten, die verhaftet wurden, gehörte der Cavalier de Vanens, der sich zwar rühmte, das Geheimnis der Herstellung von Gold zu kennen, es aber nicht verschmähte, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, indem er Leute auf Bestellung vergiftete. Es folgten Razzien bei Wahrsagerinnen, Hellseherinnen und Expertinnen in Liebesdingen, die bis jetzt noch keine Scherereien mit der Polizei gehabt hatten, bei denen man nun aber die schmutzigsten Geschäfte aufdeckte, vom Verkauf von Aphrodisiaka und Liebestränken bis hin zu allerlei Hexereien auf Bestellung und Hil-feleistung beim Abbruch unerwünschter Schwangerschaften. In Situationen, die drastischere Maßnahmen erforderten - gewalttätige Ehemänner, untreue Liebhaber oder vom Glück begünstigte Rivalinnen -, schreckten die geschäftstüchtigsten Wahrsagerinnen auch nicht davor zurück, zum Einsatz von Gift zu raten.
Im Februar 1677 wird erneut eine Mörderin festgenommen: Die vorsichtig gewordenen Pariser Beamten haben den plötzlichen Tod ihres Mannes genauer untersucht. Einmal in Haft, behauptet die Frau plötzlich, sowohl der König als auch der Thronfolger schwebten in Lebensgefahr und sollten von Geheimagenten vergiftet wer-den.
Obwohl sie keinerlei Beweise erbringt, beginnt La Reynie fieberhaft zu ermitteln. Noch hat sich die Aufregung um Madame de Brinvilliers nicht gelegt, ein Anschlag auf den König scheint immerhin möglich, auch Personen von Stand sind nicht mehr über jeden Verdacht erhaben.
Und ginge der Polizeichef den Hinweisen nicht nach - welch fürchterliche Folgen könnte dieser Irrtum haben!
Sind nicht auch Ludwigs Großvater und dessen Vorgänger ermordet worden?
Ab jetzt füllen immer neue Verdächtige das Verlies von Vincennes. Die meisten von ihnen gehören zu jener halbseidenen Zunft der Weissagerinnen, der ganz Paris seine Sorgen anzuvertrauen scheint. Im Januar 1679 erwähnt eine Verdächtige zum ersten Mal Personen am königlichen Hof als Kunden.
Nicolas de La Reynie erwartet noch größere Enthüllungen. Ludwig XIV bildet zudem eine 14köpfige Untersuchungskommission - ein Sondergericht nur für diese Affäre.
Das Parlement, der Hohe Gerichtshof von Paris, war stets nachsichtig mit einflussreichen Personen. Doch der König wünscht, dass auch Höflinge ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Außerdem hofft er, ohne das Parlement Informationen über die Affäre besser kontrollieren zu können: Falls Adelige in die Verbrechen verwickelt sind, sollen die Kommissionsmitglieder strenge Geheim-haltung bewahren.
La Reynie übernimmt einen der Posten, zudem wird er rapporteur und führt die Verhöre weiter - er ist in diesem Verfahren Richter, Ankläger und Ermittler.
In den Verhören fällt immer wieder der Name einer angeblichen Giftmischerin: Catherine Montvoisin. Am 12. März 1679 verhaften La Reynies Beamte die Weissagerin nach der Messe vor ihrer Kirche, wenige Schritte von ihrem Wohnhaus entfernt.
La Voisin bewohnt mit ihrem Mann und acht Kindern ein ansehnliches Haus mit einem Salon und eigenem Garten auf einem Hügel am Stadtrand, unmittelbar vor der geschleiften Stadtmauer. Viele Tischler arbeiten in dem Quartier, doch auch die Prostituierten stehen nur wenige Straßen entfernt.
Wenn La Voisin ihre Straße, die Rue Beauregard, stadtauswärts hin-aufschaut, sieht sie die Porte Saint-Denis, einen Triumphbogen, den Ludwig vor wenigen Jahren anstelle des Stadttors hat errichten lassen. Dort beginnt der Faubourg Saint-Denis. Und dort nimmt das Elend zu: In den Vorstädten leben besonders viele der Pariser Armen. Ludwig schenkt ihnen jedes Jahr 60 000 Livres, um sie über den Winter zu bringen.
La Voisin liebt den Wein, und sie wohnt am richtigen Ort: An der Hauptstraße von Saint-Denis verkaufen zahlreiche Kneipiers günstigen Alkohol, den die Pariser vor Ort trinken oder für daheim ab-füllen lassen. Mancher Kunde vergiftet sich, weil Wirte verschütteten Wein von der bleiernen Theke aufwischen und erneut in Gläser füllen.
Auch stadteinwärts geht es erst jüngst wieder sittsamer zu: Wenige Straßen südlich der Rue Beauregard liegt der Cour des Miracles, bis vor zehn Jahren der verkommenste Flecken der Stadt. Auf einem Hof hinter einem Konvent lebten hier Hunderte Verbrecher und Bettler mit ihren Familien (die wundersame Genesung der Krüppel, die abends gesund nach Hause zurückkehrten, hat dem Platz seinen Namen gegeben).
Die Kriminellen hatten einen eigenen Anführer und teilten sich in verschiedene „Zünfte“, etwa die der Taschendiebe und Bettler.
Nicolas de La Reynie hat den Slum mit 200 bewaffneten Männern und einem Trupp Pioniere kurz nach seinem Amtsantritt gestürmt und die Bewohner verhaftet oder ins Armenhaus gebracht.
In diesem Hopital-General, dessen Niederlassungen über Paris und die Vororte verteilt sind, wohnen rund 10 000 Menschen, die La Reynies Männer von den Straßen gesammelt haben. Ursprünglich als Haus für arbeitsfähige Arme geplant, ist es inzwischen mit anderen Insassen gefüllt: Waisenkindern, Greisen, Blinden, Todkran-ken, Verrückten und Syphilitikern.
Sicher treibt auch die Angst vor dem Armenhaus Menschen wie La Voisin dazu, die Leichtgläubigkeit ihrer Nachbarn auszunutzen.
Die große Mehrzahl der Pariser ist arm. Selbst wer Arbeit hat, kann seine Familie oft kaum ernähren. Ein Handwerker verdient höchstens 20 Sous am Tag, ein Pfund Fleisch kostet zwischen drei und acht Sous, zwei Liter Wein vier Sous. An 103 Tagen im Jahr darf er nicht arbeiten, zu den Sonntagen kommen zahlreiche kirchliche Feiertage.
Antoine Montvoisin, La Voisins Ehemann, war Seidenhändler und Juwelier. Doch er ist mit all seinen Geschäften bankrottgegangen. Trotzdem ist er wohl der reichste Mieter in seinem Haus, denn er wohnt im Erdgeschoss. Über seiner Familie leben Ärmere, je näher am Dach, desto billiger die Wohnung. Madame Montvoisin muss ihn und die acht Kinder durchbringen. Wohl deshalb nimmt sie gemeinsam mit einer befreundeten Hebamme Abtreibungen vor, obwohl darauf die Todesstrafe steht. La Voisin empfängt die Frauen in einem Gartenpavillon und verdient mehrere Tausend Livres im Jahr. Doch sie riskiert viel dabei: In einem Pariser Mietshaus leben die Leute eng aufeinander, die Türen stehen offen, und die Bewohner sind über die meisten Vorgänge im Haus gut informiert.
Am Ende aber werden nicht die Nachbarn La Voisin zum Verhängnis. Sondern ein ehemaliger Geliebter. Die kleine, dickliche Frau hasst ihren Mann. Mehrmals hat sie versucht, ihn zu vergiften, und höfliche Besucher fragten stets zur Begrüßung, ob Monsieur Montvoisin schon gestorben sei.
Einer ihrer zahlreichen Verehrer wird eine Woche nach La Voisin verhaftet und beginnt sofort zu reden. Vor zehn Jahren bereits ist ihm der Prozess wegen ähnlicher Geschäfte gemacht worden. Er hatte magischen Hokuspokus für seine Kunden durchgeführt und dabei möglicherweise Abendmahl und Bibel missbraucht - ein Sa-krileg. Zum Dienst auf den Galeeren verurteilt, ist er nach einigen Jahren begnadigt worden und nach Paris zurückgekehrt.
Der 50jährige gilt als unerreicht, was das Anbahnen von Ehen betrifft. Seine Spezialität aber ist ein Taschenspielertrick: Die Kunden, darunter viele Adelige, müssen ihre Wünsche auf ein Stück Papier schreiben, das der Magier zusammenknüllt und mit einem Knall in Flammen aufgehen lässt. Dann zieht er das unversehrte Dokument aus der Tasche. Sollte etwas Kompromittierendes darauf stehen, erpresst der angebliche Zauberer seinen Kunden. Die meisten Höflinge aber streben nur nach der Gunst des Königs, Glück in der Liebe und Erfolg an den Spieltischen von Versailles. Ihnen gibt der Mann den Zettel zurück und kassiert eine angemessene Belohnung dafür, ihre Wünsche an die Geisterwelt übermittelt zu haben.