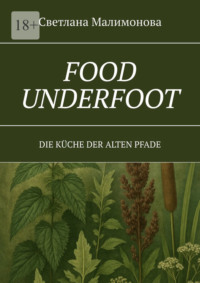Buch lesen: "Food underfoot. Die Küche der alten Pfade"
© Svetlana Malimonova, 2025
ISBN 978-5-0068-1208-6
Created with Ridero smart publishing system
Einleitung
Seit den frühesten Zeiten war der Mensch eng mit der Natur verbunden – nicht nur als ihr Beobachter, sondern auch als unmittelbarer Teilnehmer am großen Kreislauf des Lebens.
Noch bevor es Landwirtschaft, Supermärkte und Kühlschränke gab, lag die Nahrung nicht einfach in Regalen – man musste sie finden, erkennen, sammeln und haltbar machen. Auf langen Wanderungen und nomadischen Zügen nahmen unsere Vorfahren keine Vorräte mit – sie ernährten sich von dem, was die Erde ihnen schenkte: dem sogenannten “Futter vom Wegesrand”.
Für den Reisenden der Antike war dieses Futter kein ärmlicher Ersatz für Nahrung, sondern wahre Rettung: Blätter, Wurzeln, Beeren, Samen, Pilze, Triebe – all das wurde mit einer Meisterschaft verzehrt, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. In dem Kraut, das uns heute vielleicht nur wie “Grün am Straßenrand” erscheint, sahen die alten Völker Medizin, Nahrung oder Würze. Sie brauchten keine Geschäfte – Wald, Wiese, Moor und Berge waren ihre Vorratskammer.
Dieses Buch versucht, die verlorene Verbindung zwischen dem modernen Menschen und der Nahrung aus der Natur wiederherzustellen. Wir begeben uns auf eine Reise durch Zeiten und Orte, in denen Wildpflanzen die Grundlage der Ernährung bildeten. Wir erfahren, wie man Brot aus Eicheln, Suppe aus Brennnesseln, Marmelade aus Vogelbeeren, Tee aus Weidenröschen, Kaffee aus Löwenzahnwurzeln und vieles, vieles mehr zubereiten kann.
In diesem Buch finden Sie keine Rezepte mit Kartoffeln oder gekauftem Mehl – nur Zutaten aus Wildpflanzen, die jedem zugänglich sind, der bereit ist, hinaus aufs Feld oder in den Wald zu gehen und für sich neue (oder vielmehr längst vergessene alte) Geschmäcker zu entdecken.
In diesem Buch sind ausschließlich Rezepte mit Wildpflanzen enthalten; es gibt hier keine Angaben zu Pilzen, Fleisch oder anderer möglicher Nahrung, da dies jeweils eigene, sehr umfangreiche Themen sind, die in den Rahmen dieses Werkes nicht passen.
Das Wissen, das in diesem Buch vermittelt wird, ist recht umfassend, doch um es leichter zugänglich zu machen, ist das Wissen in einzelne Kapitel gegliedert. So können Sie sich zunächst mit dem befassen, was Sie am meisten interessiert: etwa die Herstellung von natürlichen Essigen oder pflanzlicher Milch aus Wildkräutern, von Öl, Brot oder Soßen. Danach können Sie sich mit anderem beschäftigen und sich Schritt für Schritt das gesamte Wissen aneignen.
Das Buch richtet sich an alle, die sich für die Natur interessieren, bewusster leben möchten, bereit sind, in der Küche zu experimentieren und sich wieder als Teil der großen natürlichen Welt fühlen wollen.
Vielleicht spüren Sie eines Tages den Geist des alten Wanderers, wenn Sie einen Korb in die Hand nehmen, wenn Sie einen Korb in die Hand nehmen und zum Sammeln von Kräutern aufbrechen – jenes Menschen, der sich einzig auf sich selbst, sein Wissen und das Futter vom Wegesrand verlässt.
Über den Autor.
Die Autorin dieser Ausgabe ist eine zertifizierte Biologin (UrSPU, Abschluss in Biologie, 1999; RUDN, Programm “Russische Kräuterkunde”, 2018), die viele Jahre ihres Lebens dem Studium der Volksmedizin und der Kräutertraditionen gewidmet hat.
Kapitel 1. Identifizierung und Sammlung
Das Sammeln von Wildpflanzen ist eine faszinierende Reise in die Welt der Natur, in der jedes Blatt, jeder Stängel oder jede Blüte zu einer Bereicherung Ihres Tisches oder sogar zu einem wertvollen Bestandteil der Hausapotheke werden kann. Diese Tätigkeit eröffnet Ihnen den Reichtum der wilden Flora, ermöglicht es, alte Traditionen zu berühren und die Verbindung zur Natur wiederherzustellen. Doch wie jede Kunst erfordert auch die Identifizierung und Sammlung Achtsamkeit und tiefes Wissen, denn unter den großzügigen Gaben der Natur verbergen sich gefährliche Täuschungen.
Warum es wichtig ist, Pflanzen identifizieren zu können
Wildpflanzen umgeben uns überall: in schattigen Wäldern, auf weiten Feldern und Wiesen, entlang verschlungener Pfade. Sie sind nicht nur eine Nahrungsquelle, sondern auch eine Quelle der Inspiration für kreative Entdeckungen. Die Natur ist vielfältig, und unter den nützlichen Arten finden sich auch solche, die der Gesundheit schaden können. Fehler bei der Bestimmung, wenn eine essbare Pflanze mit ihrem giftigen Doppelgänger verwechselt wird, können schwerwiegende Folgen haben. Deshalb ist die Fähigkeit, essbare Arten sicher zu bestimmen und von gefährlichen zu unterscheiden, die Grundlage eines sicheren Umgangs mit den Gaben der Natur.
Neben der Sicherheit trägt die richtige Identifizierung von Pflanzen auch zum Erhalt des Ökosystems bei. Wenn Sie wissen, welche Arten gesammelt werden dürfen und welche unberührt bleiben sollten, tragen Sie zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in der Natur bei. Ein solcher Ansatz fördert Beobachtungsgabe, Geduld und Respekt gegenüber der Umwelt.
Beispiele für giftige Doppelgänger
Um die Bedeutung der Aufmerksamkeit zu verdeutlichen, betrachten wir einige häufige Beispiele:
Bärlauch (Allium ursinum)
und Maiglöckchen (Convallaria majalis):

Der Bärlauch (Allium ursinum) ist für sein kräftiges Knoblaucharoma bekannt und wird in der Küche breit verwendet. Sein Aussehen erinnert jedoch an das Maiglöckchen (Convallaria majalis), dessen alle Pflanzenteile aufgrund des Gehalts an Convallatoxin giftig sind. Der Knoblauchgeruch ist hier ein zuverlässiges Merkmal, das den sicheren Bärlauch vom gefährlichen Maiglöckchen unterscheidet.
Echte Kamille (Matricaria recutita)
und Hundskamille (Anthemis cotula):

Die Echte Kamille (Matricaria recutita) wird wegen ihrer entzündungshemmenden und beruhigenden Eigenschaften geschätzt. Sie kann mit der Hundskamille (Anthemis cotula) verwechselt werden, die ihr ähnlich sieht, jedoch unangenehm riecht und allergische Reaktionen hervorrufen kann. Die Echte Kamille besitzt einen hohlen Blütenboden, im Gegensatz zur Hundskamille, deren Blütenboden gefüllt ist.
Tipp: Schneiden Sie den Blütenkopf leicht ein – bei der Kamille ist die Mitte hohl wie ein Röhrchen, bei der Hundskamille nicht. Außerdem riecht die Kamille angenehm süßlich, während die Hundskamille scharf und unangenehm duftet.
Adlerfarn (Pteridium aquilinum)
und Wurmfarn (z. B. Dryopteris filix-mas):

Der Adlerfarn (Pteridium aquilinum) ist einer der wenigen Farne, deren junge Triebe im sehr frühen Stadium (vor dem Entfalten der Blätter) essbar sind. Die jungen “Schnecken” sind nach zweifachem Einweichen in Salzwasser oder Abkochen genießbar und werden vor allem in Sibirien und in der ostasiatischen Küche geschätzt. Die ausgewachsenen Blätter sind hart und giftig. Erkennbar an den weit ausladenden, dreieckigen Wedeln, glatten Stielen ohne Schuppen; wächst an trockenen Waldrändern und Lichtungen. Der Wurmfarn (Dryopteris spp.), etwa der Gewöhnliche Wurmfarn (Dryopteris filix-mas), ist ungenießbar und leicht giftig. Seine Wedel sind dichter gefiedert, oft mit Schuppen an der Basis, und er wächst bevorzugt in feuchten Wäldern und Schluchten.
Tipp: Bei P. aquilinum sind die jungen Triebe glatt, ohne Schuppen, fast aufrecht, werden beim Kochen grün und brüchig. Bei Dryopteris sind die Triebe dichter, mit braunen Schuppen an der Basis, sie wachsen büschelig und schräg. Der Adlerfarn riecht beim Brechen frisch nach Kräutern, der Wurmfarn modrig.
Gemüse-Kratzdistel (Cirsium oleraceum)
und Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense):

Die Gemüsekratzdistel (Cirsium oleraceum) ist eine der mildesten und essbaren Arten mit blassgrünen, kaum bestachelten Blättern und hellgelben Blüten. Junge Triebe und Blätter sind zart und eignen sich zum Kochen oder Dünsten. Die Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) hingegen ist viel härter, hat stark bestachelte Blätter und purpurne Blüten. Ihre Wurzeln werden manchmal genutzt, die oberirdischen Teile sind jedoch zu zäh und bitter.
Tipp: Achten Sie auf die Blütenfarbe und die Dornen: Bei der Gemüsekratzdistel sind sie kaum vorhanden, die Blätter breit, weich und leicht gewellt. Bei der Ackerkratzdistel sind sie schmal, hart, mit spitzen Dornen, Blüten rosa bis violett. Außerdem wächst die Gemüsekratzdistel eher in feuchten, schattigen Lagen, die Ackerkratzdistel dagegen auf trockenen, sonnigen Feldern.
Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea)
und Seidelbast (Daphne mezereum):

Die Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea) ist ein niedrig wachsender, immergrüner Strauch mit kleinen, ledrigen, dunkelgrünen Blättern und leuchtend roten Beeren, die säuerlich-süß schmecken und frisch oder für Marmeladen, Kompotte und Säfte verwendet werden. Der Seidelbast (Daphne mezereum) ist ein bis 1 m hoher Strauch, dessen Blätter vor der Blüte abfallen. Im Frühling bleibt ein kahler Strauch mit hängenden rosafarbenen Blütenbüscheln zurück, später folgen glänzende rote Beeren. Alle Pflanzenteile sind giftig, besonders Rinde und Beeren.
Tipp: Bei V. vitis-idaea bleiben die Blätter auch im Winter erhalten, die Beeren wachsen in den Blattachseln, ihre Schale ist matt. Bei D. mezereum erscheinen die Blätter nach der Blüte, die Beeren hängen glänzend und weich an kahlen Zweigen.
Giersch (Aegopodium podagraria)
und Gefleckter Schierling (Conium maculatum):
Der Giersch (Aegopodium podagraria) ist essbar, mit zarten Blättern, geeignet für Salate und grüne Suppen. Er kann mit giftigen Doldenblütlern wie dem Gefleckten Schierling (Conium maculatum) verwechselt werden. Hilfreich ist der Geruch – frisch, krautig beim Giersch, unangenehm mausartig beim Schierling – sowie der Blattstiel mit Blattscheide.

Tipp: Beim Giersch umschließt der Blattstiel den Stängel, die Blätter sind “Gänsefüßchen” – dreiteilig. Beim Schierling sind violette Flecken am Stängel, der glatt und bereift ist, und er riecht nach Maus. Finger weg, wenn Sie Flecken sehen!
Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium)
und Riesen-Bärenklau (Heracleum sosnowskyi):

Der Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium) ist eine Wildpflanze, die in der Volksküche genutzt wird. Junge Blätter und Stiele sind frisch, eingelegt oder gekocht essbar, besonders in Suppen und Eintöpfen. Er wird bis 1,5 m hoch, hat weich behaarte Stängel, große, dreiteilige Blätter mit abgerundeten Zähnen und weiße bis rosafarbene Dolden. Sein Saft verursacht leichte Hautreaktionen, jedoch viel schwächer als beim invasiven Riesen-Bärenklau (Heracleum sosnowskyi). Dieser wird 3—4 m hoch, hat dicke Stängel mit violetten Flecken, scharf eingeschnittene Blätter und riesige Dolden bis 80 cm. Sein Saft ist stark ätzend und verursacht schwere Verbrennungen.
Tipp: H. sphondylium hat rundlichere Blätter, einen weichen Stängel, meist nicht höher als 1,5 m, schwach krautigen Geruch. H. sosnowskyi ist deutlich größer, mit Flecken am Stängel, scharfen Geruch und aggressivem Saft. Bei Zweifeln: meiden!
Spreizende Melde (Atriplex patula)
und Beifuß (Artemisia vulgaris):
Der Spreizende Melde (Atriplex patula) gehört zu den Amaranthgewächsen. Junge Blätter und Triebe sind essbar, erinnern an Spinat, werden frisch oder gekocht genutzt. Erkennbar an dreieckigen Blättern mit weißlichem Belag, verzweigtem Wuchs bis 70 cm. Der Beifuß (Artemisia vulgaris) ist würzig-bitter, in großen Mengen ungenießbar, enthält viele ätherische Öle. Er hat tief eingeschnittene Blätter, silbrig unterseits, wächst bis 1,5 m.

Tipp: Atriplex patula ist mild, weich und kaum bitter, während Artemisia vulgaris scharf und bitter schmeckt und stark riecht.
Wilde Möhre (Daucus carota)
und Wasserschierling (Cicuta virosa):
Die Wilde Möhre (Daucus carota) hat essbare Wurzeln und filigrane Blütendolden, sie ähnelt jedoch dem extrem giftigen Wasserschierling (Cicuta virosa). Unterscheidungsmerkmale: Geruch (Möhre angenehm, Wasserschierling unangenehm) und Wurzelform (beim Wasserschierling hohl und gefleckt).

Tipp: Reiben Sie die Wurzel zwischen den Fingern: die Möhre duftet angenehm, der Wasserschierling widerlich nach Maus. Außerdem hat die Wilde Möhre oft ein dunkles “Scheinsblütchen” in der Mitte, das dem Wasserschierling fehlt.
Techniken der Pflanzenbestimmung
Diese Beispiele zeigen: Visuelle Ähnlichkeit allein ist niemals ausreichend.
Achten Sie bei der Bestimmung jeder Pflanze auch auf Geruch, Textur, Blattform und Standort.
BESTIMMUNGSMETHODEN
Die Fähigkeit, Wildpflanzen zu erkennen, entwickelt sich mit der Zeit und durch Übung.
Es gibt verschiedene hilfreiche Methoden, die sich für unterschiedliche Situationen und Erfahrungsstufen eignen:
FELDFÜHRER
Feldführer sind handliche Bücher oder Broschüren mit Beschreibungen, Zeichnungen und Fotografien von Pflanzen.
Sie sind im Gelände unentbehrlich, da sie keinen Internetzugang erfordern.
Ein guter Feldführer sollte enthalten:
– Eine detaillierte Beschreibung äußerer Merkmale: Blattform, Stängelfarbe, Art des Blütenstands.
– Angaben zu Standort und jahreszeitlichen Merkmalen.
– Vergleiche mit ähnlichen Arten, einschließlich giftiger Doppelgänger.
Für Anfänger eignen sich Führer mit lebhaften Farbillustrationen.
Erfahrenere Sammler bevorzugen botanische Nachschlagewerke mit wissenschaftlicher Klassifikation.
Es ist ratsam, mehrere Quellen heranzuziehen, um die Vielfalt der lokalen Flora und die jahreszeitlichen Unterschiede zu berücksichtigen.
KONSULTATION MIT ERFAHRENEN SAMMLERN
Praktisches Lernen ist durch nichts zu ersetzen.
Das Studium mit erfahrenen Sammlern ist äußerst wertvoll.
Sie können Ihnen Pflanzen in ihrem natürlichen Lebensraum zeigen, auf wichtige Bestimmungsmerkmale hinweisen, regionales Wissen weitergeben und helfen, häufige Fehler zu vermeiden.
Beachten Sie dabei:
– Treten Sie lokalen ökologischen oder botanischen Vereinen bei.
– Beteiligen Sie sich an Foren oder sozialen Medien, die sich auf Wildpflanzen konzentrieren.
– Nehmen Sie an Bestimmungswanderungen, Exkursionen oder Workshops teil.
SELBSTSTUDIUM
Wenn Sie die Welt der Wildpflanzen lieber eigenständig erkunden möchten, beginnen Sie mit einer einfachen Methode:
– Wählen Sie 3—5 bekannte und leicht erkennbare Arten, zum Beispiel:
– Große Brennnessel (Urtica dioica)
– Gewöhnlicher Löwenzahn (Taraxacum officinale)
– Breitwegerich (Plantago major)
– Bärlauch (Allium ursinum)
– Studieren Sie ihr Aussehen, ihre Merkmale und ihr jahreszeitliches Wachstum mithilfe von Büchern und Online-Ressourcen.
– Unternehmen Sie Naturspaziergänge, beobachten Sie die ausgewählten Pflanzen und vergleichen Sie Ihre Beobachtungen mit den Recherchen.
– Erweitern Sie nach und nach Ihre Liste und festigen Sie Ihr Wissen durch wiederholte Praxis.
Diese Methode erfordert Geduld, führt jedoch zu einem tiefen Verständnis der lokalen Flora und zu größerer Sicherheit bei der Bestimmung essbarer Arten.
RESSOURCEN FÜR DAS SELBSTSTUDIUM
Online-botanische Datenbanken und Guide
Herbarium.live – Digitales Herbarium
https://herbarium.live/
– Sammlung hochwertiger Herbarbelege mit detaillierten wissenschaftlichen Beschreibungen.
Nützlich zur Bestimmung von Pflanzen, zum Vergleich mit Herbarstandards und zum Studium.
GBIF – Global Biodiversity Information Facility
https://www.gbif.org/
– Weltweite Datenbank für Biodiversitätsbeobachtungen.
Beinhaltet Verbreitungsdaten, Karten, Publikationen, Datenexport und Nachweise.
The Plant List
http://www.theplantlist.org/
– Umfassende taxonomische Datenbank der Pflanzen weltweit.
Ermöglicht die Suche nach lateinischen Namen, Synonymen und Autoren von Pflanzenbeschreibungen.
Plants of the World Online (Kew Gardens)
https://powo.science.kew.org/
– Autoritative Ressource der Royal Botanic Gardens, Kew.
Globale Pflanzendaten, Verbreitung, Ökologie und Taxonomie.
Interaktive Karten und floristische Atlanten
eFloras.org (einschließlich Flora of China, North America usw.)
http://www.efloras.org/
– Bietet detaillierte botanische Beschreibungen und Bestimmungsschlüssel.
Besonders nützlich zum Studium regionaler Floren.
BIN RAS Verbreitungskarten (GBIN – Russische Akademie der Wissenschaften)
https://www.binran.ru/resources/
– Spezialisierte wissenschaftliche Ressourcen zur Flora und Fauna Russlands.
Verbreitungskarten und wissenschaftliche Daten.
Mobile Applikationen (mit Fotoerkennung)
PlantNet
https://identify.plantnet.org/
– Kostenlose, gemeinschaftsbasierte App zur Pflanzenbestimmung.
Gute botanische Genauigkeit; Daten können nach GBIF exportiert werden.
iNaturalist
https://www.inaturalist.org/
– Ein Projekt der California Academy of Sciences und von National Geographic.
Fotoerkennung mit Bestätigung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft; Datenexport möglich.
Seek by iNaturalist
https://www.inaturalist.org/pages/seek_app
– Vereinfachte Version von iNaturalist für Kinder und Anfänger.
Keine Registrierung erforderlich; funktioniert auch offline.
Flora Incognita
https://www.floraincognita.com/
– Sehr präzise europäische App, entwickelt von der TU Ilmenau.
Wissenschaftliche Beschreibungen, Schutzstatus und häufige europäische Pflanzen.
PictureThis
https://www.picturethisai.com/
– Kommerzielle App mit kostenloser Testphase.
Bietet Pflanzenerkennung, kurze Beschreibungen und Pflegetipps.
Grundsätze der Sicherheit beim Sammeln
Das verantwortungsvolle Sammeln von Wildpflanzen bedeutet nicht nur, Nahrung oder Heilmittel zu finden – es geht ebenso darum, die Natur zu achten und zu schützen.
Befolgen Sie diese Grundsätze, um sicher zu bleiben und nachhaltig zu ernten.
Den richtigen Zeitpunkt und Ort wählen
– Zeitpunkt der Sammlung: Am besten sammelt man am Morgen – die Pflanzen sind frisch, kräftig und reich an Nährstoffen. Am Nachmittag, besonders bei Hitze, können sie welken oder einen Teil ihrer wertvollen Eigenschaften verlieren. Nach Regen verderben viele Pflanzen schneller.
– Sammelorte: Wählen Sie saubere, unbelastete Gebiete, weit entfernt von Straßen, Industrieanlagen oder Feldern mit Pestizideinsatz. Wälder, Wiesen, Naturschutzgebiete und Nationalparks (wo Sammeln erlaubt ist) sind gute Optionen.
Werkzeuge für sicheres und nachhaltiges Sammeln
Die richtigen Werkzeuge machen das Sammeln sicherer und effizienter:
– Schere oder Gartenschere: Scharfe Werkzeuge ermöglichen einen sauberen Schnitt, verringern Schäden und schonen die Wurzeln.
– Körbe oder Baumwolltaschen: Luftdurchlässige Behälter verhindern Überhitzung und Feuchtigkeitsstau und halten die Ernte frisch.
– Handschuhe: Wichtig zum Schutz vor Brennhaaren, Dornen oder reizendem Pflanzensaft.
Ökologisches Sammeln praktizieren
Ernten Sie so, dass sich die Natur regenerieren kann:
– Reißen Sie Pflanzen nicht vollständig aus: Nehmen Sie nur das, was Sie brauchen – Blätter, Blüten oder Samen – und lassen Sie die Wurzeln möglichst unberührt.
– Sammeln Sie maßvoll: Entnehmen Sie nicht mehr als 10—20% einer Art pro Standort, um die Bestände gesund zu erhalten.
– Respektieren Sie seltene Arten: Lernen Sie, geschützte oder gefährdete Pflanzen zu erkennen, und verzichten Sie gänzlich auf deren Ernte.
Saisonalität der Ernte
Die Natur lebt in Zyklen, und jede Jahreszeit schenkt ihre eigenen Pflanzen:
– Frühling: Zeit des Erwachens. Junge Blätter und Triebe von Brennnessel, Löwenzahn, Giersch und Wegerich sind besonders nährstoffreich. Essbare Blüten wie Veilchen, Schlüsselblumen und Bärlauch eignen sich frisch, für Tees oder Tinkturen.
– Sommer: Die Natur erblüht und Früchte reifen. Holunderblüten, Lindenblüten und Kamille für Aufgüsse, Früchte wie Himbeeren, Brombeeren, Hagebutten und Heidelbeeren für Marmeladen oder zum Trocknen.
– Herbst: Zeit des Sammelns und Vorratens. Wurzeln wie Klette, Quecke und Löwenzahn, dazu Nüsse und Samen – Haselnüsse, Eicheln, Esskastanien. Späte Beeren wie Schneeball oder Vogelbeere sind vitaminreich.
– Winter: Auch im Winter bietet die Natur Geschenke. Nadeln von Kiefer, Fichte oder Zirbe liefern vitaminreiche Tees. Birken- oder Weidenrinde für Abkochungen. Wenn der Boden nicht gefroren ist, können Klette- oder Zichorienwurzeln geerntet werden.
Regionale Besonderheiten
Jede Landschaft prägt ihre Flora:
– Wälder: Brennnesseln, Bärlauch, Farntriebe sowie Beeren wie Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und Preiselbeeren. Auch Pilze – sammeln Sie diese nur bei sicherer Kenntnis.
– Steppen: Reich an Kräutern wie Amarant, Sauerampfer, Jakobskreuzkraut, Kamille, Wermut und Schafgarbe.
– Moore und Feuchtgebiete: Preiselbeeren, Moltebeeren und Spezialpflanzen wie Sumpfporst (Ledum), der wegen seiner Giftigkeit mit Vorsicht zu behandeln ist.
– Gebirge: Beherbergen seltene und geschützte Arten wie Rosenwurz (Rhodiola rosea) oder Edelweiß (nicht zu ernten!). Essbare alpine Pflanzen sind Himbeeren, Heidelbeeren und Sanddorn.