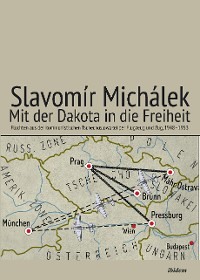Buch lesen: "Mit der Dakota in die Freiheit"
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Tschechoslowakei an der Schwelle des Kommunismus
3. Landesflucht mit dem Flugzeug
4. Der Fall Huňáček
5. Der Fall Tvarožek
6. Die Aktion Erding
7. Slovák und die Aktion březen
8. Der Zug in die Freiheit und die Aktion Selb
9. Abschließende Überlegungen
10. Literatur- und Quellenangaben
Über den Autor
1. Einleitung
Landesfluchten – dieses Phänomen findet sich überall dort, wo es undemokratische Verhältnisse gibt. Es gibt sich zahlreiche Beispiele und Schicksale, bei denen sich die Flucht aus dem Heimatland als die einzige Alternative zeigte, auch in der tschechischen und slowakischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, insbesondere zur Zeit der totalitären Regimes.
Das vorliegende Werk befasst sich mit Fluchten aus der Tschechoslowakei (ČSR) in den Jahren 1948–1953: Dabei werden die Einzelfälle von vier Entführungen von Zivilflugzeugen und eines Personenzugs und die darauf folgende „Antwort des kommunistischen Hammers“, der tschechoslowakischen Staatssicherheit (ŠtB), betrachtet. Auch die mit den Entführungen verbundenen auswärtigen politischen Zusammenhänge und die daraus entstandenen Folgen werden beleuchtet.
Mit der Machtübernahme des kommunistischen Regimes in der ČSR und infolge seines totalitären Charakters begannen die Fluchtwellen – Menschen suchten ihr Heil, ihre Freiheit und ein neues Zuhause in der Flucht. Fluchtbewegungen in die Demokratie, egal ob aus wirtschaftlichen, politischen oder sozialen Gründen, prägten das gesamte 40-jährige Bestehen des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei.
Zu dieser Thematik liegen heute umfangreiche, doch keineswegs erschöpfende Literaturquellen vor. Auch zahlreiche Historiker und Amateurhistoriker haben sich diesem Thema gewidmet. Für alle Quellen gilt, dass sie die Thematik mal mehr, mal weniger umfassend behandeln.1 Keines der im Folgenden zitierten Werke soll daraufhin bewertet werden.
Der Aufbau der vorliegenden Studie ist durch den Ablauf der beschriebenen Ereignisse, die Zugänglichkeit des Archivmaterials und den Stand der Forschung geleitet.
Im ersten Kapitel wird die innen- und außenpolitische Entwicklung der Tschechoslowakei während der Entstehungsphase des tschechoslowakischen Kommunismus kurz und übersichtlich dargestellt. Auf diese Weise soll es dem Leser ermöglicht werden, den zeitgeschichtlichen Kontext zu erfassen. Während die innenpolitische Situation vor allem anhand der politischen Gegebenheiten beleuchtet wird, wird die außenpolitische Situation insbesondere anhand der Beziehungen von Prag zu Moskau und zu Washington dargestellt. Das zweite, ebenfalls einführende Kapitel legt den Grundstein für die weiteren Ausführungen. Es bietet einen kurzen Überblick über bekannte und weniger bekannte Fluchten aus der Tschechoslowakei, die mithilfe von Entführungen von Verkehrs- oder Kleinflugzeugen auch zu einem späteren Zeitraum durchgeführt wurden.
Die darauf folgenden Kapitel bilden den inhaltlichen Kern des Werks. Hier werden mehrere Fluchten mithilfe von Flugzeugen des Typs Dakota auf innerstaatlichen Flügen der Tschechoslowakischen Fluglinien (ČSA) analysiert, die einen gemeinsamen Nenner finden: die Vergangenheit der Akteure, die im Zweiten Weltkrieg bei den Britischen Luftstreitkräften (RAF) als Piloten, Navigatoren und Flugzeugmechaniker dienten. Das letzte Kapitel behandelt einen Sonderfall, der jedoch für die Gesamtbetrachtung von Bedeutung ist: Denn eine Flucht in den Westen mit einem entführten Zug ist in der Geschichte des totalitären Regimes wahrhaftig ein Einzelfall.
Das vorliegende Werk konzentriert sich nicht nur auf die Darstellung einzelner Fluchten in die Freiheit, sondern bietet einen weiteren wichtigen Beitrag mit der Beschreibung der Reaktion der ŠtB als polizeiliches, repressives Werkzeug des Regimes, das eine Reihe von politisch motivierten Gerichtsprozessen und Inhaftierungen von Familienangehörigen und Bekannten der Akteure der behandelten Entführungen auslöste. Dieser Aspekt wurde in der bisher vorliegenden Literatur vernachlässigt. Auch die Perspektive der tschechoslowakisch-amerikanischen Beziehungen zu dieser Thematik wurde bislang zu wenig betrachtet. Dabei wissen wir aus Archivdokumenten, dass das Thema Gegenstand der bilateralen Diplomatie war. Die Darstellung dieser Perspektive ist Teil des kollektiven Gedächtnisses und wird im Folgenden näher beleuchtet.
Die Materialbasis für die vorliegende Studie bilden mehrere Archive in Prag – Státní oblastní archiv (Staatliches Gebietsarchiv, SOA), Národní archiv (Nationalarchiv, NA), Vojenský ústrední archiv (Militärhistorisches Zentralarchiv, VAA), Archiv bezpečnostních složek (Archiv der Sicherheitskräfte, ABS) und das Archiv Ministerstva zahraničných vecí (Politisches Archiv des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, AMVZ) – und in Bratislava – Archív Ústavu pamäti národa (Archiv des Instituts für das Volksgedächtnis, AÚPN) und das Štátny archív (Staatsarchiv, SA). Für ausführlichere Analysen zu einigen Fragen fehlen jedoch Unterlagen, die weder durch die einschlägige Literatur noch zeitgenössisches Pressematerial ersetzt werden können. Es kann nur angenommen werden, dass künftige Forschungsarbeiten den Wissensstand über die behandelten Fragen noch erweitern werden.
Zur Einführung soll noch die Frage beantwortet werden, warum dieses Werk überhaupt entstanden ist. Im Allgemeinen besteht eine Notwendigkeit, Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit, die bisher nicht vollständig bearbeitet wurden, zu analysieren. Aber auch ganz persönlich entstand der Wunsch, die Erfahrungen, Siege und Niederlagen der Menschen jener Zeit genauer zu untersuchen und uns ihre Taten, die durch das Regime hervorgerufen wurden und die in die Geschichte eingingen, wieder vor Augen zu führen.
Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich mit dem Zeitraum von 1948 bis 1953, auch wenn noch später ähnliche Fluchten vorkamen. Die Geschichten der Dakotas in die Freiheit und des Zugs nach Selb sind jedoch Kapitel der europäischen Zeitgeschichte, die deutlich zwei Gegenpole zeigen – den Charakter des von Prag aus diktierten kommunistischen Regimes und den Wert der westlichen Demokratie und der individuellen Freiheit.
1 Jiřík, Václav. Vlak svobody, kniha reportáží z moderných dějin [Der Zug in die Freiheit, ein Buch mit Reportagen aus der neueren Geschichte]. Cheb: Svět krídel, 1999; Keller, Ladislav-Koverdynský, Bohdan. Únosy dopravních letadel 1945-1992 [Entführungen von Verkehrsflugzeugen 1945-1992]. Cheb: Svět křídel, 2012; Navara, Luděk. Hrdinové železné opony [Helden des Eisernen Vorhangs]. Brno, 2004; Pejčoch, Ivo. Hrdinové železné opony [Helden des Eisernen Vorhangs]. Cheb: Svět křídel, 2008; Pejskar, Jožka. Útěky železnou oponou [Flucht durch den Eisernen Vorhang]. Zürich, 1989; Ruml, Karel. Z denníka vlaku svobody [Aus dem Tagebuch des Zugs in die Freiheit]. Brno. Barrister & Principal, 2001; Truksa, Karel – Konvalinka, Jaroslav – Kraus, František. Za sluncem svobody [Der Sonne der Freiheit hinterher]. Perth Amboy. Slovenský Sokol, 1951; Vaněk, Pavel. Pohraniční stráž a pokusy o prechod státní hranice v letech 1951-1955 [Grenzschutzbeamte und Versuche, die Staatsgrenze in den Jahren 1951-1955 zu überschreiten]. Praha. ÚSTR, 2008.
2. Die Tschechoslowakei an der Schwelle des Kommunismus
Die Jahre 1948 und 1989 sind die Grenzmarker der tschechoslowakischen kommunistischen Ära. Sie beschreiben den Zyklus eines Experiments, stehen für seine Entstehung, Entwicklung sowie sein Ende und zeigen das historische Ausmaß einer nie wieder zurückkehrenden Vergangenheit.
Das kommunistische Regime lässt sich durch einige substantielle Eigenschaften charakterisieren. Dazu gehörten eine diktatorische Regierungsart, das Monopol der Staatspartei und ihrer Polizei, die Beseitigung politischer Gegner, die Durchsetzung einer zentralen und direktiven Wirtschaftsplanung, eine marxistisch-leninistische Ideologie und Propaganda sowie die Unversöhnlichkeit mit dem Imperialismus und der Kampf gegen ihn. Die innenpolitische Diktatur wurde von der Kommunistischen Partei bestimmt, die innerhalb von wenigen Jahren alle politischen, ökonomischen, kulturellen und moralischen Bereiche des Landes sowie des Lebens unzähliger Menschen komplett übernahm. Verbunden damit waren außenpolitische Aspekte, etwa das Schließen des Eisernen Vorhangs unter der Ägide des Moskauer Kremls sowie die konsequente Propaganda, dass der Westen bestrebt sei, das gerade weltweit entstehende, gerechte sozialistische System zu vernichten. Laut dieser Propaganda wurde der Kommunismus ebenso von „Verrätern“ untergraben, die einzeln oder in Gruppen, zu Fuß über natürliche Landesgrenzen, mit Autos oder Flugzeugen flohen. Tausende erlangten auf diese Weise die Freiheit, doch Zehntausende ihrer Familienmitglieder, Freunde oder Bekannten in der ČSR wurden für diese Freiheit durch die tschechoslowakische Staatssicherheit (ŠtB) liquidiert. Insbesondere für den behandelten Zeitraum, der Gründungszeit des kommunistischen Totalitarismus, war eine solche sogenannte „Reinigung“ der Gesellschaft prägend.
Gleichzeitig war auch das kommunistische totalitäre System – wie alle politischen Regime – von Änderungen gekennzeichnet. Es entstand in der Phase des Hochstalinismus, erlebte in den Jahren 1948–1953 die „Eiszeit“, ein mäßiges Tauwetter im Jahr 1956 nach Abflachung des Personenkults um Stalin, das jedoch in den 1960er Jahren während der Krise und der Reformversuche wieder abkühlte. Nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen 1968 geriet das Land in das Feuer des Neostalinismus, das 1989 endgültig erlosch.
Das kommunistische totalitäre System in der Tschechoslowakei formte sich 1948 innerhalb von wenigen Monaten nach dem Prager Februarumsturz. Kaum jemand war sich damals des Ausmaßes der damit verbundenen politischen Änderungen bewusst. Edvard Beneš verblieb im Amt des Präsidenten. Die Nationalfront als politische Vereinigung wurde formal aufrechterhalten, doch veränderte sich ihre Ausrichtung. Sie wurde zu einer politischen Fassade, hinter der sich die kommunistische Diktatur versteckte.
Grundlegende Veränderungen in der tschechoslowakischen Gesellschaft betrafen Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auch die Bereiche Wirtschaft, Sozial- und Schulwesen und Kultur. Unmittelbar nach dem Februarumsturz 1948 wurde die zweite Etappe der Verstaatlichung und die dritte Etappe der Grundstücksreform verabschiedet. Am Jahresende wurden Maßnahmen zur „Einschränkung und Verdrängung kapitalistischer Elemente“ und zur Beseitigung des Gewerbes ausgelöst. 1949 begann die Kollektivierung der Landwirtschaft, die nach einer kurzen Pause zwischen 1953–1955 über ein Jahrzehnt andauerte.1 Die tschechoslowakische Wirtschaft wurde strukturell umgebaut und dabei auf den Aufbau der Schwerindustrie ausgerichtet. Die Tschechoslowakei wurde zu einer „Weltmacht des Ostblocks im Maschinenbau“. Bestandteil dieser wirtschaftlichen Neuausrichtung der ČSR war auch die Industrialisierung der Slowakei, in der aus strategischen Gründen der Ausbau der Schwerindustrie, u.a. der Rüstungsproduktion, priorisiert wurde.2 Es wurde ein neues einheitliches Schulsystem eingeführt und die Ikonografie des Sozialrealismus in der Kunst wie in der Belletristik als auch die marxistisch-leninistische Methodologie und Ideologie in den Sozialwissenschaften durchgesetzt3, ebenso wie die Säkularisierung und Atheisierung der Gesellschaft. Zu den Eingriffen in das Eigentum, die zwischenmenschlichen Beziehungen, Kultur, Tradition sowie den Alltag gehörten kommunistische Gewalt und Terror. Die Menschen wurden aus politischen, sozialen sowie religiösen Gründen diskriminiert. Für das kommunistische Regime besonders gefährlich waren aktive Teilnehmer der zweiten Widerstandsbewegung, die in den tschechoslowakischen Streitkräften oder im Dienst der Royal Air Force (RAF) an der Seite der Alliierten gekämpft hatten. Diese ‚Westler‘ wurden nach dem Februarumsturz 1948 ungeachtet ihrer (zivilen oder militärischen) Orientierung als die größten inländischen Feinde eingestuft.
Die genannten tiefgreifenden totalitären Umbrüche in der tschechoslowakischen Gesellschaft führten zu zahlreichen Fluchtbewegungen über die Landesgrenzen. Diese Fluchten sind bis heute nicht vollständig wissenschaftlich bearbeitet und sie sind auch heute noch aktuell und interessant. Die ersten Fluchtbewegungen erfolgten nach dem „Siegesfebruar“ als direkte Folge der Machtübernahme der tschechoslowakischen Kommunisten, die mit ihrem verlängerten Arm, der ŠtB, reale oder fiktive Feinde der „Diktatur des Proletariats“ in Schauprozessen beseitigten. Die Schauprozesse Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre werden heute zu Recht als dunkles Kapitel der jüngeren Zeitgeschichte betrachtet. Sie vereinte ihre Rechtlosigkeit.4 Die Schauprozesse bedienten sich erzwungener Geständnisse und sie verletzten grundlegende Menschen- und Bürgerrechte. Sie betrafen die gesamte Gesellschaft, alle soziale Schichten der Bevölkerung.
Die Funktionen der Schauprozesse im behandelten Zeitraum waren vielfältig. Es ist schwer zu bestimmen, welche Funktion am bedeutendsten war, doch das bereits erwähnte Bestreben, die Gegner des kommunistischen Regimes zu beseitigen, zu bestrafen und auszuschalten stand zweifellos im Vordergrund. Das Wecken von Ängsten bei der Bevölkerung war ein bedeutendes Mittel der Einschüchterung. Eine wichtige Rolle bei den Schauprozessen spielte die ŠtB, die vor allem eine politische Polizei war. Sie unterstützte und schützte das kommunistische Regime und arbeitete aktiv an seinem Aufbau. Selbstverständlich war sie weder anonym noch namenlos. Im Gegenteil, sie bestand aus Menschen, Tschechen und Slowaken, die sich als vorbildliche Schüler sowjetischer Lehrer und Berater erwiesen. Die Fänge der ŠtB waren überall präsent – in Städten, Dörfern, Regionen, gesellschaftlichen Organisationen, Schulen, Unternehmen und Genossenschaften, überall dort, wo Menschen waren. Im Verhör setzte die ŠtB eine Kombination zweier Methoden ein: physische Gewalt und psychischen Terror. Durch den gezielten und abwechselnden Einsatz dieser Methoden, gelang es, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Physische und psychische Gewalt wurde von Fall zu Fall unterschiedlich eingesetzt. Es gab ein breites Spektrum an Mitteln: langer Aufenthalt im Gefängnis, Einzelhaft, brutale Folter, Züchtigung, nächtliche Verhöre, Verweigerung von Schlaf und Trinken, Demütigung, Einschüchterung der Verwandten, unrealistische Versprechungen u. ä.
Die ŠtB arbeitete bei der Vorbereitung der Schauprozesse nach einem bestimmten Muster: Festnahme des Opfers, Untersuchungshaft, totale Isolierung des Beschuldigten, für den keine Gesetze und kein Recht mehr galten. Er war nun kein Mensch mehr, sondern nur eine Nummer, ein bereits vorab verurteilter Verbrecher. Der Beschuldigte war der Willkür des Ermittlers ausgesetzt. Die Verhöre wurden sorgfältig vorbereitet. Kooperierte der Verhörte, so wurde er von physischer und psychischer Gewalt verschont. Andernfalls wurde Gewalt angewandt, und früher oder später knickte jeder ein.
Der Beschuldigte stand nicht allein unter Beobachtung. Die ŠtB baute gleichzeitig ein Netz aus Komplizen und Zeugen auf. Als Grundlage dienten Aussagen von Bekannten oder Verwandten. Es entstand ein detailliert ausgearbeitetes Drehbuch, nach dem die ŠtB handelte. Auch gerichtliche Verhandlungen vor dem Staatsgericht oder dem Obersten Gericht hatten ein eigenes Muster. Es handelte sich meist um öffentliche Schauprozesse, bei denen der Senatsvorsitzende und der Staatsanwalt die Zuschauer aktiv in das Geschehen einbanden. Es war ein psychologisches Spiel, eine clevere Nutzung von Massenpsychologie. So durfte bei keinem der Prozesse die Geräuschkulisse fehlen, etwa Empörungsschreie, der Ausdruck von Ärger und Freude über die Enthüllung einer staatsfeindlichen Verschwörung, die durch die Beschuldigten, die angeblich in Diensten von Imperialisten, Trotzkisten, Zionisten oder bürgerlichen Nationalisten standen, vorbereitet worden war. Zu diesem ‚Theaterstück‘ gehörte auch die Verteidigung. Bei den Verteidigern handelte sich zumeist um von Amts wegen bestellte Anwälte, die die Beschuldigten nicht tatsächlich verteidigten, sondern – überzeugt von deren Schuld – nur die Feststellung mildernder Umstände forderten, sofern der Angeklagte seine Schuld vollständig und freiwillig gestand. Ein im Namen der Republik verkündeter Schuldspruch sollte auf die Gesellschaft erzieherisch wirken: Todesstrafe, lebenslange oder langjährige Gefängnisstrafen drohten den Angeklagten. Manchmal konnten diese Strafen durch ein Versprechen auf Kollaboration abgewendet werden.
Die politische Verfolgung gehört zu den grundlegenden Eigenschaften des kommunistischen Regimes. In Tschechien und in der Slowakei sind bis heute vor allem die bekannten öffentlichen Schauprozesse gegen die nicht kommunistische Elite (Rudolf Slánský, Vladimír Clementis, Milada Horáková usw.) bekannt, die zum Ziel hatten, Regimegegner aufzuspüren und zu liquidieren. Ebenso bekannt sind auch die Schicksale politischer Flüchtlinge des sog. dritten tschechoslowakischen demokratischen Exils, das hauptsächlich aus Persönlichkeiten aus den Reihen der nicht kommunistischen politischen Parteien und der tschechoslowakischen Diplomaten bestand (Hubert Ripka, Petr Zenkl, Jozef Lettrich, Štefan Osuský, Ján Papánek und weitere). Doch auch Tausende gewöhnliche Slowaken und Tschechen lehnten die totalitäre kommunistische Tschechoslowakei unter Moskauer Patronat ab und flohen über vier Jahrzehnte in die demokratische Welt.
Die Flucht in den demokratischen Westen war für viele in der ČSR der einzige Ausweg. Für andere bedeutete sie die Gelegenheit, frei zu leben. Nicht allen gelang die Flucht. Ein passiver, schweigender und in Fünfjahresplänen gefangener Teil der Gesellschaft wurde in eine Zwangsjacke geschnürt, durch eine Gruppe, die für ihre Hörigkeit dem Regime gegenüber und ihre Aktivitäten nicht unbedeutende Vorteile erhielt.
Bis heute ist die genaue Anzahl der im Laufe der vierzig Jahre der kommunistischen Herrschaft durchgeführten Schauprozesse unbekannt. Wir wissen aber, dass die untere Grenze bei 240 000 Fällen liegt, da dies die Anzahl der Personen ist, die nach einem 1990 verabschiedeten Gesetz rehabilitiert wurde. Und auch wenn diese Zahl schockierend sein mag, so kann sie nicht deutlich machen, welche Bedeutung die Schauprozesse hatten. Es waren nämlich nicht nur die Angeklagten oder ihre Familien und Freunde direkt betroffen, sondern die gesamte Gesellschaft, die langfristig unter dem Einfluss des totalitären Regimes stand, der sich auf alle Lebensbereiche auswirkte.
Hier sollen nur einige Beispiele für Schauprozesse genannt werden, wobei die ersten bereits im Frühling 1948 erfolgten. 1950 fand ein bekannter Musterprozess gegen Milada Horáková und andere und gegen eine Gruppe ehemaliger slowakischer Partisanen, Viliam Žingor und andere, statt. Im Januar 1951 wurde vor dem Staatsgericht Bratislava ein inszenierter politischer Prozess gegen die „landesverräterischen“ römisch-katholischen Bischöfe Michal Buzalka (Trnava) und Ján Vojtaššák (Spiš) sowie gegen den griechisch-katholischen Bischof Pavol Gojdič (Prešov) geführt. Buzalka und Gojdič wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen, Vojtaššák zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Gerichtsprozess war Bestandteil der Kampagne gegen die katholische Kirche in der Slowakei. Diesem Prozess gingen zwei ähnliche Prozesse in Tschechien voraus. Bei ersterem handelte es sich um einen Prozess gegen Vertreter des Ordens, bei dem zweitem um einen gegen bischöfliche Gehilfen. Das politische Ziel dieser Prozesse war, die Kirchenhierarchie vor der gläubigen Gesellschaft und Geistlichkeit als einen Staatsfeind und den Vatikan als ein Werkzeug des amerikanischen Imperialismus zu „entlarven“.
Anfang Juli 1951 beschäftigte ein Schauprozess die Weltöffentlichkeit: William N. Oatis, Journalist der Associated Press, wurde der staatsfeindlichen Verschwörung beschuldigt und zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die größte Aufmerksamkeit erreichte jedoch der im November 1951 geführte Prozess gegen die vermeintliche Führung einer staatsfeindlichen Verschwörung unter der Leitung von Rudolf Slánsky, dem ehemaligen Generalsekretär des Zentralausschusses der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Dies war der größte und brutalste Prozess gegen kommunistische Funktionäre der Tschechoslowakei. Die Anklage enthielt Beschuldigungen des Hochverrats, der Spionage, Sabotage und des militärischen Verrats in unterschiedlichen Varianten. Von 14 Angeklagten wurden elf Personen zum Tode, die restlichen drei zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Todesurteile wurden am 3. Dezember 1952 vollstreckt. Unter den Verurteilten und Hingerichteten war Vladimír Clementis, der von 1948–1950 tschechoslowakischer Außenminister und ein linker Intellektueller war, ein Kommunist, der den sowjetisch-deutschen Molotow-Ribbentrop-Pakt von 1939 sowie den aggressiven sowjetischen Angriff auf Finnland 1940 scharf verurteilt hatte.
Das Ende der 1940er und der Anfang 1950er Jahre des 20. Jahrhunderts gelten als die Hochzeit des Kalten Krieges. Die Welt der Supermächte und ideologischen Gegenpole, der USA und der UdSSR, sowie ihrer Satellitenstaaten war auf der Suche nach einer neuen Weltordnung. Die Bedrohung eines neuen Weltkrieges zwischen den Ländern, die vor kurzem noch Verbündete waren, bestimmte die internationale Entwicklung. Während der demokratische Westen unter dem Schutz der USA als mehr oder weniger homogene Einheit ohne innere Konflikte funktionierte, entbrannte im Ostblock unter Moskauer Patronat ein innerer Prozess der ideologischen Säuberung in den eigenen Reihen.
Wie entwickelte sich die internationale Bedeutung der Tschechoslowakei nach Februar 1948? Die Spaltung Europas und schließlich der Welt in Interessensphären, später in Blöcke, war nicht vorab geplant, doch wahrscheinlich unabdingbar. Genauso unausweichlich schien die Rolle der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen zu sei, die sie unter den Schutz des Kremls stellte.
Die Februarereignisse von 1948 und der tragische Tod des Außenministers Jan Masaryk am 10. März des gleichen Jahres lösten im Westen eine Welle des Entrüstung aus, doch dies führte nicht zu der Entscheidung, einzugreifen. Dabei hofften viele in der Tschechoslowakei, dass die USA sich als führende westliche Weltmacht aktiv in die Verteidigung der tschechoslowakischen Demokratie einschalten würde. Allerdings bemühte sich Washington nur wenig um das eigentlich geopolitisch wichtige Gebiet, in dem sich die Tschechoslowakei befand. Das Außenministerium der USA erklärte am 26. Februar 1948, dass die Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens und Frankreichs nach sorgfältiger Beobachtung der Ereignisse in der Tschechoslowakei gemeinsam Stellung bezogen. Laut der Regierungen wurden in der ČSR bestimmte, bereits in anderen Ländern genutzte Methoden eingesetzt, die mithilfe einer künstlich und absichtlich herbeigerufenen Krise die Auflösung der parlamentarischen Demokratie und die Errichtung einer unter dem Mantel der Nationaleinheit verhüllten Diktatur einer Partei ermöglichten, sodass sie dieses Ereignis und die möglichen katastrophalen Folgen für das tschechoslowakische Volk, das während des zweiten Weltkrieges seinen Freiheitswillen bewiesen hatte, verurteilten.5 Und obwohl die Entwicklung in der Tschechoslowakei scharf verurteilt wurde, blieb es bei verbalen Appellen.
In diesem Sinne veröffentlichte auch die westliche fünfte Weltmacht, die Presse, Berichte, Leitartikel, Kommentare und Analysen. Alle bedeutenden US-amerikanischen Tageszeitungen reagierten nahezu einheitlich. Laut New York Herald Tribune hatten die amerikanischen Amtsvertreter die Hoffnung auf die Rettung der Tschechen bereits eine Woche zuvor aufgegeben, da der bekannte Plan eines kommunistischen Putschs bereits in Gang gesetzt worden war.6
Am 25. Februar 1948 (und am 10. März 1948) reagierte auch Ján Papánek, Botschafter und Ständiger Vertreter der Tschechoslowakei bei den Vereinten Nationen (VN), der von der Leitung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten kurz nach seinem Protest gegen den Februarumsturz seines Amtes enthoben worden war. Er legte dem Generalsekretär der VN, Trygve Lie, ein Schreiben vor, in dem er den Weltsicherheitsrat der VN ersuchte, sich mit der Tschechoslowakei gemäß Artikel 34 der Charta (Situation der Gefährdung der internationalen Sicherheit und des Friedens) zu befassen. Er führte an, dass die Lage in der Tschechoslowakei auf Druck der Sowjetunion entstanden sei. Das Schreiben wurde von der Weltpresse veröffentlicht und gehört heute zu einer der wichtigsten Quellen sowohl in der Slowakei als auch in Tschechien. Einige Tage nach diesem Protest, am 12. und 16. März 1948, forderte Hernan Santa Cruz, Ständiger Vertreter Chiles bei den VN, den Sicherheitsrat auf, sich mit der tschechoslowakischen Frage zu befassen. Die chilenische Note Nr. S/694, die sich auf das Schreiben und die Argumente von Ján Papánek stützte, wurde am 17. März 1948 auf der 268. Tagung des Rates behandelt. Eine Annahme des Vorschlags und damit eine Resolution zu diesem Problem bzw. seine Zuordnung in der von Chile formulierten Form zu den Tagesordnungspunkten des Sicherheitsrates wurde jedoch durch ein Veto seitens der Sowjetischen Union verhindert.7
Am gleichen Tag nahm neben Chile auch das Außenministerium der Vereinigten Staaten Stellung zum Umsturz in der Tschechoslowakischen Republik. In einer formalen und vertraulichen an den Prager Botschafter Lawrence Steinhardt gesandten Information kommentierte das Ministerium zunächst Papáneks Unterfangen in den Vereinten Nationen und verurteilte den Prager Februarumsturz. Darüber hinaus schlug das Ministerium vor, konkrete Schritte zu unternehmen, namentlich die Verhandlungen mit der Tschechoslowakei über das Wirtschaft- und Handelsabkommen und über Kulturfragen abzubrechen, und forderte die sich in der Besatzungszone befindlichen amerikanischen Militärbehörden auf, den nicht kommunistischen Politikern, Beratern, Journalisten und anderen Personen Informationen über die Möglichkeiten einer Ausreise in die amerikanische Besatzungszone zu übermitteln. Desgleichen schlug es vor, die Außenpolitik der Vereinigten Staaten in Bezug auf den Umgang mit der tschechoslowakischen Regierung nach folgenden Prinzipien auszurichten:
Alle amerikanischen Vorhaben sollten mit Großbritannien und Frankreich abgestimmt werden;
mit der neuen tschechoslowakischen Republik sollten nur eingeschränkte diplomatische Beziehungen unterhalten werden;
wirtschaftliche Sanktionen, die zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Isolation des gesamten Ostblocks führen sollten, sollten vorbereitet werden;
Kreditausgaben der Weltbank an die Tschechoslowakei sollten verhindert werden;
aufgrund der strategischen Stellung der ČSR, die als Zentrum des Schwer- und Rüstungsindustrie galt, im Ostblock, sollten mit Wirkung ab dem 1. März 1948 Exportlizenzen entzogen werden, um das tschechoslowakische militärische Potenzial zu schwächen.8
Die genannten Maßnahmen des Außenministeriums zeigen deutlich, dass die USA ihre Beziehung zur Tschechoslowakei vor allem als eine politische wahrnahm, und dass diese gleichzeitig durch ihre Position zur Sowjetunion bestimmt war. Eine Bestätigung dieser Annahme liefert ein weiteres Dokument, der an Washington adressierte Geheimbericht Nr. 309 vom 30. April 1948, dessen Autor wiederum Botschafter Lawrence Steinhardt war. Er äußerte darin seine persönlichen Beobachtungen und analytischen Bemerkungen zur Entwicklung in der Tschechoslowakei und verwies auf die innen- und außenpolitischen Hintergründe. So stellte er fest, dass der tschechoslowakische Februarumsturz 1948 bereits im tschechoslowakisch-sowjetischen Vertrag über die Freundschaft und Zusammenarbeit vom 12. Dezember 1943 verankert worden sei. Gleichzeitig vermittelte er einen Blick in die historische Seele des tschechischen Volkes. Er bezeichnete die Tschechen9 als „kleines Volk” inmitten Europas, fasste ihre Genese zusammen, befasste sich auch mit tschechischen Auswanderungswellen, infolge derer es zu einem Verlust der Eliten gekommen sei, sodass sich die Tschechen einem starken Verbündeten hatten annähern müssen. Ihm zufolge spielte Tschechien während des Zweiten Weltkriegs ein doppeltes Spiel und durch die Zuneigung Beneš‘ zu Stalin sei das Schicksal des Volkes besiegelt worden. Edvard Beneš habe durch seine janusköpfige Politik die Tschechen selbst von ihrer Einzigartigkeit überzeugt. Der kommunistische Umsturz sei also nur eine Frage der Zeit gewesen. Die Verantwortung für das Februardebakel schrieb der Botschafter in erster Linie Präsident Beneš zu. Gleichzeitig bemerkte er aber auch, dass die nicht kommunistischen Politiker ebenso eine Teilschuld trügen, weil ihr Zusammenhalt zu schwach und ihre Auffassungsgabe mangelhaft gewesen sei, da sie den Konflikt zwischen den zwei Gegenpolen, dem Kommunismus und dem Nichtkommunismus, nicht erkannt hatten.10 Diese Analyse kann nur Zustimmung finden.
In Bezug auf die US-amerikanische Außenpolitik schlug Steinhardt vor, der neuen Marionettenregierung weder materielle noch moralische Hilfe anzubieten, da dies im Widerspruch zu den Interessen der USA stünde. Um ein unmittelbar drohendes totales Aufgehen des Landes im Kommunismus zu verzögern, schlug er vor, über Rundfunk und andere Medien Propaganda zu verbreiten.11 Der Bericht des Botschafters wie auch die oben genannte Korrespondenz des Außenministeriums der USA schlossen Hilfe der USA für einen Neuaufbau der tschechoslowakischen Demokratie aus.