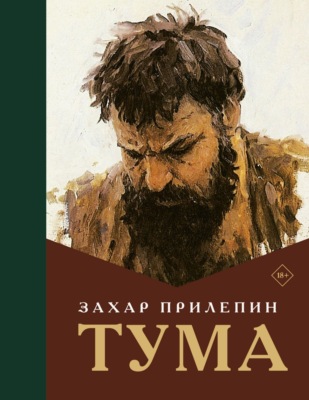Buch lesen: "Wer nur auf die Löcher starrt, verpasst den Käse"

NEUFELD VERLAG
Dieses Buch als E-Book: ISBN 978-3-86256-702-7
Dieses Buch in gedruckter Form: ISBN 978-3-86256-027-1, Bestell-Nummer 590 027
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar
Bibelzitate, sofern nicht anders angegeben, wurden der Lutherbibel in der revidierten Fassung von 1984 entnommen © 1985 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Lektorat: Dr. Thomas Baumann Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf Johannson Umschlagbilder: haveseen/ShutterStock.com®; Privat Satz: Neufeld Verlag
© 2012 Neufeld Verlag Schwarzenfeld
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
www.neufeld-verlag.de / www.neufeld-verlag.ch
Folgen Sie dem Neufeld Verlag auch auf Facebook® und in unserem Blog: www.neufeld-verlag.de/blog
Sabine Zinkernagel
Wer nur auf die
Löcher starrt, verpasst den Käse
Aus dem Leben mit zwei besonderen Kindern

Mein besonderer Dank am Anfang dieses Buches gilt
Martin W., Maren und Angela – stellvertretend für alle Ärztinnen und TherapeutInnen, die unseren Kindern mit Kompetenz, Geduld und Liebe Fähigkeiten entlockt haben, die wir nie für möglich gehalten hätten.
Sandra, Sven und Mike – stellvertretend für alle ErzieherInnen und LehrerInnen, die unsere Kinder so angenommen haben, wie sie sind, sie aber nicht so gelassen haben.
Erika, Susann und Elke – stellvertretend für alle, die uns immer wieder mit praktischer Hilfe und Gebet zur Seite gestanden und getragen haben.
Evi, Alex und Friedemann – stellvertretend für alle Menschen, die unsere Kinder ganz selbstverständlich mit in ihre »normalen« Kinder- und Jugendgruppen aufgenommen haben.
Mama, Konstanze und Ulrike – stellvertretend für alle Mütter, die mir vorgelebt haben, dass man auch mit einem behinderten Kind sein Leben positiv gestalten kann.
Und ganz besonders
Martin – ohne deine Treue, Geduld und Kraft wäre noch wesentlich mehr als dieses Buch niemals möglich gewesen.
Jacob und Cornelius – ihr seid trotz einer definitiv nicht perfekten Mutter zwei tolle Persönlichkeiten geworden!
Inhalt
1. Fünf Worte
2. Offener Brief an Gott 1
3. Engel
4. Noch mehr Engel
5. Wieso, weshalb, warum?
6. CRASH
7. Psychiater
8. Das Ei des Jacobus
9. Offener Brief an Gott 2
10. Krabbelgruppe
11. Offener Brief an Gott 3
12. Das Märchen von der traurigen Königin im Zauberhaus
13. Löcherkäse
14. Keine weiteren Fragen
15. Paradies
16. Blaue Flecken und mehr
17. Sprechgenie 1
18. Verloren – gefunden 1
19. Nachbarn
20. Zeitlos
21. Trotzdem
22. Sommermorgen in Schis-Moll
23. Behindert
24. Hundertwasser-Rasen
25. Letzter Trost
26. Gottesdienst
27. Eins-dreizehn
28. Eigene Entscheidung
29. Danke, Manfred
30. Verloren– gefunden 2
31. Knöpfe
32. Nachtschienen
33. Offener Brief an Gott 4
34. Inklusion
35. Lesen durch Schreiben
36. Und wenn?
37. Zoff im Hinterstübchen
38. Alltags-Katastrophen
39. Gemischte Geburtstagsgefühle
40. Sprechgenie 2
41. König Fußball
42. Zeit zu zweit
43. Auf eigenen Füßen
44. Food-Fingern
45. Offener Brief an Gott 5
Fünf Worte
Mai 1997
Manchmal genügen fünf Worte, um einem für Monate, wenn nicht für Jahre, den Boden unter den Füßen wegzuziehen.
»Wir müssen Sie leider entlassen« – und Sie sind zu perplex, um den Sprecher darauf hinzuweisen, dass er das Wörtchen »leider« gleich mit Ihnen zusammen wegrationalisieren könne.
»Ja, ich liebe eine andere« – und Sie sind zu perplex, um zu fragen, ob das »Ja« zu der Neuen eine höhere Halbwertszeit haben werde als das, das einst Ihnen galt.
Meine fünf bodenverschlingenden Worte sprach mein Frauenarzt: »Das gibt wieder einen Hydrozephalus« – und ich war zu perplex, um ihm zu entgegnen, dass »das« in meinem Bauch nicht irgendetwas geben würde, sondern schon etwas war: nämlich mein Kind. Ob es einen Hydrozephalus bekommen würde oder nicht, konnte an dieser grundlegenden Tatsache nichts ändern.
Meistens fallen mir die richtig schlagfertigen Antworten erst mit ein paar Tagen Verspätung ein. Bei meinem Frauenarzt brauchte ich dafür anderthalb Jahre.
Nicht, weil ich sein Mediziner-Latein nicht verstanden hätte. Sondern deshalb, weil ich wohl besser wusste als er, was diese fünf Worte bedeuteten. Und zwar von unserem Jacob. Bei ihm hatte ich vor zweieinhalb Jahren genau dieselbe Diagnose erhalten.
»Hydrozephalus« heißt auf deutsch-medizinisch »Wasserkopf«. Für alle Nicht-Mediziner: Der Körper produziert laufend etwas mehr Nervenwasser, als er abbaut. Dieses kleine bisschen Zuviel drückt zuerst die Schädelknochen auseinander, so dass der Kopf unnatürlich groß und unförmig wird. Sobald dort alle Dehnungsmöglichkeiten ausgereizt sind, presst das Nervenwasser das Gehirn zusammen. Früher bedeutete das für alle betroffenen Kinder den sicheren Tod.
Früher. Oder in drei Vierteln der Länder dieser Erde, in denen es sich nur die Allerreichsten leisten können, ihrem Neugeborenen im westlichen Ausland ein High-Tech-Ventil in den Kopf einsetzen zu lassen.
Was bin ich froh, dass wir in Westeuropa leben! Natürlich ist auch unser Krankenkassen-System nicht perfekt. Auch ich hätte da noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Aber es gehört zu den besten dieser Welt. Jacob bekam ohne ein Wimpernzucken von Ärzten oder Krankenkasse ein mehrere Tausend Euro teures Ventil eingesetzt, das alles überschüssige Nervenwasser in den Bauchraum ableitet. Dort wandelt es der Körper in Pipi um. In der Windel fällt dieses kleine bisschen Nervenwasser gar nicht mehr auf.
Problem gelöst. Sagten mir damals die Ärzte. Anfangs haben wir ihnen geglaubt. Jacob war unser erstes Kind; wir hatten keine Ahnung, auf welche Kennzeichen einer gesunden Entwicklung wir hätten achten müssen. Auch der Kinderarzt kam erst nach einem halben Jahr darauf, dass unser Ältester sich bei weitem nicht »normgerecht« entwickelte. Und verschrieb uns Krankengymnastik. Später kamen noch Logopädie und Frühförderung dazu. Alles finanziert von der Krankenkasse. Weil es so selten gesagt wird, tue ich das hiermit einmal: Danke!
Was die Krankenkasse nicht lösen kann, ist mein dadurch entstandenes Zeitproblem. Zu den ganz alltäglichen Aufgaben einer Hausfrau und Kleinkind-Mutter kommen bei mir eine ganze Menge weiterer Termine: Pro Monat einmal in die Klinik zur Ventilkontrolle, einmal zum Kinderarzt zur Entwicklungskontrolle, einmal zum Augenarzt zur Augeninnendruck-Kontrolle. Pro Woche einmal zur Logopädie, einmal zur Ergotherapie, zweimal zur Physiotherapie. Pro Tag einmal Sprach-Anbahnungs-Übungen, zweimal Feinmotorik-Training, dreimal Krankengymnastik. Dazu mehrmals täglich wickeln, füttern, umziehen, trösten, herumtragen, reden, singen, spielen, lachen. Und das Wichtigste: Bei alledem 24 Stunden pro Tag nicht durchdrehen.
All das jetzt also im Doppelpack.
Ganz nebenbei habe ich auch noch Multiple Sklerose. Die hält sich zwar ziemlich zurück – »Gott sei Dank« im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Neurologe rät mir lediglich, mich zu schonen.
Wie das funktionieren soll, weiß der Himmel. Ich kann nur hoffen, dass wenigstens der es weiß.
Offener Brief an Gott 1
Mai 1997
… wenn der Himmel es weiß … Nun, da du ein allwissender Gott bist, musst du es ja wohl wissen. Und du weißt sogar noch viel mehr.
Natürlich weißt du, dass bei der Zeugung meines Kindes das kranke Gen in der befruchteten Eizelle steckte. Natürlich weißt du, dass das Kind in meinem Bauch nie eine Chance auf ein eigenständiges Leben haben wird. Natürlich weißt du, dass ich mir das alles ganz anders vorgestellt habe. Natürlich weißt du, dass mein Leben ab jetzt völlig anders aussehen wird als geplant – und nicht gerade besser.
Und obwohl du das alles gewusst hast, hast du das alles zugelassen. Wer bist du eigentlich?
»Gott ist die Liebe«, steht in der Bibel. Eigentlich glaube ich das ja auch. Nicht nur, weil es in der Bibel steht. Sondern auch, weil ich es immer wieder so erfahren habe. Ich habe mit begeistertem Herzen unzählige Lieder darüber gesungen, habe dir immer wieder im Gebet dafür gedankt. Ich habe Anspiele dazu geschrieben und immer wieder erzählt: Gott liebt jeden Menschen.
An diesem Satz will ich ja gar nicht rütteln. Ich muss ihm nur drei kurze Worte anhängen: Nur nicht mich.
Denn du musst gewusst haben, was du mir damit antust. Du kennst mich doch! Du hast gesehen, wie ich die Diagnose »MS« damals ziemlich klaglos weggesteckt habe. Du hast auch meinen inneren Kampf darum miterlebt, Jacobs Behinderung zu akzeptieren. Du weißt, dass die ganzen Arztbesuche und Therapien mich oft an den Rand meiner Belastungsfähigkeit bringen.
Und du weißt, dass Martin und ich uns ganz bewusst dafür entschieden haben, als Pfarrersfamilie dir zu dienen: Dein Wort verkündigen, in Predigten, Gesprächen, Krabbelgruppen, Kindergruppen, Jugendfreizeiten. Das wollten wir, das tun wir.
Und was tust du? Statt dich darüber zu freuen, schmeißt du uns einen Stolperstein nach dem anderen in den Weg.
Reicht es dir nicht, dass wir schon eine chronische Krankheit und ein behindertes Kind in der Familie haben? Musste es jetzt auch noch das zweite treffen?
Sieht so Liebe aus?
Dass in dieser Welt nicht alles glatt läuft, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat, das ist mir schon klar. Aber das Päckchen, das ich bis jetzt zu schultern hatte, war mir schon fast zu schwer. Und nun setzt du noch eins oben drauf. Das ist definitiv keine Liebe mehr, das ist auch keine »normale Härte« mehr. Das ist Sadismus.
Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Vielleicht hat es dir ja sogar Spaß gemacht? Oder vielleicht sitzt du jetzt gerade oben auf deiner Wolke Nummer sieben und denkst dir den nächsten Nackenschlag für mich aus?
Und ich sitze hier unten und habe keine Chance, aus diesem Spiel auszusteigen. Obwohl – eine Chance habe ich immer, aber die will ich jetzt lieber nicht genauer andenken. Das würde ich Martin auf keinen Fall antun. Also muss ich dein Spiel mitspielen. Aber du kannst nicht auch noch verlangen, dass ich das weiterhin mit Begeisterung tun werde.
Alle Formen meines Glaubenslebens, die ich bisher mit echter Überzeugung gelebt habe, werden sich nun wohl grundlegend ändern. Ich hab ja versucht, weiterzumachen wie früher, mir selbst business as usual vorzuspielen, aber es geht einfach nicht.
Da war der Gottesdienst.
Mit dem wunderschönen Choral »Gott ist gegenwärtig«. Und ich habe in Gedanken mit den Schultern gezuckt. Na und? Was habe ich von deiner Gegenwart, wenn du immer nur weiteren Mist in mein Leben schaufelst? Der Pfarrer hat irgendwas von tätiger Nächstenliebe gepredigt. Dafür werde ich in den nächsten zwanzig Jahren ganz bestimmt keine Zeit haben. Meine beiden Kinder zu lieben, wird schon eine genügend schwierige Aufgabe für mich sein. Wenn ich das überhaupt schaffe …
Gegen Schluss das Vater Unser, darin ganz am Anfang der Satz: »Dein Wille geschehe«. Ich setze flüsternd, mit einem Blick auf meinen Bauch, dazu: »Wenn der so aussieht, bitte nicht«.
Ich versuche ja, zu beten. Aber ich kann mich nicht aufraffen zu einem Dank, erst recht nicht zu einem Lob. Das Bitten hab ich aufgegeben, mit denen stoße ich bei dir ganz offensichtlich auf taube Ohren. Bleiben nur noch Vorwürfe an dich, so wie hier.
Und ich versuche, in der Bibel zu lesen. Die Texte, die für diese Woche vorgeschlagen sind, bestehen aus Worten, die sinnlos an meinem Kopf und wirkungslos an meinem Herz vorbeirauschen.
Deshalb habe ich die Berichte über Jesus aufgeschlagen. Das sind wenigstens leichter fassbare Geschichten. Lauter Berichte von Wundern, vorzugsweise Heilungen. Und mittendrin so steile Sätze wie: »Die Menschen brachten ihre Kranken zu Jesus, und er heilte sie alle.« Wirklich alle? Einfach so? Auch die, die gar nichts mit dir am Hut hatten? Solche, die auch später nichts von dir wissen wollten? Mit all denen hattest du Mitleid. Und mit mir? Ich hatte was mit dir am Hut, sehr viel sogar! Aber wo bleibt die Heilung?
Irgendwie bin ich doch erleichtert, dass meine Bibel gut gebunden ist. So hat sie es wieder einmal überlebt, dass ich sie mit Nachdruck in die Zimmerecke geschmissen habe.
Ob ich es jemals wieder schaffen werde, ganz normal an dich zu glauben? Ob ich das überhaupt will?
Ob du das überhaupt willst? Wenn ja, dann musst du ziemlich bald etwas dafür tun!
Martin will es, und viele unserer Freunde wollen es auch. Sie tun auch etwas dafür. Sie hören mir geduldig zu, sie versuchen mich zu trösten, mich zu ermutigen. Und lassen sich von ihrer Erfolglosigkeit bisher nicht entmutigen. Sie beten für mich.
Ich bin ihnen auch wirklich dankbar. Vor allem dafür, dass mir bisher keiner mit frommen Sprüchen gekommen ist. Ich kenne schon genug davon: »Gott lädt niemandem mehr auf, als er tragen kann« – da bin ich der lebende Gegenbeweis.
»Gottes Hilfe kommt nie zu spät« – stimmt. Denn »nicht zu spät« kann ja auch heißen, dass sie gar nicht kommt.
Und dann die steile Behauptung von Paulus aus seinem Brief an die ersten Christen in Rom: »Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen.« Eine Forderung, die ich weder erfüllen kann noch will. Jedenfalls nicht, solange mir niemand sagen kann, wie dieses »Beste« aussehen könnte. Um an Gutem auszugleichen, was meine Kinder an Einschränkungen ihrer Lebensmöglichkeiten hinnehmen müssen, müsste es ziemlich gewaltig sein!
Okay, Paulus konnte das für sich wohl so sehen. Ich beneide ihn sogar ein wenig deswegen.
Aber akzeptieren, dass es für mich das Beste sei, wenn du meinen Kindern keine Chance auf eine normale Zukunft gibst – nein, das kann ich nicht.
Wenn ich überhaupt irgendwie weiter an dich glauben will, muss ich wohl diesen Vers aus meiner Bibel herausschneiden.
Aber so weit bin ich längst noch nicht. Ich meine nicht das Rausschneiden, ich meine das Glauben.
Engel
Mai 1997
Natürlich gibt es Engel. Himmlische Wesen, die Gott manchmal mit besonderen Aufträgen auf die Erde schickt. Aber es gibt auch Menschen, die Engelsaufgaben übernehmen. Rein rational gesehen gibt es keinen Grund dafür, dass sie tun, was sie tun. Bleibt nur eine Erklärung: Gott muss ihnen diesen Auftrag gegeben haben.
In den ersten Monaten nach der Diagnose für Cornelius beauftragt Gott wohl mehrere Menschen damit, für uns zum Engel zu werden. Um uns zu zeigen, dass er sich mitten in dem organisatorischen und gefühlsmäßigen Chaos immer noch für uns zuständig fühlt.
Es fängt mit unseren Nachbarn an. Wir sind gerade in das kleine Dorf im Westerwald gezogen. Dass Erika und Helmut nette Leute sind und sich bemühen, uns den Anfang in der neuen Stelle zu erleichtern, haben wir schon bald gemerkt. Aber das, worum wir sie nun zu bitten wagen, kann man auch vom nettesten Menschen der Welt nicht erwarten: Mein Frauenarzt hat mich zur Absicherung der Diagnose an das Klinikum in Siegburg überwiesen. Etwa 90 Minuten Fahrt für eine Strecke. Und was dort auf mich zukommen wird, kann ich mir nach den Erfahrungen mit Jacob schon lebhaft vorstellen: Endloses Warten in zugigen Gängen oder stickigen Wartezimmern, in denen andere Frauen in freudiger Erwartung ihr Baby im Bauch herumtragen. Endlose Ultraschall-Sitzungen, Blutabnahme, weitere Untersuchungen, nach denen sich die Ärzte erst einmal bedeckt halten würden. Und dann das abschließende Gespräch, das jedes kleinste Fünkchen Hoffnung, mein Gynäkologe könnte sich doch geirrt haben, zunichte machen würde.
Kein Tag für schwache Nerven also. Und meine Nerven sind nicht nur schwach, sie sind am Ende. Allein werde ich das nicht durchstehen. Martin muss mit.
Und Jacob kann nicht mit. Diesen ganzen Tag lang das erste von nun zwei behinderten Kindern um mich herum zu haben, inklusive Wickeln, Füttern, Beschäftigen und Vom-Untersuchen-der-Kabeldiverser-medizinischer-Geräte-Abhalten – das wäre definitiv zu viel für mich. Und für Martin auch.
An unserem neuen Wohnort kennen wir noch kaum jemanden. Unsere Nachbarn sind die einzigen, die wir bitten können, Jacob für einen Tag zu übernehmen.
Ausgerechnet Jacob. Einen Zweieinhalbjährigen, der nicht laufen kann. Der gerade einmal drei Worte spricht: »Augo« heißt Auto, »Mami« bedeutet Papa,1 und mit »Gu« bezeichnet er sich selbst. Einen Jungen, der mit Duplosteinen und Malstiften noch nichts anzufangen weiß. Der gerade gelernt hat, mit dem Löffel zu essen. Und den unsere Nachbarn vielleicht ein Dutzend Mal gesehen, aber noch nicht näher kennengelernt haben.
Für dieses Kind sollten sie also einen ganzen Tag lang verantwortlich sein? Ohne zu wissen, wann wir zurückkommen würden. Ohne eine Möglichkeit, uns im Notfall zu erreichen.
Eigentlich können wir uns das Fragen gleich sparen.
Martin tut es trotzdem. Und erntet natürlich keine begeisterte Zustimmung. Nur ein zögerndes: »Wir denken darüber nach«. Das ist eigentlich schon mehr, als ich erwartet habe.
Keine zwei Stunden später klingelt Erika an der Tür. Das sei ja eine echte Notlage, und ihr täte das alles so leid, und sie würde ja verstehen, dass Martin mitkommen müsse nach Siegburg, und … und deshalb würde sie es wagen und sich solange um Jacob kümmern.
Es geht nicht nur gut, es ist der Anfang einer wunderbaren Freundschaft zwischen Jacob und seinen Ersatzgroßeltern. Nach diesem Tag hat Jacob seinen Wortschatz um die Worte »Elmu« und »Eika« erweitert.
Nach diesem Monat staunt das ganze Dorf darüber, was Helmut, der bisher nicht gerade als Kindernarr aufgefallen ist, mit seinem Ersatzenkel alles unternimmt. Jacob darf mit ihm Rasen mähen und Unimog fahren, auf der Werkbank sitzen und mit dem Bobby Car seine Einfahrt herunterrasen.
Nach Cornelius’ Geburt stoße ich mehr als einmal an die Grenzen meiner Multi-Tasking-Fähigkeiten: Da will ich mein Baby stillen, das Mittagessen ist längst überfällig, Jacob räumt quengelnd alle Küchenschubladen aus, das Telefon klingelt zum x-ten Mal – und dann schrillt noch die Haustürklingel. Draußen steht Erika mit der Frage: »Darf der Jacob zu uns kommen?« Nichts lieber als das! Als die beiden miteinander abziehen, wäre es schwer zu sagen, wer am glücklichsten ist: Die Ersatz-Oma, das freudig jauchzende Kind oder die erleichterte Mama.
Woher ahnte Erika, wann ihr Erscheinen derart willkommen war? Konnte sie dicke Luft nebenan riechen? Waren unsere Hauswände so dünn? Hatte sie unser Wohnzimmer verwanzt? Die einzig plausible Erklärung: Gott muss ihr den Gedanken eingegeben haben. Und sie hat es einfach getan. Wie es Engel eben tun.
1 Jacob redete uns immer nur mit dem Vornamen an. »Mami« war seine erste Version für »Martin«.
Noch mehr Engel
Juli–September 1997
Nach Tante Erika und Onkel Helmut hat Gott eine ganze Reihe von Engeln mobilisiert, um mir einen Herzenswunsch zu erfüllen: Mein zweites Kind wollte ich unbedingt stillen.
Bei Jacob wollte ich das auch schon. Ich hatte mir alles Mögliche dazu angelesen, wusste um die gesundheitliche Bedeutung der Muttermilch, um die durchs Stillen geförderte emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind. Zwei Sätze aus all diesen schlauen Büchern hatten sich mir besonders eingeprägt: Jede Mutter kann stillen. Jedes Kind kann gestillt werden.
Die Bücher wurden ganz offensichtlich zu früh geschrieben, nämlich vor der Geburt meines ersten Babys. Denn ich konnte Jacob definitiv nicht stillen. Und Jacob konnte definitiv nicht gestillt werden.
Ich habe es hartnäckig versucht, Jacob an die Brust zu bekommen. Vom zweiten Lebenstag an habe ich ihn trotz der schmerzenden Kaiserschnitt-Narbe immer wieder angelegt. Und danach gewogen. Nur einmal zeigte die Waage ein anderes als Gewicht als vor dem Stillversuch: Da wog Jacob noch weniger als zuvor.
Erst nach zwölf Wochen, als die Milchpumpe mehr Blut als Milch aus meiner Brust zog, habe ich kapituliert. Jacobs Mundmuskulatur war einfach zu schwach, um die Muttermilch an der Quelle zu trinken. Wir mussten ja sogar die Löcher der Sauger mit einer heißen Stecknadel erweitern, damit er die Milch wenigstens aus der Flasche trinken konnte.
So lange würde ich diesmal bestimmt nicht mehr Milch abpumpen. Aber das Stillen versuchen wollte ich noch einmal! Ganz bewusst habe ich deshalb für Cornelius’ Geburt ein Krankenhaus ausgesucht, das wenigstens einige Säuglings-Intensivbetten im Haus hatte. Denn wenn ich ihn stillen wollte, musste er natürlich in meiner Nähe sein. Nur wenn die kleine Intensivstation belegt wäre, müsste Cornelius in die Kinderklinik auf einem anderen Hügel der Stadt umziehen.
Das musste ich auf jeden Fall verhindern! Jedem, der mir bei einer der zahllosen Untersuchungen im Krankenhaus über den Weg lief, erzählte ich, dass ich mein Kind ganz unbedingt bei mir behalten wollte, um es zu stillen. Nicht nur den Gynäkologen und Stationsschwestern, sondern auch der Frau an der Pforte, einer kaum deutsch sprechenden Putzfrau und mehreren nichts ahnenden Besuchern.
Einen Engel habe ich dabei nie getroffen. Jedenfalls habe ich keinen als solchen erkannt. Aber er muss heimlich und unerkannt unter all den Leuten gewesen sein, die ich mit meinem Still-Wunsch überrumpelte.
Zunächst habe ich davon natürlich nicht das Geringste geahnt. Als ich am 9. Juli endlich aus der Narkose erwachte, war ich erst einmal damit zufrieden, dass mein Bauch weniger schmerzte als nach dem ersten Kaiserschnitt, und dass mein Kind im gleichen Krankenhaus geblieben war.
An Cornelius’ zweiten Lebenstag schaffte ich es mit Martins Hilfe schon, unser Kind auf der Intensivstation zu besuchen. Da lag er, schläfrig und verkabelt, in seinem Wärmebettchen.
Ob wir ihn herausnehmen könnten? Allein die Frage versetzte die Schwester in Panik. Nein, auf gar keinen Fall! Streicheln dürften wir ihn, aber nur durch die dafür vorgesehenen Eingriffsluken mit daran angenähten Handschuhen.
Bei Jacob war das alles viel unkomplizierter möglich gewesen. Aber Cornelius lag hier eben nicht auf einer Kinderstation, sondern auf der Intensivstation. Da waren die Wärmebettchen Standard, etwas anderes gab es nicht. So konnten wir wohl bis zur Entlassung mit unserem Neugeborenen nicht einmal Hautkontakt aufnehmen. Obwohl Cornelius völlig ausgereift zur Welt gekommen war. Obwohl er mit seinem ganz normalen Geburtsgewicht wie ein Riese wirkte neben dem zarten Frühchen von 1500 g im Nachbar-Inkubator.
Wir waren zutiefst enttäuscht. Martin, weil er seinen Sohn so gerne auf den Arm genommen hätte. Ich, weil ich meine letzten Hoffnungen auf ein Stillkind am Horizont entschwinden sah.
Auf der Heimfahrt hätte Martin am liebsten geheult. Stattdessen machte er Gott klar, dass sich diese Situation schleunigst ändern müsse, weil sonst auch er noch durchdrehen würde.
Zwei Tage später kam unser Ortspfarrer mich besuchen. Viel Zeit hatte er nicht, seine Patientenliste war lang. Aber bevor er ging, bat ich ihn, mit mir dafür zu beten, dass diese unhaltbare Situation bald irgendein Ende finden würde. Eines, das mir Stillversuche erlauben würde, wagte ich schon nicht mehr zu erhoffen.
Aber wie sagt Gott es so schön in der Bibel? »Noch ehe sie mich anrufen, will ich ihre Bitten erhören.« Das galt nicht nur vor 4000 Jahren dem Volk Israel, das gilt heute auch mir.
Und so erschien kurz nach unserem Gebet eine Schwester mit der Frage, ob ich mein Kind jetzt gleich von der normalen Säuglingsstation abholen wolle.
Von der Säuglingsstation? Abholen? Hieß das, dass Cornelius vom angeblichen Intensiv-Pflegefall zum ganz normalen Rooming-in-Kind aufgestiegen war? Ja, das hieß es tatsächlich.
Es war gerade ein Kind zur Welt gekommen, das dringend ein Intensivbettchen benötigte. Die waren aber alle belegt. Die Ärzte waren sich einig: Cornelius konnte am ehesten von der Intensivstation verlegt werden. Das hieß: einen Säuglingstransport zur Kinderklinik anfordern.
Aber genau in diesem Moment muss mein Engel auf den Plan getreten sein. Ich werde nie erfahren, wer es war. Ich weiß nur, dass er wie so mancher biblische Engel in weiß gekleidet gewesen sein muss. Er erinnerte die anderen Ärzte an meinen Wunsch, Cornelius zu stillen. Und daran, dass ich mit einer frischen Kaiserschnittnarbe unmöglich den ganzen Tag auf einem Stuhl in der Kinderklinik verbringen konnte. Cornelius war ja organisch gesund, nur der Hydrozephalus musste regelmäßig kontrolliert werden. Ob man es nicht wagen könne, das Baby hier zu behalten, eben auf der normalen Kinderstation?
Man konnte. Und ich konnte mein Baby den ganzen Tag lang neben meinem Bett stehen haben, es wickeln, umziehen und ihm das Fläschchen mit der abgepumpten Mamamilch geben. Was für ein Unterschied zum vorigen Zustand! Was für ein Geschenk!
Erste Versuche, Cornelius anzulegen, zeigten allerdings keinen Erfolg. Dafür musste Gott noch einen weiteren Engel auftreten lassen. Diesmal in Form der Stillschwester. Sie zeigte mir, wie ich mit dem kleinen Finger Cornelius zu Saugbewegungen animieren konnte, bevor ich ihm das Fläschchen gab.
Ausgerechnet sonntags, als außer ihr nur noch eine Lehrschwester für alle Mütter und Babys der Station zuständig war, nahm sie mich mitsamt meinem Sohn ins Schwesternzimmer. »Heute muss das Kind an die Brust, sonst lernt er es womöglich nie«, erklärte sie resolut. Und genauso resolut machte sie sich an die Arbeit.
Ja, Arbeit war es wirklich. Normales Anlegen brachte nämlich nichts. Also versuchte sie es mit dem Anlegen von außen, von oben, von unten. Ich hätte schon nach einer halben Stunde aufgegeben, aber das ließ die Schwester nicht zu. Nach einer Stunde waren wir beide schweißgebadet. Aufgeben kam immer noch nicht in Frage.
Etwas später spürte ich plötzlich ein deutliches Ziehen an meiner Brust. Spürte, wie die Milch nach draußen floss, direkt in Cornelius’ Mund. Hörte ihn schmatzen und schlucken. Sah, wie die Stillschwester mindestens so erschöpft wie erleichtert wie glücklich auf einen Stuhl sank. Und hielt wenige Minuten später ein halbsatt eingeschlafenes Stillkind im Arm.
Es war, als sei ein Schalter umgelegt worden. Seither trank Cornelius direkt bei mir. Zwar immer etwas schwach, da auch seine Mundmuskulatur nicht so kräftig war wie die eines Durchschnitts-Babys. Aber er trank. Er trank bei mir im Bett, er trank im Gottesdienst, er trank bei Ausflügen auf einer Parkbank, er trank vor und nach seiner Ventil-Operation im Krankenhaus. Er trank nachts immer seltener, weil er mit acht Wochen schon fast durchschlief. An heißen Sommertagen trank er stündlich, jeweils fast eine halbe Stunde lang. Ich saß dabei im Gartenstuhl, kühlte meine Füße im Planschbecken, in dem Jacob fröhlich herumspritzte, und genoss Glücksgefühle. Glücksgefühle, auf die ich nicht mehr zu hoffen gewagt hatte.
Allerdings entwickelte sich Cornelius’ Saugkraft nicht in gleichem Maße wie sein Hunger. Was tun? Zufüttern? Nein, meint die Hebamme kategorisch. Sie hatte da etwas anderes im Sinn …
Was es war, erfuhr ich erst, als sie eines Samstags in Begleitung ihrer Schwester erschien. Die Schwester arbeitete in der Schweiz, in einer Klinik, die auf Säuglinge mit Down-Syndrom spezialisiert ist. Dort hatten sie spezielle Massagegriffe entwickelt, um die Mundmuskulatur der Babys zu stärken. Die wollte sie mir nun zeigen.
Ich war völlig platt. Da hatte die mir völlig unbekannte Frau gerade einmal ein Wochenende Urlaub, fährt von der Schweiz in den Westerwald zu ihrer Schwester, und was machen die beiden an dem einzigen Nachmittag, den sie gemeinsam hatten? Kommen zu mir, um mir Mundmuskel-Stimulation beizubringen. Das tun keine Menschen, so etwas tun nur Engel!
Es half tatsächlich. Durch regelmäßiges Massieren aller Gesichtsmuskeln hin zum Mund saugte Cornelius stärker. Ein halbes Jahr lang konnte ich ihn voll stillen! Dann bekam ich doch wieder einmal einen Schub MS, musste Cortisontabletten nehmen und mein Kind deshalb schlagartig abstillen. Aber eben erst im Alter von sechs Monaten. Fast so, als sei Cornelius ein ganz normaler Säugling.
Was für ein Wunder nach allem, was so deutlich dagegen gesprochen hat! Und was für ein Gott, der das möglich gemacht hat!
Und was für tolle Menschen, die sich dafür im richtigen Moment als Engel zur Verfügung gestellt haben! Ich habe sie alle nur flüchtig kennengelernt. Ich weiß nicht einmal mehr ihre Namen. Aber ich bin mir sicher: Gott kennt ihre Namen. Und er wird sich eines Tages daran erinnern, dass sie dazu bereit waren, sein Geschenk an mich zu überbringen.