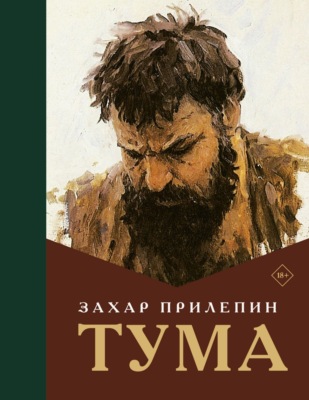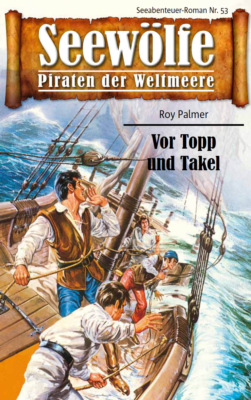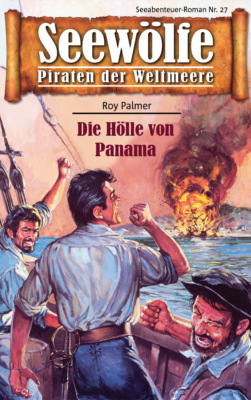Buch lesen: "Seewölfe - Piraten der Weltmeere 238"
Impressum
© 1976/2016 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
ISBN: 978-3-95439-574-3
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
1.
Der Böller einer Kanone riß Kapitän Leone Cantieri höchst unsanft aus seinen Träumen. Er fuhr hoch, warf die Decke zur Seite, sprang ungestüm von seiner Koje auf und stieß sich dabei den Kopf an einem der niedrigen Deckenbalken.
Etwas heulte heran, und dann stieg rauschend das Wasser neben der Bordwand auf, so nah, daß er es in aller Deutlichkeit vernehmen konnte.
Wieder donnerte es ohrenbetäubend. Die Planken vibrierten unter Cantieris Füßen und verkündeten ihm, daß es diesmal eins der eigenen Geschütze war, das gezündet worden war.
Allmächtiger, dachte er entsetzt, laß es nicht wahr sein!
Aber das Schreien der Männer auf dem Batteriedeck, das Trappeln hastiger Schritte und das Rumpeln der Kanonen, die in aller Eile ausgerannt wurden, verrieten ihm, daß er keiner Täuschung erlegen war. Die Wirklichkeit bot sich ihm hart und unerbittlich dar, sie kannte keinen Kompromiß. Das Unheil war über den kleinen Verband von drei Schiffen hereingebrochen, jäh und gänzlich unerwartet.
Capitano Cantieri fluchte und taumelte, noch halb benommen vom Schlaf, durch seine Kammer im Achterkastell der Galeone. Er raffte seine Kleidungsstücke zusammen, stieg ins Beinkleid und zog sich Hemd und Wams über. Mit den ledernen Stulpenstiefeln in der Hand stürmte er in den Mittelgang hinaus.
Nach vier oder fünf Schritten prallte er mit Franco Benedetti, seinem Ersten Offizier, zusammen, der ihm aufgeregt gestikulierend entgegenhastete. Sie gerieten miteinander ins Gehege und drohten zu fallen. Außer sich vor Wut, stieß der Kapitän dem anderen die Hand gegen die Brust.
„Mann!“ schrie er ihn an. „Was, zum Teufel, hat das zu bedeuten? Seid ihr Kerle verrückt geworden?“
„Wir sind angegriffen worden, Signore“, erwiderte Benedetti schwer atmend.
Mit einem weiteren Fluch riß Cantieri sich von ihm los und stürzte zum offenen Schott. Er stürmte aufs Hauptdeck hinaus – und genau in diesem Augenblick ertönte wieder das Krachen einer Kanone, diesmal aber nicht an Bord seiner „Michelangelo“, sondern außerhalb, draußen auf See, beängstigend nah an der Backbordseite des Schiffes.
Er sah den Feuerblitz, hörte das wilde Grölen von Männern in einer Sprache, die er nicht verstand, und dann raste auch diese Kugel mit jenem eigentümlichen Pfeifen heran, das jeden erfahrenen Seemann veranlaßte, unverzüglich in Deckung zu gehen.
Capitano Cantieri warf sich hinter die Nagelbank des Großmastes. Mit ihm legten sich auch die anderen flach auf die Planken, alle, vom Ersten Offizier, der inzwischen wieder neben ihm war, bis hin zum Moses, der wieselflink unter den Steuerbordniedergang der Back kroch.
Das Schanzkleid der Kuhl erbebte, als hätten Giganten mit Hämmern darauf eingeschlagen. Es krachte und knirschte, und in die berstenden Geräusche mischte sich das Schreien der Männer. Trümmerteile wirbelten wie ein Haufen Grashalme, in die jemand mit aller Kraft hineingeblasen hatte, durch die Dunkelheit.
O Hölle, dachte Cantieri mit aufkeimender Panik, sie haben dich überrumpelt, sie haben dich in eine tödliche Falle gelockt, Herrgott, wie viele sind es nur?
Er begriff, daß es ein Fehler gewesen war, sich für die Zeit der Mittelwache schlafen zu legen. Aber Benedetti, der planmäßig die Leitung der Deckswache übernommen hatte, hatte ihn überzeugend darauf hingewiesen, daß es eine ruhige Nacht werden würde, in der sie sich um nichts zu sorgen brauchten. Die See war ruhig, der Wind blies frisch aus Südwesten, und eine Verschlechterung der Wetterlage war nicht zu erwarten.
Nach den wenigen Kreuzschlägen, mit denen der Verband von seinem Heimathafen Livorno aus die offene See angesteuert hatte, waren die „Michelangelo“, die „Tirrenia“ und die „Leonardo da Vinci“ hoch an den Wind gegangen, und es schien gewiß zu sein, daß sie bei der guten Fahrt, die sie, über Backbordbug liegend, liefen, im Verlauf des nächsten Nachmittags die Insel Elba – ihr Ziel – erreichen würden.
Mit dieser optimistischen Vorausschau vor Augen hatte der Kapitän sich nur zu gern in seiner Koje zur Ruhe gelegt. Etwas von der Energie, die er in den letzten Tagen bei den Vorbereitungen der kurzen, aber wichtigen Reise hatte aufwenden müssen, hatte er auf diese Weise zurückgewinnen wollen. Doch der Preis für die wenigen Stunden Schlaf war hoch, zu hoch.
Mit Überfällen mußte man in diesen Gewässern immer rechnen. Piraten aller Herren Länder verunsicherten die Tyrrhenischen Küsten, vorwiegend Türken und Nordafrikaner, aber auch Franzosen, Engländer und Holländer.
Cantieri hatte sich jedoch auf seine Deckswache und deren Ausguck verlassen und fest damit gerechnet, daß die Männer etwaige Feinde rechtzeitig genug sichten würden.
Heftig prasselten die Trümmer auf die Planken nieder. Schräg links vor sich sah Cantieri einen der Decksposten, der verkrümmt neben einer der Culverinen lag und sich stöhnend den Unterleib hielt.
„Feldscher!“ schrie Cantieri. „Den Mann verarzten! Profos!“
„Signore?“ rief der Zuchtmeister der „Michelangelo“.
„Eine halbe Backbordbreitseite auf den Feind abgeben! Schnell, schnell, beeilt euch doch, ihr Hunde, verflucht noch mal!“
Der Profos scheuchte die Männer aus ihren Deckungen hoch, seine Rufe hallten über Deck.
Cantieri fuhr zu seinem Ersten Offizier herum.
„Warum hat man mich nicht eher geweckt?“ schrie er ihn an.
„Es erfolgte zu überraschend, Signore!“
„Wie konnte das geschehen?“
Die Kanonen der „Michelangelo“ wummerten und ließen das Deck schwanken. Grell stachen die Mündungsblitze in die Nacht. Benedetti erwiderte etwas auf die Frage seines Kapitäns, doch dieser begriff kein Wort und gab es ihm durch eine Gebärde zu verstehen.
Benedetti wiederholte: „Das Schiff näherte sich plötzlich in Lee, aus Richtung der Küste, von dorther also, wo wir am allerwenigsten mit einem Gegner gerechnet hätten.“
„Man muß stets auf alles gefaßt sein!“ rief der Kapitän wutentbrannt. „Ich werde den Ausguck auspeitschen lassen, er hat geschlafen!“
„Signore, das ist nicht wahr! Auch die ‚Tirrenia‘ und die ‚Leonardo‘ haben das Schiff nicht gesehen!“
Das Johlen der Männer um sie herum besagte, daß drüben beim Gegner zumindest ein Treffer zu verzeichnen war. Jetzt aber donnerten wieder die Geschütze auf der anderen Seite, und rasch suchten die Männer der „Michelangelo“ ihre Deckungen auf.
„Nur ein Schiff?“ schrie Leone Cantieri. „Nur ein einziges, haben Sie gesagt?“
„Ja, aber es ist ein Dreimaster, groß, mit starker Armierung. Er …“
Der Rest seiner Worte ging in dem Getöse unter, mit dem die feindlichen Kugeln die Galeone erreichten. Wieder ging ein Teil des Backbordschanzkleides zu Bruch, aber bedenklicher schien der Treffer zu sein, der irgendwo weiter unten im Schiffsleib zu verspüren war. Eine weitere Kugel heulte flach übers Hauptdeck und riß einen Mann mit sich, dessen gellender Todesschrei alle anderen Laute übertönte und sich dann an Steuerbord in der Nacht verlor.
„Zur Hölle“, rief Cantieri, „wer sind diese Teufel?“
„Engländer“, erwiderte Benedetti. „Soviel habe ich aus ihren Worten verstanden. Ihr Schiff ist groß …“
„Das haben Sie mir eben schon gesagt, verflucht!“
„… und hat dunkel gelohte Segel“, fuhr der Erste Offizier fort. „Natürlich segelten sie ohne jegliche Beleuchtung heran, so daß wir sie erst im allerletzten Moment sahen. Dann setzten sie uns einen Schuß neben die Bordwand.“
„Ein einziges Schiff!“ brüllte Cantieri, der kaum noch an sich halten konnte. „Und dazu noch in Lee! Wir sind in der Überzahl, wir haben die bessere Position! Er ist total übergeschnappt, daß er das wagt! Wir zerhacken ihn, schießen ihn zusammen, schicken ihn auf den Grund der See, diesen verdammten Bastard! Wo bleiben die ‚Tirrenia‘ und die ‚Leonardo‘?“
„Sie holen auf!“
„Aber nicht schnell genug!“
„Sie schaffen es!“ schrie Benedetti. „Sie staffeln heran! Sehen Sie doch, Signore, wir können diese Hurensöhne von Engländern umzingeln und von drei Seiten befeuern!“
Cantieri hob den Kopf und hielt aus zusammengekniffenen Augen nach der Galeone „Tirrenia“ und der Zweimastkaravelle „Leonardo da Vinci“ Ausschau, die im Kielwasser der „Michelangelo“ segelten. Aber er konnte ihre Konturen vorläufig nur ganz schwach in der Dunkelheit erkennen.
„Profos!“ rief er. „Zweite halbe Backbordbatterie – Feuer!“
„Feuer!“ schrie der Profos.
Die Luntenstöcke mit den glimmenden Zündschnüren senkten sich auf die Bodenstücke der Zwölf- und Siebzehnpfünder, mit denen die Galeone ausgerüstet war. Knisternd fraß sich die Glut durch das Pulver in den Zündkanälen bis aufs Zündkraut. Die Kanonen ruckten zurück und spien Feuer, Rauch und Eisen aus, fünfmal in kürzesten Zeitabständen. Aus zehn Geschützen bestand die Backbordbatterie der „Michelangelo“, weitere zehn Kanonen befanden sich auf der Steuerbordseite des Hauptdecks. Insgesamt verfügte das Schiff über zwei Dutzend Zwölf- und Siebzehnpfünder, wenn man die Bug- und Heckgeschütze mitrechnete.
Fast gleichzeitig mit der „Michelangelo“ schoß jedoch auch der Gegner, und wieder lagen zwei oder drei seiner Kugeln beängstigend gut im Ziel. Da brach, knackte und splitterte es an Bord des Italieners, da flogen die Trümmer in alle Himmelsrichtungen und brüllten die verwundeten Männer in Todesangst.
„Satan!“ stieß Cantieri keuchend hervor. „Wie kann der Hund so schnell seine. Steuerbordgeschütze nachladen? Wie schafft er das bloß?“ Indem er die Frage mehr an sich selbst als an Benedetti stellte, gab er sich auch schon die Antwort: Der Gegner war besser armiert und schien bei jeder Attacke immer nur drei oder vier seiner Kanonen abzufeuern.
„Er luvt an und hält auf uns zu!“ schrie der Ausguck über ihren Köpfen.
Cantieri verließ seine Deckung und arbeitete sich bis zum Profos vor.
„Haben wir nicht getroffen?“ fuhr er ihn an. „Was ist los, warum besorgen wir es ihm nicht?“
„Bislang nur zwei Treffer!“ rief der Profos.
„Die Männer sollen besser zielen!“
„Besser zielen!“ brüllte der Profos. „Jagt ihm Löcher in den Bauch, oder ich gebe euch die Peitsche zu spüren!“
Leone Cantieri warf einen Blick über das zertrümmerte Schanzkleid und konnte die Umrisse des fremden Schiffes erkennen, das jetzt keine halbe Kabellänge von der Bordwand der „Michelangelo“ entfernt geisterhaft aus dem Dunkel auftauchte. Zwei Mündungsfeuer blitzten über der Back auf, die Kugeln pfiffen heran. Wieder duckte er sich.
Drehbassenfeuer, dachte er, mein Gott, jetzt versuchen sie, uns zu entern. Sie sind heran, ehe wir Unterstützung durch die „Tirrenia“ und die „Leonardo“ erhalten. Gerechter Gott, sie sind wahrhaftig mit dem Teufel im Bund.
Wieder spürte er Panik in sich aufsteigen und wußte sie nicht mehr zu bezwingen.
Man schrieb das Jahr 1591, es war die Nacht vom 8. auf den 9. November, eine Nacht, die sie alle nicht wieder vergessen würden, vorausgesetzt, sie würden diese Stunde überhaupt lebend überstehen.
Leone Cantieri sprang selbst an eins der Geschütze, um es auf den heransegelnden Feind zu richten und abzufeuern.
Zu spät, dachte er, viel zu spät, sie schaffen es, sie entern uns.
Franco Benedetti eilte ebenfalls den Geschützführern zu Hilfe und warf, während er an einer der Culverinen hantierte, seinem Kapitän einen verstohlenen Blick zu.
Du mußt sterben, dachte er, ich aber werde leben, glücklich und zufrieden leben. Er hatte das Bild in jener verschwiegenen Osteria des Hafens von Livorno wieder deutlich vor Augen: Vor drei Tagen war er von dem geheimnisvollen Fremden angesprochen worden, der des Spanischen mächtig war und sich ihm gegenüber als Lord Henry ausgegeben hatte. Bei einem vollen Becher Chianti hatte sich Lord Henry zu ihm vorgebeugt und ihm viel Geld versprochen, Gold, Silber und Diamanten.
Benedetti konnte sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen.
Er sah zu dem Schiff, das sich drohend näher und näher schob.
Die Culverine, von Cantieri gezündet, stieß brüllend ihre Ladung aus dem Rohr. Die Kugel schlug dem Piratenschiff in das Galion und knickte ihm den Bugspriet mitsamt der Blinde halb weg. Die Männer der „Michelangelo“ jubelten, doch weder Cantieri noch Benedetti, noch der Profos oder einer der anderen Schiffsoffiziere fielen mit in das Gelächter und Geschrei ein.
Sie alle wußten, daß der Treffer am Lauf der Dinge nichts mehr zu ändern vermochte.
Lord Henry, dachte Franco Benedetti, ich werde reich sein, sehr reich, denn ohne mich wäre es dir nie gelungen, dieses Schiff aufzubringen und den Schatz zu erbeuten – den Schatz der Medici.
Philip Hasard Killigrew, der Seewolf, stand auf dem Achterdeck der „Isabella VIII.“ und hob lauschend den Kopf.
„Sir!“ rief Bill, der Ausguck, vom Großmars aus – nicht übermäßig laut, aber doch verständlich. „Hörst du das?“
„Sicher“, entgegnete er. „Kanonendonner vor der Küste. Weiß der Teufel, was da los ist.“
„Ich kann die Mündungsblitze der Geschütze sehen“, sagte Bill. „Bislang scheinen es zwei Schiffe zu sein, die miteinander im Gefecht liegen – nein, einen Augenblick! Jetzt mischt sich auch ein Dritter mit ein!“
Hasard richtete seinen Blick nach Osten und sah den zuckenden Schein der Feuer, die wie Wetterleuchten über die Kimm geisterten.
„Bist du sicher, daß es eine Seeschlacht ist?“ fragte er.
„Ja, Sir. Es ist eine Bewegung in dem Geschehen, wie sie an Land nicht möglich wäre. Die Blitze verlagern sich ständig weiter nach Süden.“
„Gut, danke, das genügt mir vorerst“, sagte Hasard. „Halte weiterhin die Augen offen.“
Er sann darüber nach, wer sich wohl dort drüben, vor der Küste der Toskana, miteinander schlug, gelangte aber zu keinem Schluß. Vielleicht wieder Türken, dachte er, die irgendeinen Konvoi oder ein paar harmlose Fischer überfallen haben, vielleicht sogar ein Kerl wie Ahmet Aydin, einer seiner Verbündeten – möglich ist alles.
Hasard hatte nicht das geringste Interesse daran, in irgendwelche Konflikte verwickelt zu werden. Von Kerlen wie diesem Ahmet Aydin, mit dem sie zuletzt zu tun gehabt hatten, hatte er gründlich die Nase voll. Der Abstecher nach Sardinien und nach Korsika war im Grunde schon ein Umweg gewesen, Etappen, die mit ihrem eigentlichen Ziel nichts zu tun hatten.
Er wollte nach Nordafrika, nach Ägypten und zur Mündung des Nils, um das Rätsel der drei Landkarten aufzuspüren, die er wie einen Schatz hütete. In den Gesprächen, die er auf Mallorca unter anderem mit Ada, der Syrerin, geführt hatte, hatte sich herauskristallisiert, daß sie sich trotz aller Zweifel und Bedenken, die sie hegten, offensichtlich doch auf der richtigen Fährte befanden. Neue Entdeckungen schienen auf sie zu warten – Geheimnisse, von denen man daheim in England bislang nichts ahnte, und allein das war für einen Mann wie Hasard Anreiz genug, jede erforderliche Strapaze auf sich zu nehmen.
Aber vorläufig beschrieben sie immer noch einen Umweg und lagen weitab vom rechten Kurs. Logisch wäre gewesen, von der Küste Korsikas aus durch die Straße von Bonifacio zu segeln und dann quer durch das Tyrrhenische Meer zur Straße von Messina vorzustoßen. Doch die Winde aus südlichen Richtungen hätten die Männer der „Isabella“ dazu gezwungen, sich durch mühseliges Kreuzen an die Meerenge zwischen Korsika und Sardinien heranzupirschen, wodurch wieder viel Zeit verlorengegangen wäre. Außerdem war damit zu rechnen, daß es in der Straße von Bonifacio stürmte. Die Passage war, was Sturm und widrige Strömungen betraf, ziemlich berüchtigt, und das Risiko, das sie bei einer nächtlichen Durchfahrt auf sich nahmen, wäre relativ hoch gewesen.
So hatte Hasard beschlossen, nach Norden abzulaufen und Korsika am Cap Corse zu runden. Danach konnte er auf Südkurs gehen – was er jetzt, rund dreißig Meilen querab des nördlichsten Zipfels der Insel, tat – und am Südwestwind, der nun mehr und mehr nach Westen drehte, mit zügiger Fahrt Kurs auf Sizilien nehmen.
Ben Brighton stieg den Backbordniedergang hoch und gesellte sich zu ihm.
„Ich weiß“, sagte er. „Die Zeit bis zur nächsten Wachablösung, bei der ich wieder dran bin, ist noch nicht herum. Aber ich bin von den Schüssen wach geworden und wollte mal sehen, was los ist.“
„Genaues wissen wir auch nicht“, sagte der Seewolf. „Aber es dürfte wohl das beste sein, sich nicht weiter darum zu kümmern.“
„Und wenn dort jemand unsere Hilfe braucht?“
Sein Erster Offizier und Bootsmann lächelte. „Du weißt doch ganz genau, daß ich es so nicht meine.“
„Mann, ist dir nicht auch daran gelegen, so schnell wie möglich nach Ägypten zu segeln?“
„Oh, gewiß doch! Meine Neugier ist geweckt. Ich möchte wissen, was es mit den dreieckigen Riesenburgen auf sich hat, die wir dort antreffen werden, vorausgesetzt, die Karten sind nicht gefälscht.“ Er wies mit dem Arm nach Osten, wo das Zucken der Mündungsfeuer jetzt öfter und intensiver erfolgte. Grollend rollte der Kanonendonner über die See. „Aber wir können es wohl doch nicht vermeiden, uns mit diesem kleinen Problem auseinanderzusetzen. Wir scheinen in spitzwinkligem Kurs auf die Schiffe zuzuhalten, die sich ebenfalls nach Süden bewegen.“
„Stimmt haargenau. Ich bewundere deinen Scharfsinn.“
„Willst du ihnen ausweichen?“
„Nein. Denkst du, ich habe vor ein paar lausigen Piraten Angst?“
Ben lachte. „Jetzt spricht wieder ganz der alte Philip Hasard Killigrew aus dir. Großartig! Ob die Türken, die hier herumbiestern, wohl einen spanischen Verband angegriffen haben?“
„Mit Spaniern dürfte hier eigentlich nicht groß zu rechnen sein. Die toskanischen Gewässer sind für unsere lieben Freunde, die Dons, nämlich fast so etwas wie Feindesland.“
Ben rieb sich mit der Hand das Kinn. „Weißt du, über die Toskana ist mir eigentlich wenig bekannt. Steht denn nicht ganz Italien unter spanischer Herrschaft?“
Diesmal mußte Hasard lachen. „Laß das bloß keinen Toskaner hören, er würde es dir furchtbar übelnehmen. Venedig, Genua und Florenz sind Philipp II. immer noch nicht botmäßig, und sie werden sich wohl auch nicht davon überzeugen lassen, daß es besser sei, vor den Spaniern den Kopf zu beugen. Nach allem, was ich vernommen habe, sind die Venezianer, die Ligurer und die Toskaner nämlich selbst ganz schön stolz und dickschädelig. Und sie wissen sich auch zu verteidigen.“
„So wie die Holländer der Sieben Provinzen?“
„So ungefähr. Die Toskana ist schon immer selbständig gewesen, das geht fast bis in die älteste Geschichte des Landes zurück. Hier saßen schon die alten Etrusker, ehe Rom überhaupt gegründet wurde.“
„Ja“, sagte Ben Brighton. „Jetzt fällt mir etwas ein: In Florenz herrschen doch seit dem vergangenen Jahrhundert die Medici, nicht wahr?“
„Richtig, und das ist auch heute noch so. Die Toskana ist ein Herzogtum geworden, und der Granduca ist Ferdinando I. de Medici.“
„Der Großherzog von Gottes Gnaden“, sagte Ben. „Das soll eine sehr reiche Familie sein.“
„Stinkreich sind die Medici, und in Livorno, das von uns Leghorn genannt wird, liegt eine der bestausgerüsteten und mächtigsten Flotten des gesamten Mittelmeers.“
Ben stieß einen leisen Pfiff aus. „Livorno hat doch schon Handel mit der Neuen Welt geführt, als diese eben erst von Kolumbus entdeckt worden war, oder?“
„So kann man es ausdrücken.“
„Aber warum haben die Medici und ihre Freunde dann nicht selbst Gebiete in Übersee erobert?“
„Offenbar haben sie daran kein Interesse. Ihnen ist in erster Linie am kaufmännischen Gewinn gelegen.“
„Und in zweiter Linie an der Verteidigung ihres Großherzogtums, damit der innere Frieden erhalten bleibt“, schlußfolgerte Ben. „Sie haben also kein Verlangen danach, ihr kleines Reich zu vergrößern. Findest du das klug?“
„Sehr sogar. Die Toskaner werden dadurch den längeren Atem haben und ihre Unabhängigkeit und Eigenständigkeit wahren, während es mit anderen Nationen, die früher viel Macht gehabt haben, allmählich abwärtsgeht.“
„Damit meinst du die Spanier und Portugiesen, nicht wahr?“
„Ja.“ Der Seewolf lächelte. „Trotzdem sollte man sie auch jetzt nicht unterschätzen, das habe ich dir und den anderen ja schon mal gesagt.“
„Durchaus. Aber die Dons leben mit den Toskanern in einer Art friedlicher Koexistenz, wenn ich dich richtig verstanden habe.“
„Ja, so kann man es nennen.“
„Dann sind wir in diesen Gewässern also vor Spaniern und Portugiesen relativ sicher?“
„Ich denke schon.“
Sie schwiegen und blickten wieder nach Osten, wo die Lichtblitze über dem Meer nicht aussetzen wollten. Das dumpfe Explosionsgeräusch der Schiffskanonen wurde vom Südwestwind in Richtung Festland getragen, war aber für ihre Ohren deutlich genug zu vernehmen. Es klang wie der drohende Donner eines heraufziehenden Gewitters.
Ihre Gedanken bewegten sich in derselben Richtung. Sie wußten, daß sie mit Schiffen der spanischen Krone kaum ins Gehege geraten würden, spürten aber doch, daß sie sich dem Ereignis, das dort, vierzig, fünfzig oder noch mehr Meilen entfernt, seinen Lauf nahm, nicht entziehen konnten. Auf die eine oder andere Art würden sie darin verwickelt werden.
Hätte Hasard auch nur geahnt, wer es war, der die Schiffe aus Livorno angegriffen hatte, dann hätte er unverzüglich Kurs auf den Schauplatz des Geschehens genommen.
Mit Lord Henry, dem er auf den Kapverdischen Inseln schon einmal begegnet war, hätte er sich nämlich gern ausführlich „unterhalten“. Zwischen ihnen beiden gab es das eine oder andere zu besprechen.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.