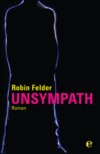Buch lesen: «Verzerrte Gesichter»
Verzerrte Gesichter
Impressum
Sämtliche handelnden Personen und Begebenheiten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen, existierenden Unternehmen sowie Ereignissen oder Schauplätzen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt.
© 2021 Trubel & Heller, München
Erhältlich als Taschenbuch, E-Book und Hörbuch.
www.verzerrtegesichter.de Korrektorat: Holger Metz Umschlagkonzept: Robin Felder Umschlaggestaltung: Michael Dorschner | kimi kido Satz: Timo Leibig Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
Verzerrte Gesichter: Roman
Bücher von Robin Felder
Der Autor:
Robin Felder lebt und arbeitet in München. Bislang sind von ihm erschienen: Unsympath, Paranoia, The Godjob, Verzerrte Gesichter.
Der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Arthur Schopenhauer Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind. Anaïs Nin
Bis jetzt hat er sich noch nicht blicken lassen. Aber der kommt schon noch.
Die S-Bahn donnert wenige Meter über mir vorbei, während ich vor der Fußgängerunterführung in dem kleinen Park stehe und warte. Der vom Tunnel verdichtete Schienenlärm lässt mich den Kopf einziehen. Ich spähe ins Halbdunkel, Plakatfetzen an der Mauer, am Boden Pfützen, die nie richtig trocknen. Auch nicht an einem Sommertag wie heute. Durch diesen Schacht dürfte Clemens in vier, fünf Minuten geradelt kommen, wenn er in der S-Bahn eben gesessen hat. Sein üblicher Nachhauseweg.
Ich drehe mich um und schlendere ein paar Meter durch die menschenleere Grünanlage. Vor mir eine weitläufige Wiese, durchbrochen von vereinzelten Bauminseln. Die Bäume sehen aus, als würden sie sich langweilen. Das ganze Gelände wirkt im sanften Abendlicht wie eine Spielzeugeisenbahn-Landschaft.
Am anderen Ende der Anlage taucht die Silhouette einer Frau mit Kinderwagen auf und hetzt von links nach rechts. Ist auch schon spät für Mutter mit Kleinkind. Wenn ich mich nicht täusche, hat sie wieder einen dicken Bauch. Ist gerade Mode: ein wenige Monate altes Baby haben und bereits schwanger mit dem nächsten sein.
Noch mehr Menschen gebären. Genau was die Welt braucht.
Die Frau verschwindet. Zwanzig vor zehn. Gleich geht die Sonne vollends unter. Aber immer noch so um die zwanzig Grad.
Ich habe plötzlich ein ungutes Gefühl, Clemens einfach abzufangen. Auch wenn ich ihn gestern nicht auf seiner Geburtstagsfeier überraschen konnte, wird ihm das hier ganz sicher etwas überzogen erscheinen.
Er spielte heute Abend ein Konzert in der Staatsoper. Verdi, Rigoletto. Clemens ist Geiger bei den Philharmonikern. Im Rahmen eines Kulturfestivals wurde heute bereits um sechs angefangen. Sonderaufführung – was weiß ich. Luxussubventionierte Branche. Klassik gibt mir nichts.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Musikern, die geschuftet haben wie die Irren, um in ein Weltklasseorchester aufgenommen zu werden, war Clemens ein Naturtalent. Er ist jetzt, mit Ende zwanzig, schon weiter als die meisten Gleichaltrigen.
Ich zucke fahrig mit den Halsmuskeln. Nervöse Angewohnheit. Ich dachte, Clemens nimmt mindestens eine S-Bahn früher.
Da kommt er ja, was sagt man dazu? Ich sehe ihn auf der anderen Seite der Gleise beherzt in die Pedale seines Rads treten, den Geigenkasten auf den Rücken gespannt. Musisch hochbegabt und gleichzeitig sportlich, der Clemens. Manche haben einfach das komplette Paket abbekommen.
Ich trabe die paar abschüssigen Meter zurück zur Unterführung und bleibe, den Zugang versperrend, stehen. Clemens fährt gerade gegenüber in den Tunnel ein und dürfte mich nun als breitbeinigen Schattenumriss am ihm entgegengesetzten Ende postiert sehen. Bei der Geschwindigkeit, die er draufhat, muss er exakt jetzt bremsen, um mich nicht umzufahren.
Was er auch tut.
Leider läutet er dabei Sturm, auf so einer metallisch scheppernden Uraltklingel mit »Weg da!«-Ton. Bewirkt natürlich nichts, ich rühre mich keinen Millimeter vom Fleck.
Zwei Handbreit vor mir kommt sein Vorderreifen zum Halt. Clemens’ Gesicht wirkt gereizt und zugleich überfordert, als könne er nicht fassen, wer da vor ihm steht und seine Route blockiert.
Ich strecke die Arme aus, Handflächen nach oben gerichtet, als würde ich zum Gebet aufrufen. Erhebet Euch, in etwa. Aber natürlich meine ich: Überraschung!
Ich lächle. Ist doch auch Wahnsinn. Wir hier.
Clemens stellt seinen linken Fuß auf den Betonboden, der Hosenaufschlag von einer Fahrradklammer zusammengehalten, beide Hände noch am Lenker, die Bremsen umkrallt, und sagt: »Was soll das denn?«
Er meint meine Skimaske.
* * *
Noch könnte ich abbrechen, falls notwendig. Hinter mir kommt niemand, hinter Clemens auch nicht, ich stehe ihm günstig positioniert gegenüber. Sieht machbar aus. Kann losgehen.
»Zur Seite, aber sofort«, schnauzt Clemens mich schroff an, als hätte er irgendein fundamental verankertes Mitspracherecht.
Komisch, ich wäre in so einer Situation niemals schroff. Diese ganzen vom Leben verhätschelten Wohlstandsmenschlein haben verlernt zu erkennen, wann es angebracht ist, demütig zu sein. Das würde ihm jetzt zwar auch nichts nützen, aber wahr ist es nichtsdestoweniger.
Für den Bruchteil einer Sekunde starre ich ihn an und versuche zumindest, dass es mich nicht juckt. Seine blitzenden Äuglein durchbohren mich. Männer mit runden Brillengläsern sehen alle aus wie SS-Offiziere. Noch fieser wirken nur Männer mit Stupsnasen.
Sowie alle Zwerge. Hüte dich vor kleinen Männern!
Mein Elektroschocker jagt Clemens fünfhunderttausend Volt in die Brust. Das Geräusch ähnelt einem Knistern wie Brutzeln zugleich. Er stürzt vom Rad, knallt schlotternd gegen die Wand der Unterführung. Schlagartig verschwindet das Forsche aus seinem Gesicht und ich sehe echte Panik in seinen Augen. Offenbar hat man ihn vor vielen Dingen im Leben gewarnt, aber nicht hiervor.
Ich lege gleich nach und versenge seinen Hals mit einer weiteren Stromladung, um sicherzugehen, dass er wirklich handlungsunfähig ist.
Zielorientiertes Arbeiten. Handgreiflichkeiten wären nämlich überhaupt nicht mein Ding.
Sein Körper zittert, wehrt sich gegen die Ohnmacht. Es sieht wie gespielt aus. Ich habe den Eindruck, als sollte ich klatschen, aber ich tue es nicht.
Ich packe ihn unter den Achseln und ziehe ihn den halben Meter aus dem Tunnel, wuchte ihn seitlich auf den Grashügel, der hoch zu den Gleisen führt. Zwischen Betonwand und Gestrüpp. In null Komma nichts schieße ich ihm die dritte Elektroladung in den Körper, der Geruch seines Deos steigt mir in die Nase, ich sehe Schweiß in großen Tropfen in seinen Haarwurzeln stehen und schneide ihm mit einem Skalpell mühelos den kleinen Finger seiner linken Hand ab. Am untersten Gelenk. Womit ich einem jungen Mann, dem bis vor wenigen Sekunden eine vielverheißende Zukunft zu Füßen lag, die Lebensgeister austreibe.
Verluste gehören einfach zum Leben.
Mit der Emotionslosigkeit des wahren Getriebenen schaue ich erneut, ob jemand kommt, aber in diesem konservativen Vorort herrscht um diese Zeit tote Hose.
Der arme Clemens rührt sich nicht mehr. Ich weiß eigentlich nicht, warum mich das überrascht.
Kein Tropfen Blut weicht aus dem geröteten Knorpelstumpen an seiner Hand. Im Gegensatz zu dem abgetrennten Finger, aus dem es öligrot tropft und den ich zwischen meinem Daumen und Zeigefinger halte. Schön sieht das nicht aus.
Um der ganzen Sache ein Ende zu bereiten, lege ich den Stummel in eine Tüte, prüfe, ob Tüte, Schocker und Skalpell sicher in meinen Taschen verstaut sind, schlage Clemens sicherheitshalber mit der Faust fest ins Gesicht, je länger er bewusstlos bleibt, desto günstiger (für mich, für ihn, für alle), meine Schlagbewegung ähnelt der eines fünfjährigen Mädchens, ich habe einfach keine Übung, wuchte das Fahrrad hoch, wende es, radle in die Richtung davon, aus der Clemens kam, lasse die Unterführung schnell hinter mir, reiße mir die Maske vom Kopf und bleibe mit dem ganzen Ablauf vier Sekunden unter der Zeit meiner Probeberechnungen.
Adrenalin beschleunigt.
»Zur Seite, aber sofort!«, hat er allen Ernstes einen vermummten Mann angefaucht, der sich ihm in einem engen Tunnel gegenüberstellte? Knapp eins neunzig, schwarze Bomberjacke, Handschuhe. Man braucht das nicht zu vertiefen, aber Clemens ist nur ein weiteres großspuriges Arschloch in einem Heer aus großspurigen Arschlöchern. Auch wenn es hier schlussendlich überhaupt nicht um ihn geht, traf es doch den Richtigen.
Ich biege in eine Seitenstraße ein. Die ganzen gepflegten Einzel- und Doppelhäuser, die an mir vorbeifliegen, die liebevoll bepflanzten Vorgärten im Licht der allerletzten Sonnenstrahlen des Tages ... all das, zusammen mit meinem inneren Fluchtdruck, lässt mich fühlen, als radelte ich durch Gruselhausen.
Ein wahrer Fragenhagel prasselt durch meinen Kopf, als ich das Rad an einem Laternenpfahl abstelle und die restlichen fünfzig Meter auffällig unauffällig zu meinem Auto gehe. Habe ich nichts am Tatort zurückgelassen? Hat mich doch jemand beobachtet? Folgt mir wer?
Ich bin weiß Gott keine Person, die irgendetwas leichtzunehmen versteht.
Meine Planung ist akribisch. Auf Einzelheiten achten, keine ist zu gering. Regeln sind das A und O. Und gerade dann muss man aufpassen, dass man nicht verrückt oder schlampig wird.
Dies war mein achtzehnter Versuch, Clemens abzupassen! Siebzehnmal habe ich abgebrochen. Weil jemand kam, weil ich mich nicht in Form fühlte, weil dies, weil jenes. Stets hat irgendwas nicht hundertprozentig gepasst.
Man weiß doch immer von vornherein, ob man einen Fehler begeht. Die meisten können sich nur nicht daran hindern. Deshalb gilt es, sich nichts vorzumachen. Das halte ich bei allen Verstümmelungen so.
Aber meine wertvollste Erkenntnis lautet: Wenn dir letztlich egal ist, ob dein Unterfangen misslingt, so sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlags um die alles entscheidenden Prozentpunkte.
Während ich im Rückspiegel meine Frisur mustere, dröhnt »I Want It That Way« saulaut aus meinem Autoradio. Backstreet Boys. Der Sommerhit dieses Jahres. 1999. In das neue Jahrtausend wird Clemens weniger optimal starten. Sein altes Leben ist gelaufen. Violinvirtuose? In dieser Hinsicht ist nichts mehr zu machen.
Meine Jeans muss dringend gewaschen werden. Grasflecken.
Ich überrasche mich dabei, wie ich lächle.
Eine emotionale Ungenauigkeit.
Die Nacht wird langsam schwarz.
Gleich bin ich zu Hause. Kurz runterkommen. Finger runterspülen. Baden. Noch fernsehen vielleicht.
Und dann ab ins Bett.
* * *
Es gibt diesen tief verankerten Irrglauben in unserer Gesellschaft, Mord stelle die ultimative Bestrafung eines Menschen dar.
Literatur, Film, Mythen aller Art vermitteln seit jeher dieses Missverständnis vom Töten als höchster Form der Vergeltung.
Aber der Tod bedeutet nichts anderes als Nichtexistenz.
Der Tod stellt lediglich den Zustand wieder her, in dem das Lebewesen sich vor seiner Zeugung befand.
Was soll daran schuldabgeltend sein?
Worin findet sich da ein Aspekt von Strafe?
Die meisten Denkvorgänge des Menschen fußen auf falschen Prämissen.
Das Jenseits ist bestenfalls Gnade, niemals Sühne.
Mein allesverschlingendes Bedürfnis nach Rache kann folglich nur dadurch gestillt werden, jeden Moment im Leben dieser einen Person zur Hölle auf Erden werden zu lassen. Ihr Augenblick für Augenblick Unglück zu bescheren.
Kummer, Schmerz, nie enden wollendes Elend.
Eine Herausforderung, die das eigene Dasein nicht angenehmer macht, die jedoch alleinige Option bleibt, wenn man begriffen hat, wie das Leben wirklich läuft.
Und sobald du begriffen hast, wie das Leben wirklich läuft, ist dein Leben sowieso gelaufen.
Aber dann gehts auch erst richtig los.
* * *
Ich verachte meinen Sohn. Und ich kann nichts dagegen tun.
Die Füße auf dem Schreibtisch, sitze ich telefonierend im zurückgekippten Chefsessel in meinem lichtdurchfluteten Büro, Handy am rechten Ohr. Auf YouTube läuft nebenbei ein Katzenvideo, stummgeschaltet. Darin wälzt sich ein getigerter Kater genüsslich auf einer Couch.
Mein Sohn sagt: »Aber es sind Fe-ri-en«, und zieht das Wort unausstehlich in die Länge. Am liebsten würde ich einfach auflegen. Ich habe ohnehin gleich einen Kaufvertrag zu beurkunden. Stattdessen höre ich mich sagen: »Du kannst das Jahr auch sofort wiederholen, wenn du nicht bald ...«
»Oh Ma-a-nn, chill halt mal. Die meisten Dinge ergeben sich von selbst, wenn man sie nur lässt«, unterbricht Maximilian mich und tut jetzt so, als ob er den Mund voll hätte.
Er ist sechzehn, bereits eins achtundachtzig groß, schwer internetsüchtig, besitzt die Aufmerksamkeitsspanne einer Stubenfliege, redet daher wie ein TV-Moderator mit Professur in Philosophie und, ich kann es nicht anders sagen, ist ein hohler Idiot.
Auf meinem Bildschirm wechselt das Video automatisch zu einem Filmchen mit einer dreifarbigen Katze, die auf einem flachen Saugroboter sitzend durch eine Küche fährt. Lieb, aber Ähnliches hab ich schon zu oft gesehen. Ich klicke weiter.
»Dad?«, fragt Max in die entstandene Pause hinein. Er nennt mich ernsthaft Dad. Englisch. Was für eine Pseudoscheiße.
Ich wechsle den Telefonhörer von einem Ohr zum anderen und komme noch einmal meiner Pflicht als Erziehungsberechtigter nach, indem ich mir etwas Konstruktives aus dem Kreuz leiere, er wird ganz sicher sitzen bleiben, aber es interessiert mich nicht mehr.
»Kein Mensch wird dich später mal bewundern für all die Spiele, die du gespielt hast«, gebe ich zum Besten.
»Sagt wer?« Max betont die beiden Wörter wie tatü in tatütata.
Gelangweilt und dabei überheblich wirken, das hat er drauf. Ein Riesentalent. Leider sein einziges.
Zwei in einem Körbchen ineinandergekuschelte Katzen auf YouTube. »Geschwister | unzertrennlich!« steht in der Beschreibung.
Wir haben die Kontrolle über Max verloren, als er elf oder zwölf war, würde ich sagen. Da wurde er mit einem Schlag wie all die anderen Kids um ihn herum von einem dunklen digitalen Sog absorbiert, lethargisch vor Überreizung.
Natürlich weiß ich, dass bereits Sokrates vierhundert vor Christus die Jugend verloren gegeben hat. Aber das besänftigt mich kein bisschen. Ich habe das Gefühl, die nachrückende Generation ist anders anders als je zuvor. Beinah wie traumatisiert. Sie besitzt keinerlei Potenzial.
Waren Jugendliche bislang mitunter, von mir aus, subversiv, aufrührerisch, radikal oder reaktionär oder progressiv, extrem eigen, all so was, so sind Max und seine Kumpels nur eines – dumpf. Auf eine deckungsgleiche Art, dass einem angst und bange wird.
Es ist keine gewagte Hypothese: Der ganze gleichgeschaltete Haufen wird bald schon zuerst entmündigt und anschließend entrechtet werden. Das einzig Gute daran: Sie werden es nicht mal merken.
Wie durch einen akustischen Nebel höre ich Max noch monoton etwas zu Vernachlässigendes brabbeln, als meine Sekretärin hereinkommt. Ich hebe meine Füße vom Tisch, klicke YouTube weg und greife nach den Papieren, die sie mir in die Hand drückt. Der nächste Vorgang, mein 11-Uhr-Termin. Ich nicke ihr zu. Sie nickt zurück und macht sich auf, um die Truppe aus dem Wartezimmer zu holen.
»Dann wirst du eben Weltklassegamer, ohne Abitur. Oder Sanitärverkäufer in World of Warcraft. Ganz wie du meinst!«, sage ich so spöttisch wie möglich zu Max und lege auf. Dann wird mir klar, dass ich das nicht hätte tun sollen. Und dann denke ich mir, woher will ich wissen, ob das nicht genau richtig bei ihm ankommt.
»Danke, Frau Rütting-Illinger«, rufe ich Frau Rütting-Illinger hinterher. Fünf Silben, ein Doppelnachname. Fünf Silben, die sie mich zigmal am Tag auszusprechen nötigt, weil sie annimmt, es würde irgendein Schwein interessieren, wie ihr Mädchenname lautet. Ich weiß ja noch nicht mal, welcher von beiden das sein soll.
Halbherzig rücke ich meine Krawatte zurecht, schlage die Akte auf und merke, dass ich schon die ganze Zeit die Augen zusammenkneife. Die Sonne knallt jetzt richtig durch die sechs Fenster und lässt mein modern-schlichtes Büro im zweiten Stock überbelichtet erscheinen.
Die Notarkanzlei, die ich mir mit einem Kollegen teile, liegt direkt im Stadtzentrum, in einem herrschaftlichen Altbau schräg gegenüber dem Rathaus, Fußgängerzone, Bestlage. Die Miete ist ein perverser Witz. München ist bald London.
Notare Dr. Staiger & Dr. Nöten steht auf dem Messingschild unten an der Tür, mit amtlichem Notarwappen, so wie man sichs vorstellt. Ich als Erster.
»Herr Kofler, grüße Sie«, rufe ich allzu munter, als ich ihn mit den Klienten im Rücken eintreten sehe und aufstehe. Zack, Anknipsgrinsen. Wir klopfen einander professionell herzlich auf die Schultern und ich rieche, dass er gerade draußen geraucht hat. Sebastian Kofler ist selbstständiger Makler und einer meiner Stammkunden.
Absolute Grundregel: Wenn jemand aussieht wie ein Arschloch, ist er auch eins. Niemals uminterpretieren aus Gründen der Selbstbesänftigung. Killerfresse, aber zartes Gemüt? Das gibt es einfach nicht.
Er verkauft heute eine Achtundneunzig-Quadratmeter-Neubauwohnung an eine vierköpfige Familie, die gerade in Orgelpfeifenformation neben ihm Aufstellung nimmt. Ein Quartett aus Passfotogesichtern. In rascher Abfolge schüttle ich zuvorkommend deren Hände, die meisten kleben, nenne viermal meinen Nachnamen und zeige entlang des Besprechungstisches. Bitte Platz zu nehmen.
Frau Rütting-Illinger wuselt herum, legt Unterlagen auf dem Konferenztisch zurecht und stellt eine Kaffeekanne ab, neben dem Tablett mit unseren dünnen Tassen.
Ich sitze an der Stirnseite, links neben mir Beurkundungsprofi Kofler, ganz Maklerklischee im Sportjackett. Fehlt noch, dass er die Sonnenbrille, die in seinen Haaren steckt, aufzieht.
Rechts von mir der extra glatt rasierte Familienvater im karierten Kurzarmhemd, ziemlich aufgeregt, weil es um, mal nachsehen, einen Kaufpreis von immerhin sechshunderttausend Euro geht (dreißig Prozent finanziert) und es für ihn vermutlich so etwas wie die Erfüllung eines Lebensideals darstellt, seinen undankbaren Kindern etwas hinterlassen zu können, damit sie es mal besser haben als er.
Zwar zahlt er den Kaufbetrag allein und wird mit seiner Frau auch einziehen – als Eigentümer eintragen sollen wir die Wohnung jedoch auf seinen neben ihm sitzenden Sohn, einen grobschlächtigen Landproll Ende zwanzig, mit obligatorischem Schlangentattoo am Hals, sowie auf seine Tochter, zwei Jahre älter, mit reichlich Lipgloss, silbernem Nasenring und komplett tätowierten Unterarmen mit Fantasymotiven. Erwachsen und doch für immer neun.
Echt, ich kanns nicht mehr sehen. Seit ich zwanzig bin, läuft dieser Tattooscheiß. Jetzt bin ich sechsundvierzig. Warum kann ich mich einfach nicht daran gewöhnen?
Im kollektiven Irrglauben, sich zu individualisieren, sehen alle vollkommen identisch aus. Alter und Bildung haben nichts damit zu tun. Sogar mein Sohn überblickt, dass Tattoos nichts weiter bedeuten als Gefallsucht und Mitläuferschaft.
Die Vierte im Familienbund meiner Kundschaft, Mutter Annette Korbmeyer in veilchenfarbener Schlussverkaufbluse, ist derart nervös, dass ich den Eindruck habe, sie heult gleich los. Ein biederes Schattengewächs zur Salzsäule erstarrt. Das echte Leben ist doch etwas anders als in ihren Erotikromanen.
Irgendwo in einem über uns liegenden Stockwerk arbeitet jemand mit einem Bohrhammer.
Kofler und ich betreiben noch etwas Small Talk (macht mich krank, hab ich mir über die Jahre aber draufgeschafft) und ich werde von einer tiefen Niedergeschlagenheit erfasst.
Wie tröstlich, dass sich dieses Gefühl vertraut anfühlt.
Legen wir los.
»So, wir sind heute hier, um einen ... Kaufvertrag ... für eine Wohnung in ... Harlaching zu beurkunden«, sage ich beim Durchblättern der Papiere. Ich spreche langsam, meine Worte scheinbar abwägend, um zu zeigen, wie offiziell das alles ist.
Den Kaufvertrag hingegen trage ich mit meiner Schnelllesetechnik vor, erzeuge ein überflüssiges, aber kalkuliertes Gefühl von Eile, und immer wieder gibt es von Papa ein paar Zwischenfragen zu Paragrafen, die vollkommen unbedenklich sind, wohingegen er kritische Abschnitte souverän durchwinkt.
Aber wer kann es ihm verübeln? Er ist angesichts der Tragweite einfach restlos überfordert.
Für mich bedeutet dieser Termin eine Routineabwicklung mit einer Kostennote von knapp sechstausend Euro. Für weniger als zwei Stunden Gesamtaufwand. Die Nachbearbeitung durch mein Büro eingerechnet, lass es drei sein. Patentanwälte können über solche Beträge freilich nur schmunzeln. Dass das Rechtsgeschäftssystem eine sich selbst aufrechterhaltende Farce ist? Jeder fähige Jurist weiß um die Verachtenswürdigkeit seiner Zunft. Genau daran erkennt man ja die guten.
Wir kommen zu den Schenkungsurkunden, da Herr Korbmeyer die Wohnung Sohn und Tochter zu gleichen Teilen überschreibt.
»Entschuldigung, was genau heißt das?«, schnaubt er skeptisch und unterbricht mein Vorlesegewitter, knapp bevor wir durch sind, ein hoffentlich letztes Mal. Einfühlsam blicke ich ihn an. Männer mit gefärbten Haaren! Ähnlich befremdlich wie Menschen in Funktionskleidung. Sein rechtes Bein beginnt unter dem Tisch zu wippen. Er meints nur gut.
Ich verstehe das schon. Er ist Mitte fünfzig. Seit ich in meinen Vierzigern bin, hat sich mein Nervenkostüm auch massiv verschlechtert. Ich bin nicht mehr so belastbar. Wenn ich nur daran denke, was ich heute noch vorhabe, beginnt mir mein Herz gleich unangenehm bis zum Hals zu klopfen. Kein Hauch vorausgreifender Freude. Nur sachliches Abwägen, den Übergriff makellos zu gestalten.
Große Pläne und dabei aus dem letzten Loch pfeifen. Willkommen in der verfickten zweiten Lebenshälfte.
Mit meiner besten Geduldssimulationsstimme erläutere ich Herrn Korbmeyer also auch noch jenen ihm unklaren Passus, wobei er verständig nickt, als hätte er jetzt nicht nur endgültig alles kapiert, sondern mit lupengenauem Scharfsinn und bewunderungswürdiger Skepsis auch die allerletzte Ungereimtheit im Dienste seiner Familie ausgeräumt.
Da täuscht er sich natürlich.
Den entscheidenden Aspekt bemerkt er nämlich erst gar nicht.
Dieses Schenkungskonstrukt wird den Beteiligten derart um die Ohren fliegen, dass es nur so kracht. Spätestens sobald der Senior samt Frau gestorben ist, werden sich seine missratenen Kinder bis aufs Blut ums Erbe und im Zuge dessen vor allem um die Wohnung streiten. Einer wird den anderen ausbezahlen müssen. Und das ist meistens schwer konfliktbehaftet.
Spätestens dann sehen wir uns wieder.
Die beiden baldigen Eigentümer, Sohn und Tochter, lugen übrigens die ganze Zeit auf ihre Smartphones. Ziehen Grimassen. Lippen stülpen, Wangen einsaugen, yeah. Dauert ihnen wohl schon zu lang, ihre Sechshunderttausend-Euro-Überschreibung. Oder sie posten unser Meeting live im Netz.
Die Unterschriftensetzung erfolgt zehn Minuten später. Mit Datum vom 12. Juni 2019.
Alle sind happy.
Herr Korbmeyer greift zur Belohnung nach einem Keks.
Seine Frau tätschelt sein und ihr eigenes Knie.
Das wird was werden. Wartet nur.
Intelligenz bedeutet in erster Linie Weitsicht.
* * *
Max ist ratlos vor Wut, erschöpft vom Schock. Gerade hatte er das übermannende Gefühl, als würde ihm eine zurückflutende Riesenwelle den Sand unter den Füßen wegschwemmen. Game over. Der Algorithmus war stärker, Max chancenlos, das System hat gewonnen.
Wie einer, der zu früh aus dem Bett steigt, rafft er sich aus seinem Racersessel auf. Computer runterfahren, Yes drücken. Seine Mutter hat ihn schon vor zehn Minuten gerufen, aber schneller gehts nun mal nicht. Er musste sich noch eben erholen. Um fünfundzwanzigtausend Punkte verbessert gegenüber gestern, und dann alles verloren. Kommt vor.
Max hat heute achteinhalb Stunden God of War gespielt. Seine Selbstkontroll-App hätte sowieso gleich Alarm geschlagen. Sie soll den Konsumumfang einschränken helfen. Von Dad aufgezwungen. Nützt: null. Sie erstellt eine Tagesstatistik, anhand derer sich das eigene Onlineverhalten ablesen lässt, was okay ist. Es gibt sogar virtuelle Belohnungen, wenn man es schafft, eine halbstündige Bildschirmpause einzulegen. Man könnte auch für bestimmte Zeitfenster alle seine Digitalgeräte deaktivieren lassen – unter anderem vom Kultusministerium empfohlen –, aber das kommt nicht infrage. Drehn jetzt alle durch?
Kann schon sein, dass Dad recht hat, wenn er meint, Max sei irgendwie abhängig. Das Telefonat mit seinem Vater heute Vormittag war trotzdem mal wieder überflüssig. Alle Jungs in seinem Freundeskreis zocken, oft den ganzen Tag. Das ist normal mit sechzehn. Ich werde nicht durchfallen, werde die Kurve schon noch kriegen, denkt sich Max, während er ein frisches T-Shirt überzieht. Ohne Abi wäre assi.
Max auf eine Privatschule zu schicken, damit ihm dort ein wenig unter die Arme gegriffen wird, steht außer Diskussion. Sein Vater hält die Mitschüler dort für schlechten Umgang. Dad verachtet Bonzenkinder.
Genauso wie Armenkinder.
»Jaha, komme!«, ruft Max seiner Mutter zum x-ten Mal zurück und galoppiert benommen aus seinem Zimmer, die breite Treppe hinunter, durch die Diele in die weitläufige Küche.
»Da bist du ja endlich«, sagt seine Mutter wolkig. Nach ihren Psychotherapiestunden ist sie immer milde gestimmt. Davor war sie im Kundaliniyoga. Gerade hat sie ein Blech Blaubeermuffins gebacken, das sie aus dem Ofen zieht. Ganz die gute Hausfrau, die sie nicht ist.
»Sorry. Hatte noch zu tun. Hat sich die Alte gemeldet?« Max nimmt sich ein Red Bull aus dem Kühlschrank, sein viertes heute. Er lehnt sich mit dem Hintern an die Kante der Kücheninsel und setzt die Dose an den Mund.
Mit der Alten meint er die Sekretärin seines Vaters. Sie bringt eine Menge Unruhe rein. Aber so sehr Max dadurch auch zwischen den Fronten steht – zwischen seiner unnahbaren Mutter und seinem staubtrockenen Vater, ihrer verkorksten Beziehung – und so wenig er gutheißen würde, wenn sich seine Eltern trennten: Falls stimmt, was die Rütting-Illinger über Dad mutmaßt, wäre das ein Zustand der Ungewissheit, den er seiner Mutter nicht zu ertragen zumuten kann. Es muss Klarheit her.
»Allerdings«, sagt Maximilians Mutter, greift mit der Küchenzange nach einem Aufbackmuffin und bugsiert ihn auf einen Teller. »Frau Rütting«, sie benutzt immer nur ihren ersten Namen, »hat vorhin angerufen. Sie glaubt mitbekommen zu haben, dass dein Vater sich heute wieder mit einer Frau verabredet haben könnte.«
Mum schneidet den Muffin entzwei, prüft, ob er richtig durch ist, und führt die eine Hälfte mit spitzen Fingern zum Mund. Max kommt es vor, als spiele seine Mutter gerade die Coole, mit diesem Nebenbeigetue und der gestelzten Ausdrucksweise. Die Rütting »glaubt mitbekommen zu haben«, dass sein Vater sich wieder mit irgendeiner Frau »verabredet haben könnte«. So redet Mum sonst nie. Es klingt wie ein Gegenpegeln zermürbender Anspannung.
Vor ein paar Monaten hatte die Rütting-Illinger seine Mutter aus heiterem Himmel zum ersten Mal angerufen, Max war mit ihr im Auto unterwegs gewesen und wurde Zeuge des Gesprächs.
Wohl aus weiblichem Solidarisierungsbedürfnis heraus berichtete die Rütting, wie sich in letzter Zeit Hinweise gehäuft hätten, dass Dad sich außerehelich betätigt. Und sie fühle sich verpflichtet, diese Verdachtsmomente seiner Mutter mitzuteilen, blabla. Als Loyalität getarnte Aufhetzerei halt.
Max’ Mutter kaut und holt dabei durch den Mund stoßweise Luft, der Fertigmuffin ist heiß. Sie runzelt die Stirn, befindet ihn für gut und serviert Max das erste abgesegnete Stück im weißen Papierbackförmchen.
Eine Weile liegt es einfach nur da, auf dem Teller, der Teller in Max’ Hand.
Mutter, Sohn. Beide schweigen.
Durch die bodentiefen Fenster sieht man in den Garten, und über dem Garten zieht ein Flugzeug einen Kondensstreifen hinter sich her. So hoch am Himmel, dass man den Lärm nur erahnen kann.
»Probier doch mal«, sagt seine Mutter, im Sinne von: »Aber dann fahr endlich los und mach, was wir besprochen haben.«
Max überlegt, den Blick ins Leere. Jetzt gilts also. Es fühlt sich absurd an. Ein moralisches Dilemma.
Max nimmt den Muffin, seine Finger sind kalt und feucht, weil er die ganze Zeit das Red Bull gehalten hat. Er führt das runde Küchlein zum Mund und trifft gleich mit dem ersten Biss eine heiße Blaubeere, die ihm im Mund platzt.
»Sollen wir’s echt durchziehen?«, fragt Max mampfend und plakativ nach kühlender Luft saugend. Nun ist er es, der den Beiläufigen mimt.
Seine Mutter nickt entschlossen. Falls in ihrem Blick eine Spur von Zweifel mitschwingt, verbirgt sie sie gut.
»Mach’s Max, sonst ... jetzt können wir es einfach nicht mehr nicht machen. Sonst dreh ich noch durch.« Das ist sie längst. »So gegen sechs soll sich dein Vater mit der Frau treffen. Wenn du jetzt losfährst ...«
Max isst den Muffin nicht mehr zu Ende, greift noch mal zur Dose, nimmt einen großen Schluck und wappnet sich innerlich für die bevorstehende Mission. In dem Moment, in dem er die Dose zerdrückt, kommt Mephisto zur Katzenklappe hereingerollt und trippelt auf die Beine seiner Mutter zu, um sie drängelnd zu umschmiegen. Die übliche schamlose Choreografie zur Essenszeit. Der Typ ist pünktlich auf die Sekunde, denkt sich Max jedes Mal aufs Neue, keine Atomuhr könnte exakter sein.
Der Kater ist riesig und dermaßen dick, dass er aussieht wie ein Medizinball in einem orangen Pelzmantel. Dad hat ihn vor Ewigkeiten aus dem Tierheim geholt und ist so vernarrt in ihn, dass er ihm oft Fisch und Fleisch aus der Kaufhof-Feinkostabteilung mitbringt. Allerdings schmeckt Mephisto das Billigfutter vom Discounter deutlich besser.