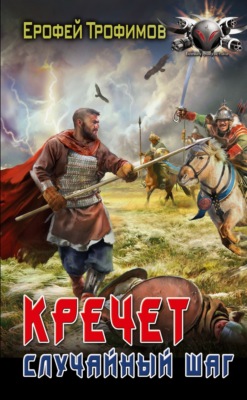Buch lesen: "Besondere Zeiten"
Impressum
© 2021 Baltrum Verlag GbR
BV 2134 - Besondere Zeiten - Facetten von Dunkel Band 2
Umschlaggestaltung: Baltrum Verlag GbR
Cover: Nicole Kunkel
Illustration Rückseite: Katrin Schieber
Lektorat, Korrektorat: Baltrum Verlag GbR
Herausgeber: Baltrum Verlag GbR
Verlag: Baltrum Verlag GbR, Weststraße 5, 67454 Haßloch
Internet: www.baltrum-verlag.de
E-Mail an info@baltrum-verlag.de
Druck: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Die Texte ›Das Mädchen und der liebe Gott‹, der ›Terrorist‹ und ›Erwachen‹ mit freundlicher Genehmigung des ›verlag-roloff.de‹.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besondere Zeiten
Facetten von Dunkel Band 2
Herausgeber
Carsten Böhn und Matthias Deigner
Buchbeschreibung:
Mit 'Besondere Zeiten' liegt nach 'Facetten von Dunkel' der abschließende Band unserer Ausschreibung 'Dunkel' vor. Er überrascht erneut mit einer Vielzahl von Sichten, um dieses spannende Thema mit den Abgründen und Schatten der menschlichen Seele umzugehen.
Die Autor*innen:
Mica Bara, Marlies Blauth, Sandra Brückner, Gislinde Bock , Chris Bucher, Katja Decher, Katrin Exner, Tülin Emircan, Dieter Geißler, Klaus Grobholz, Viven Hagedorn, Lena Hoffmann, Inés Maria Jiménez, Eva Joan, Inga Kess, Nicole Kunkel, Tina Lauer, Sissy Leger-Lohr, Stephanie Matthias, Megan E. Moll, Marcus Netscher, Patricia Pinto Plaza, Edwin Radnitzky, Martina Raguse, Ann Katharina Re., Sabine Riedel, Heike Roloff, Béatrice Sassi, Laura Seidl, Birgit Sonnberger, Gianna Schläpfer, Lena Schraml, Sylvia Schütter, Angela Schwarz, Nikolaus Schwarz, Viktoria Steck, Eva Unterhuber, Cornelia Wagner, Michelle Walther, Ziwei Wang, Clara Wolf
Besondere Zeiten
Facetten von Dunkel - Band 2
Herausgeber
Carsten Böhn und Matthias Deigner
Baltrum Verlag
Weststraße 5
67454 Haßloch
Der Versuch eines Vorwortes und ein Danke
Mit dem Band ‘Besondere Zeiten’ halten Sie nach ‘Facetten von Dunkel’ den zweiten und damit abschließenden Band aus unserer Ausschreibung ‘Dunkel’ in den Händen. Nach mehr als 2.500 Einreichungen zu dieser Ausschreibung möchten wir uns bei allen Autor*innen bedanken, die zum Teil über ihren Schatten gesprungen sind und uns wahrlich an unsere Grenzen gebracht haben. Wir wollten dieses Buch schon Ende April 2021 veröffentlichen, dadurch dass wir aber alle Texte gelesen und bewertet haben, uns die Auswahl und auch die Absagen der Texte wirklich nicht leicht fiel, hat sich alles berechtigterweise ein wenig verzögert und unsere komplette Planung für das Restjahr über den Haufen geworfen.
Sie halten ein Buch in den Händen, deren Auswahl an Texten sich am ehesten mit dem Inhalt einer Pralinenschachtel vergleichen lässt. Jeder Text ist ein Genuss und eine Überraschung, meistens, aber auch nicht immer jedermanns Geschmack. Das ist die Würze einer Anthologie und wir sind Stolz auf unsere Autoren*innen und auf dieses Buch. Nochmals einen großen Dank an alle Teilnehmer*innen dieser Ausschreibung.
Haßloch, im Dezember 2021
Besondere Zeiten
Sissy Leger-Lohr
Als wäre es heute gewesen, so erschien es Sonja in ihren Erinnerungen. Und immer wieder suchten Alpträume sie heim. Dann erlebte sie erneut diesen nebligen Tag, an dem sich die Sonne standhaft, aber vergeblich bemühte, ein wenig Licht und Wärme hineinzubringen.
Sie spürte den Aufprall, als der Wagen sie traf, den Schmerz, der wie eine lodernde Flamme durch ihren Körper zuckte, spürte, wie sie hochgewirbelt wurde, wie ihr eigener Schrei ihr in den Ohren gellte. Dann gab es nur noch Schwärze.
Seither teilte sich ihre Welt in die Zeit vor und die Zeit nach dem Unfall.
*
Vorher hatte sie ein Leben und Freunde, nahm in der Bank rasant Stufe um Stufe der Karriereleiter, unaufhaltsam, so schien es ihr damals.
Die Zeit nach dem Unfall bestand aus Qualen und Schmerzen. Die Ärzte wurden nicht müde, ihr zu sagen, welch sagenhaftes Glück sie gehabt hätte. Doch Sonja empfand es nicht als Glück. Sie, früher stets gesund und fit, war nun ohne eigenes Verschulden auf den Rollstuhl angewiesen. Es gab beinahe keinen Knochen in ihrem Körper, der nicht mehrfach gebrochen war. Als sich ihre Lunge erholt hatte und sie aus dem künstlichen Koma geholt wurde, standen mehrere Operationen an. Sie bemühte sich eisern, sich ihre Körperfunktionen zurückzuerobern, Stück für Stück. Jedoch, es blieb ein Puzzle. Wenn sie an einer Stelle den Durchbruch geschafft hatte, musste sie an einer anderen weitermachen. Es war mühsam, sich Schritt für Schritt ins Leben zurückzukämpfen, und oft fragte sie sich, ob sie es schaffen würde. Wie lange ihre Kraft, ihre Energie noch reichten.
Dann starrte sie stundenlang auf die Fotos an den Wänden ihrer Wohnung und in ihrem Fotoalbum. Die Bilder zeigten sie, wie sie als Tänzerin der Faschingsgesellschaft durch die Luft gewirbelt wurde. Sie im Spagat. Beim Tauchen. Wie sie, einer Spinne ähnlich, an einer Felswand hing gemäß dem alten Kletterer-Spruch: »Wenn du nicht mehr weiter weißt, spreizen, bis die Hose reißt.«
In diesen Momenten fragte sie sich, ob sie je etwas davon nochmals erleben würde. Ob sich die Mühe lohnte. Wünschte sich ihr Ende herbei. Ruhe. Keine Schmerzen mehr. Ihre Eltern brauchten sich keine Sorgen mehr zu machen. Sie würde ihnen nicht mehr zur Last fallen.
Ihre Gedanken entwickelten ein Eigenleben. Sonja wusste genau, wie sie es anstellen musste. Tabletten hatte sie genug. Nur ein paar zu viel von diesen Gelben hier, und es wäre überstanden. Manchmal schüttete sie sie aus dem Röhrchen, hielt sie in der Hand und kämpfte dagegen an, sie zum Mund zu führen. Bisher hatte der Gedanke, dass es schiefgehen könnte und sie erneut von vorn anfangen müsste, sie davon abgehalten.
Die meisten ihrer Freunde machten sich inzwischen rar. Sonja wagte nicht zu jammern, weil sowieso alle auf Durchzug stellten. Die einen zuckten hilflos die Schultern, andere beschieden ihr, sie müsse eben ihren Zustand akzeptieren und sich damit abfinden. Das kam jedoch für Sonja nicht in Frage. Verbissen übte sie weiter, weil nur die vage Hoffnung sie aufrecht hielt, eines fernen Tages wenigstens ohne ständige Schmerzen zu leben.
In ihrem Alltag spielte die Physiotherapie die Hauptrolle. Viermal die Woche und auch zu Hause trainierte Sonja ihre Arme, um den Rollstuhl bewegen zu können, die Rücken- und Bauchmuskeln gegen die Schmerzen, machte Übungen, um ihre Beine wieder zu spüren und die Füße zu belasten.
Nach dem anstrengenden Training mit ihren Kräften am Ende, brachte Sonja kaum einmal die Energie auf, mit den Freunden auszugehen. Geselligkeiten ging sie jetzt meistens aus dem Weg. Es tat weh, die lauten, fröhlichen Menschen zu beobachten, die sorglos und unbekümmert feierten. Sie, früher so oft Mittelpunkt, fühlte sich neuerdings in Gesellschaft von Menschen einsam. Einsamer als allein. Sie hörte die Stimmen und das Lachen und spürte, dass sie nicht dazugehörte. Nicht mehr. Ihre Probleme waren andere. Sie fühlte sich ausgeschlossen. Ausgestoßen. Eine dunkle Wolke von Traurigkeit schien sich über ihr Leben gebreitet zu haben.
Mike, ihr Physiotherapeut, ermutigte und bestärkte sie, wenn der Kampfgeist sie verlassen wollte. »Hab’ Geduld«, mahnte er. »Das Leben ist etwas völlig anderes als ein Urlaub. Bei der Lebensreise kommt es nicht darauf an, möglichst schnell am Hotel, am Pool oder am Meer anzukommen, um zu entspannen. Hier ist die Reise das Ziel. Da geht es darum, möglichst viele ausgefüllte und spannende Tage zu erleben. Jeden Tag als ein Ziel für sich zu sehen.«
»Ach ja«, höhnte sie, »und kannst du mir vielleicht auch verraten, wie ich das anstellen soll, Mr. Oberschlau?«
Mike ging nicht auf die Provokation ein. »Du solltest eine weitere REHA machen. Dort wirst du genau das lernen. Die kümmern sich da auch um deine Psyche.«
Sonja hangelte sich gerade mit zusammengebissenen Zähnen das vierte Mal am Barren entlang und versuchte, ihre Beine einzusetzen. Das gelang ihr eher mäßig. Ihr Atem ging stoßweise. Trotzdem quetschte sie hervor: »Spinnst du? Mein Kopf ist das Einzige, was bisher reibungslos funktioniert. Ich bin doch nicht verrückt! Meinst du, ich habe nicht genug eigene Probleme? Da muss ich mir nicht vier Wochen die Gesellschaft von menschlichen Wracks wie mir antun, die sich gegenseitig die Tiefs ihres Lebens erzählen.« Ausgepumpt ließ sie sich auf die Matte plumpsen. Sie fühlte sich, als wäre sie mit Anlauf gegen eine Wand gelaufen.
»Ich habe es nicht so gemeint, das weißt du«, begütigte Mike. »Gegen deine Depressionen musst du dringend was unternehmen.«
»Das haben die doch hier auch schon versucht und es nicht hingekriegt.«
Mike schwieg.
»Ich habe wirklich genügend gute Gründe, deprimiert zu sein«, sagte sie eingeschnappt. »Die kann niemand wegzaubern. Deshalb werde ich eben öfter mal deprimiert sein. Warum kann das bloß keiner akzeptieren?«
»Depressionen sind gefährlich. Nimm das nicht auf die leichte Schulter.« Mike sah sie auffordernd an. »Bereit? – Los, noch eine Runde.«
Er half ihr auf und legte ihre Hände auf die beiden Seiten des Barrens.
Nach der Hälfte ächzte sie: »Mike, ich kann nicht mehr. Hilf mir!«
Er trat an ihre Seite. »Doch, du kannst. Du schaffst es. Nur noch drei Mal umgreifen.«
»Nein, Mike. Ich kann nicht. Wirklich!«
»Du strengst dich nicht genug an. Du musst an deine Grenzen gehen und darüber hinaus. Jeden Tag. Wieder und wieder. Dabei ist dir dein Selbstmitleid im Weg.«
Das nannte man wohl »jemandem die Luft rauslassen!« »Ach, und was meinst du, was ich hier tue?«
Sonja ließ sich fallen, robbte zu ihrem Rollstuhl, hievte sich unter Aufbietung aller Kräfte und unter Zurücklassung ihrer Selbstachtung hinein und rollte weg. Was bildete sich dieser Neandertaler ein! Nicht genug anstrengen! Wie kam er bloß darauf?
Sonja fuhr im Aufzug ins Erdgeschoss und schnurstracks Richtung Ausgang.
Draußen schüttete es, als wollte die Welt untergehen. Sogar unter den überdachten Gang, den Sonja jetzt entlang rollte, trieb es den Regen. Sie zögerte kurz, dann trat sie den Rückzug an und gesellte sich zu denen, die am Eingang darauf warteten, dass der Regen ein wenig nachließ. Eine Frau mit langen, braunen Haaren und ausgezehrtem Gesicht fiel ihr auf, deren Augen tief in den Höhlen lagen. Sonja kannte sie flüchtig vom Sehen. Ab und zu saß sie im Wartezimmer der Physiotherapie, wenn Sonja herauskam.
Sonja musste sie wohl angestarrt haben, denn die Frau lächelte sie unbefangen an und streckte ihr die Hand entgegen. »Hallo, wir kennen uns von der Physiotherapie. Ich bin Bianca.«
Sonja ergriff die dargebotene Hand. »Ich bin Sonja.«
»Ich habe nicht immer so ausgesehen«, sagte Bianca. »Das macht der Krebs. Blasen-Karzinom. Sehr aggressiv. Tödlich aggressiv.«
Sonja starrte sie entsetzt an. Wie alt mochte sie sein? Anfang, vielleicht Ende dreißig. Ihre ausgemergelten Züge machten es schwer, sie zu schätzen. »Tödlich?«, ächzte Sonja, betroffen von der Unverblümtheit der anderen. »Heißt das …«
»Jep. Die Ärzte geben mir noch ein Jahr. Zwei vielleicht, wenn ich Glück habe.«
Als sie Sonjas Blick sah, fügte sie schnell hinzu: »Es ist in Ordnung. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Es ist nur ... es ist so früh.«
Sonja schwieg bestürzt. Bianca fuhr schließlich fort: »Noch habe ich ja einige Tage vor mir. Und ich werde jeden einzelnen davon nutzen. Ich verschwende keine Zeit.«
»Das habe ich gemerkt!« Diese brutale, unerwartete Offenheit, und das von einer Wildfremden! Sonja fühlte sich wie paralysiert.
»Ja, jeder Tag ist ein neues Ziel. Im Leben wechseln sich Sonne und Regen ab.« Bianca deutete nach draußen. »Schauen Sie, der Regen hört auf.«
Sie zwinkerte Sonja zu. »Manchmal gibt es nach dem Regen wunderschöne Regenbogen.«
Sonja folgte Biancas Handbewegung, und beide betrachteten fasziniert den gigantischen Regenbogen, der sich in der Ferne über der Stadt wölbte.
Schlagartig wurde Sonja bewusst, wie viel Sehnsucht nach Leben in ihr war. Ja, sie hatte Schmerzen. Aber sie lebte! Sie machte Fortschritte. Sie würde sich noch mehr anstrengen! Möglicherweise tatsächlich eine REHA machen. Und zur Not gab es ja den Rollstuhl.
Sie würde dafür sorgen, dass sie bald viele neue Bilder aufhängen konnte.
»Ich fahre zurück zur Physio«, murmelte sie beschämt nach einem Blick auf die Uhr. »Ich habe noch eine Viertelstunde. Aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, könnten wir zusammen etwas trinken gehen – wenn Sie wollen?«
»Gerne!« Bianca strahlte. »Ich freue mich darauf.«
Als Sonja ihren Rollstuhl wendete, regnete es noch immer leicht. Doch in den Ecken ihrer Mundwinkel nistete ein Lächeln, denn da war das Wissen um den Regenbogen.
Erwachen
Heike Roloff
Herr Johanson öffnete die Augen. Wie an jedem Morgen in den letzten Jahren spürte er das Unglück. Es war noch vor ihm erwacht und trommelte seit einer halben Stunde schmerzhaft gegen seine Brust. Von innen.
Herr Johanson hatte viel über dieses Unglück nachgedacht.
Es schien ihm aus einer unerschöpflichen Quelle des Begehrens zuzufließen, auf deren Grund das Nichtverwirklichte seines Lebens in jedem Moment Wünsche formte.
An diesem besonderen Morgen sollte sich Herr Johanson das erste Mal die Frage stellen, ob es nicht doch an der Zeit sei, alles zu verändern. Er dachte an eine kleine Drei-Zimmer-Küche-Diele-Bad-Wohnung mit Gäste-WC, Letzteres aus beruflichen Gründen. Er dachte an eine andere Frau in einer anderen Stadt. An eine größere andere neue frische Liebe. Kurz dachte Herr Johanson an einen anderen Herrn Johanson, einen schlanken, inspirierten, sexy Mann.
Dann stellte sich Herr Johanson vor, wie er seiner Frau beim Frühstück mitteilen würde, dass er gedenke, sich eine eigene 3 ZKDB-Wohnung zu nehmen. Mit Gäste-WC.
Er sah, wie in den ohnehin traurigen Augen seiner Frau jeder Sinn, den ihr Leben noch hatte, erlosch, und wie die Kraft, die noch da war, aus ihrem Körper floss. Er konnte sie als alte Frau mit der Einkaufstasche in der Hand sehen, wie sie allein durch die Straßen der Stadt ging, in der sie beide seit vielen Jahren lebten.
Ganz kurz überlegte Herr Johanson, ob er sich nicht etwas vormachte, ob nicht – ganz im Gegenteil – seine Frau aufblühen würde, wenn er gegangen sein würde, ob sie nicht in kürzester Zeit eine neue Liebe finden und der traurige Ausdruck ihrer Augen in einen Ausdruck von Befreiung und Glück verwandelt würde. Er wusste es nicht. Konnte die eine Vorstellung genau so wenig ertragen wie die andere.
An dieser Stelle fragte sich Herr Johanson, ob es wohl Liebe sei, dass er bei der Vorstellung, seine Frau zu verlassen, Schmerz empfand. Seit längerer Zeit schon war er auf der Suche nach seiner Liebe, die ihm verloren gegangen zu sein schien in der Zeit.
Je länger er allerdings suchte, desto mehr entzog sich ihm alles, was er jemals über Liebe gedacht, und alles, was er dafür gehalten hatte. Dafür fand er diesen Schmerz und einiges andere, durchaus von Wert, zweifelsfrei.
So fand er, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, Verlässlichkeit – seine eigene, ihre auch – und Vertrautheit. Er kannte seine Frau gut; ihre Art zu denken, ihr Lachen an den guten Tagen, das Besondere eben, das sie ausmachte.
Er wusste um den Schmerz in ihren gerundeten Schultern, die diese Form durch das Tragen und Nähren der gemeinsamen Söhne angenommen hatten.
Er kannte die Narben und Furchen, die das Leben in ihren Körper geschlagen hatte, und all dies schuf eine tiefe Bindung. Gleichzeitig stieß es ihn ab als klare Spiegelung seines eigenen Alterns.
Etwas war vorbei und doch fühlte er sich nicht frei. Unfähig zu gehen, verharrte er an dem Platz, an den ihn das Leben vor so vielen Jahren gestellt hatte, versorgte und behütete, was er sich einst vertraut gemacht hatte, und weinte in dem inneren Raum, der nur ihm gehörte.
Bei diesem Gedanken hielt Herr Johanson inne.
Entdeckte im gleichen Moment, dass es diesen Raum so nie gegeben hatte und nie geben würde. Es war etwas Ungetrenntes zwischen ihm und seiner Frau. Auch zwischen ihm und den Kindern, das konnte er spüren, und diese Erkenntnis versetzte ihn in großes Erstaunen. Es gab keine Trennung, und so musste sein Schmerz auch ihr Schmerz sein.
Herr Johanson lauschte in den neu gefundenen offenen Raum und hörte mit einem Mal das unermessliche Weinen der Anderen. Lautes und leise wimmerndes, verzweifeltes und schmerzerfülltes Weinen. Mitfühlend hörte er zu und verspürte nur noch den einen Wunsch, dass sich dieses Leid auflösen und in Glück verwandeln möge.
Das erste Mal in seinem Leben fühlte sich Herr Johanson eingebunden und als Teil einer Ganzheit. Vergleichbar vielleicht einem einzelnen Faden in einem großen vielfarbigen Teppich, der von schöpferischen Kräften weise geknüpft wurde; Tag für Tag, Jahr für Jahr. Im Strom der Zeit wurde sein Schicksal verbunden mit dem vieler anderer, nach einem Muster, das er von dem Punkt aus, an dem er gerade stand, nicht zu erkennen vermochte.
Erst beim Blick zurück konnte er sehen, dass es gut gewesen war, denn in diesem Moment des Schauens war sein Denken und Fühlen frei von Zorn oder Vorwurf.
Machtvoll fühlte Herr Johanson den alles verbindenden Strom, der sein Handeln lenkte, und er überließ sich dieser Kraft erstmals ohne Gegenwehr. Wurde selbst zum Strom.
Vollkommen befreit von Unglück und Leid schlug er die Bettdecke zurück und stand leise auf. Er würde nun mit dem Hund gehen, während seine Frau wie immer das gemeinsame Frühstück zubereitete. Alles und nichts hatte sich verändert, und es war gut so, wie es war.
Noch 36 Minuten
Tina Lauer
»Die Musik steckt nicht in den Noten. Sondern in der Stille dazwischen.«
Wolfgang Amadeus Mozart
Alles ist schwarz. Fast schwarz. Schemenhaft zeichnen sich Lichtquellen ab. Pulsierende Stempel gewonnener Eindrücke. Ihre Lungenflügel füllen sich mit Luft. In das schwarze Pulsieren mischen sich tobende Gedanken. Sie kreisen um das, was sein wird; um das, was sein könnte; um das, was nicht sein darf. Langsam entweicht die Luft aus ihr. Gedanken wegblasen. Bis nichts mehr da ist. Nur noch ein weißes Blatt, nur noch reine Konzentration.
Sophie atmet noch ein paar Mal tief ein und wieder aus. Nur um sicherzugehen, dass nichts mehr da ist. Nicht mehr, was sie aufhalten könnte. Dann öffnet sie ihre Augen und blickt auf die graue Betonwand. Sie legt die Finger der rechten Hand an ihre Halsschlagader. Ruhige, gleichmäßige Schläge. 65 pro Minute. Metronomisch genau. Sophie genießt es, wenn ihr Körper funktioniert. Wenn er eins ist mit ihrem Willen. Mit der linken Hand klopft sie doppelt so schnell auf ihren Oberschenkel. Noch 36 Minuten.
Sie greift nach dem Meisterinstrument, das sie von ihrem Großvater geerbt hat. Er wäre so stolz, wenn er sie jetzt sehen könnte. Würde vor ihr sitzen, sie anlächeln und den ersten Ton herbeisehnen.
Mit einer flinken Handbewegung legt Sophie das weiße Baumwolltuch auf ihre Schulter und den Kinnhalter, setzt die Geige an, legt das Kinn darauf. Die rechte Hand greift nach dem Bogen. Wolfgang Amadeus Mozart, Violinkonzert Nr. 3 in G-Dur, Köchelverzeichnis 216. Die feinen Rosshaare ihres Bogens versetzen die Saiten in Schwingung. Die ersten Töne erklingen. Kein Stück hat sie öfter gespielt. Ihr Körper wird von einer Welle Endorphine geflutet. Sie steigern ihre Konzentration. Jeder Ton, jedes Crescendo, jedes Ritardando ist in ihr. Sie hört es, spürt es, weiß es: Noch nie war sie so gut. Noch nie so bereit. Der fensterlose Überraum füllt sich mit einer Klaviatur an Tönen. Noch einmal die Kadenz. Wenn nur nicht … Noch einmal der dritte Satz. Diese eine Passage, bei der sie jedes Mal besonders aufpassen muss. Doch nicht der Hauch einer Unsicherheit.
Dann, endlich, huscht ein zufriedenes Lächeln über ihr Gesicht. Es ist genug.
Die letzten Töne verhallen in den dunklen Ecken des winzigen Raumes. Behutsam bettet sie das Instrument zurück in den Geigenkasten, spannt den Bogen ab und legt ihn ebenfalls an seinen gewohnten Platz. Noch 23 Minuten.
Alles in ihr ist bereit. Sie fühlt sich gut, konzentriert, gefasst. Nichts wird sie aufhalten können. Fast nichts … Sie hat sie gehört – ihre Mitstreiter, ihre Konkurrenz – vorhin, als sie an den Räumen vorbeiging. Gute Musizierende, keine Frage. Aber so gut wie sie? Nein, ganz bestimmt nicht. Sie weiß, dass sie die Beste ist – die Beste sein kann. Sie muss es nur im richtigen Moment abrufen. Nein, da ist niemand, der sie aufhalten wird. Niemand! Aber vielleicht ... etwas ... Noch 21 Minuten.
Sophie läuft zum Spiegel. Atmet noch einmal tief ein und aus. Ihre dunkelblonden Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Das ärmelfreie Kleid lässt ihr genug Platz, um die Arme frei zu bewegen. Den fliederfarbenen Stoff hat sie extra danach ausgesucht, unangenehmen Schweißflecken vorzubeugen. Die Schuhe sind elegant, aber mit niedrigen Absätzen. Sie wird sorglos auf die Bühne treten und die Aufnahmeprüfung meistern. Sophie ist zufrieden mit dem, was sie sieht. Nur ein paar letzte Korrekturen. Sie greift nach dem schwarzen Kajal und setzt an, den Lidstrich nachzuziehen. Dann hält sie inne. Eine dicke Fliege hat sich auf ihr Spiegelbild gesetzt. Genau dorthin, wo ihre Nase reflektiert wird. Sophie schluckt. Sie starrt auf die Fliege, die bewegungslos verharrt. Ihr ist, als würde sie Sophie anblicken. Ist es nur eine Fliege, oder ist es mehr? Ihr ist, als blicke die Fliege sie direkt an. War da ein Flackern? Je näher sie der Fliege kommt, desto größer wird das Insekt. Sophie will es wissen, muss es wissen. Ist da mehr? Noch 17 Minuten.
Die Fliege wächst ... verformt sich. Angst steigt in Sophie auf. Sie spürt es. Sieht es. Nein, nicht jetzt … Bitte nicht jetzt … Es darf nicht sein. Sie versucht, die Angst wegzuatmen. Ich bilde mir das nur ein. Da ist nichts. Nicht hier, nicht jetzt. Langsam ein, noch langsamer wieder aus. War der Raum schon vorher so erdrückend? Wie kann man hier überhaupt atmen? Das Insekt ist mittlerweile so groß wie eine Hummel. Mit schweren Flügelschlägen bewegt es sich in eine Ecke des Zimmers. Sophie weiß, dass ihr keine Zeit bleibt. Hektisch kramt sie in ihrem Schminktäschchen nach der weißen Dose mit dem roten Deckel. Die hummelgroße schwarze Fliege nimmt menschliche Züge an. Schon ist sie so groß wie eine Hand. Sie wächst zusammen mit Sophies Angst. Natürlich war sie schon vorher da, schon länger. Sophie hat sie gespürt, es gewusst. Wo ist diese verdammte Dose? Zitternd dreht sie ihre Tasche auf den Kopf, deren Inhalt sich polternd auf dem gefliesten Fußboden verteilt. Sie wühlt zwischen benutzten Taschentüchern, angeknabberten Müsliriegeln, Tampons, Kugelschreibern, Handcreme, Schlüsselbund und Smartphone, doch von der ersehnten Dose keine Spur. Tränen steigen in ihr auf. An alles hat sie gedacht ... nur nicht daran. Noch 13 Minuten.
Eine menschengroße Gestalt kauert Sophie gegenüber. Sie hat ihre Augen, ihre Gesichtsform, ihren Körper. Ihr dunkles Abbild hockt auf den kalten Fliesen und blickt Sophie an. Aus den schwarzen Augen fließen Tränen. Sie formen einen Strom der Traurigkeit, der unaufhaltsam in Sophies Richtung fließt. Sophie will weg, weg von diesem Strom, weg von diesem Ort. Aber sie kann nicht. Ihr Körper sträubt sich gegen jede noch so winzige Bewegung. Wie gelähmt bleibt sie sitzen. Aus weiter Entfernung scheint ihre Geige nach ihr zu rufen. Doch sie hört sie kaum. Langsam verstreichen die Sekunden, ewig dauern die Minuten. 12, 11, 10, 9, ... und versickern doch wie Sand in ihren Händen. Der Strom ist fast bei ihr. Sophie weint stille Tränen. 8, 7, 6 Minuten, ... Dann erreicht er die Füße. Und während ihre Frist abläuft, versinkt Sophie erneut im Sumpf ihrer bipolaren Störung.