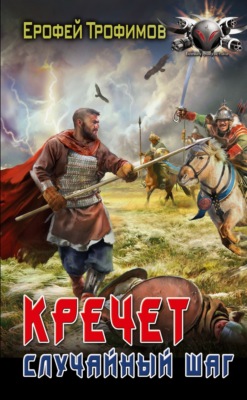Buch lesen: "Die Clique"
Mary McCarthy
DIE CLIQUE
Mit einem Vorwort von Candace Bushnell
Aus dem Amerikanischen von
Ursula von Zedlitz

Inhalt
VORWORT
ERSTES KAPITEL
ZWEITES KAPITEL
DRITTES KAPITEL
VIERTES KAPITEL
FÜNFTES KAPITEL
SECHSTES KAPITEL
SIEBTES KAPITEL
ACHTES KAPITEL
NEUNTES KAPITEL
ZEHNTES KAPITEL
ELFTES KAPITEL
ZWÖLFTES KAPITEL
DREIZEHNTES KAPITEL
VIERZEHNTES KAPITEL
FÜNFZEHNTES KAPITEL
Über den Autor
VORWORT
von Candace Bushnell
Ich war noch ein Teenager, als meine Mutter mir empfahl, Die Clique zu lesen. Sie wusste, dass ich Schriftstellerin werden wollte, und gab mir häufig Bücher von zeitgenössischen Autoren, wobei »zeitgenössisch« in diesem Fall heißt: Anfang 19. Jahrhundert bis etwa Mitte der Siebzigerjahre. Flannery O’Connor, Anaïs Nin, Edith Wharton, Ayn Rand. Und Mary McCarthy. Ich verschlang O’Connor, Nin, Wharton und Rand. Mit McCarthy tat ich mich schwer. Ihre Heldinnen überzeugten mich nicht, was keineswegs überrascht, wenn ich heute zurückschaue. Fast alle bedeutenden literarischen Werke erreichen Jugendliche nicht, weil diese nicht über die notwendige Lebenserfahrung verfügen, um die Enttäuschungen und Frustrationen der Erwachsenen nachempfinden zu können. Und so legte ich Die Clique beiseite. Es sollte 18 Jahre dauern, bis ich sie wieder hervorholte.
Für meine Mutter indes war Die Clique das prägende Buch ihrer Generation: Sie war Jahrgang 1930 und die Erste überhaupt in unserer Familie, die ein College besucht hatte – Mount Holyoke, eins der renommierten Seven Sisters Colleges, zu denen auch Vassar und Smith gehören. Die Clique erschien 1963 in den USA, mitten in einer Zeit tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels: John F. Kennedy war gerade ermordet worden, die Hippies predigten die freie Liebe, und der Vietnam Krieg tobte bereits seit vier Jahren. Der Mythos der friedlichen, familienorientierten Fünfzigerjahre, als die heitere Hausfrau mit Schürze und Stöckelschuhen ihren adretten Göttergatten noch mit einem Cocktail auf der Schwelle empfangen hatte, geriet zunehmend ins Wanken. Soeben war das Buch The Feminine Mystique (USA 1963, dt. Der Weiblichkeitswahn, 1966) von Betty Friedan erschienen, basierend auf der Auswertung eines Fragebogens, den Friedan auf der Feier zum 15-jährigen Examens-Jubiläum des Smith Colleges an zweihundert ihrer ehemaligen Studienkolleginnen verteilt hatte. Das Ergebnis bewies, dass viele Frauen unzufrieden waren mit ihrem Leben und den durch Ehe und Mutterschaft erheblich eingeschränkten Entfaltungsmöglichkeiten, was Friedan als »das Problem, das keinen Namen hat« bezeichnete. Der Zeitpunkt für die Publikation der Clique hätte perfekter nicht sein können: Wie die realen Frauen aus Friedans Buch litten auch die acht Heldinnen aus der Clique unter dem »Problem, das keinen Namen hat«. Die Frauen-Generation der Sechzigerjahre identifizierte sich mit ihnen und so konnte sich Die Clique zwei Jahre lang auf der Bestseller-Liste der New York Times behaupten.
Wenn ich heute zurückschaue, drängt sich mir die Frage auf, ob meine Mutter und ihre Freundinnen durch die Lektüre der Clique mit ihrer eigenen latenten Unzufriedenheit über ihr Hausfrauendasein konfrontiert wurden. Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass meine Mutter und ihre beste Freundin zwei Jahre nach Erscheinen des Buches ihre eigene Firma gründeten, sehr zum Unwillen ihrer Ehemänner. Auch wenn man einem solchen Schritt heute keine besondere Bedeutung mehr beimessen würde, in unserem Haushalt galt dies damals als regelrechte Revolution. Doch meine Mutter blieb unerbittlich, und genau zur selben Zeit, im Alter von acht Jahren, beschloss ich, Schriftstellerin zu werden.
Mitte der Neunzigerjahre, als ich die Sex and the City-Kolumnen für den New York Observer schrieb, brachte meine Agentin den Vertrag für meinen ersten Roman unter Dach und Fach. Als ich meiner ehemaligen Herausgeberin davon erzählte – eine der wenigen Frauen, die beim Observer gearbeitet hatten –, schlug sie spontan vor: »Du solltest die moderne Version von Die Clique schreiben!« Auf dem Heimweg kaufte ich mir eine Ausgabe des Buches und las es innerhalb von zwei Tagen nochmals durch. Das, was mit siebzehn keinerlei Sinn für mich gemacht hatte, kam jetzt, mit fünfunddreißig, einer erstaunlichen Offenbarung gleich. Hier fanden sich authentische, klar konturierte Charaktere, mit denen man sich identifizieren konnte: idealistische junge Frauen Anfang zwanzig, die mit den ungeahnten Nöten und Wonnen des »wahren Lebens« konfrontiert wurden. Auch wenn freilich jede Generation von Frauen für sich in Anspruch nimmt, vor völlig neuen Herausforderungen zu stehen, die sich aus ihrem Status als moderne Frauen in der Gesellschaft ergeben, so zeigt uns Die Clique doch, dass sich insgesamt nicht viel verändert hat: Sex vor der Ehe, unzuverlässige Männer, der Spagat zwischen Familie und Beruf – all diese Themen beschäftigten uns noch immer. Wenn man das Buch heute liest, könnte man sich tatsächlich fragen, ob nicht der größte Unterschied zwischen den Frauen von heute und den Frauen vor siebzig Jahren in dem Begriff »Wahlfreiheit« liegt – ein Begriff, der uns glauben macht, wir besäßen bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle über unser Leben, ja, wir hätten gar »das Problem, das keinen Namen hat« gelöst. McCarthys Protagonistinnen in der Clique haben diese Wahlfreiheit nicht.
Und so beginnt denn der Roman auch folgerichtig mit einer unheilvollen Hochzeit, auf der sich die unbeschwerten Kommilitoninnen der Braut voller Idealismus und Zuversicht tummeln, und kreist anschließend relativ rasch um gescheiterte Ambitionen, schlechten Sex (der Ehemann einer Heldin sagt regelmäßig das Einmaleins auf, um seinen Samenerguss zu verzögern), um die Anforderungen der Kindererziehung, den Ehrgeiz, mit den anderen mitzuhalten und nicht zuletzt um die Unzuverlässigkeit der Männer – so lässt sich etwa zu Beginn der Geschichte eine der Heldinnen ein Diaphragma anpassen, woraufhin sie von ihrem Liebhaber sitzen gelassen wird.
Geht man von der Aufmerksamkeit aus, die heutzutage den Geschlechterbeziehungen beigemessen wird, könnte man versucht sein, Die Clique als Wegbereiter der aktuellen chick lit, der anspruchslosen Frauen-Unterhaltungsliteratur, zu bezeichnen. Das trifft jedoch keineswegs zu. Obwohl McCarthys Frauen alles daran setzen, den richtigen Mann zu finden, ist dieses Thema doch eher ein Nebenschauplatz für einen weitaus bedeutenderen Konflikt. Als Absolventinnen des Vassar Colleges sind die Mitglieder der Clique nämlich davon überzeugt, dass sie die Welt verändern werden. Doch dann müssen sie nicht nur erkennen, dass sie die Welt nicht verändern können, sondern dass ihr Überleben vielmehr nach wie vor von der eigenen Akzeptanz abhängt, dem »anderen Geschlecht« anzugehören.
Als Feministin und hochpolitischer Mensch war McCarthy davon überzeugt, dass ein Roman keineswegs nur der bloßen Unterhaltung dienen sollte. In einem Beitrag, der 1981 in der New York Times erschien, schrieb McCarthy, dass sich der klassische Roman »infolge von Ideen und öffentlichen Debatten über gesellschaftspolitische Themen, Politik und Religion, über den Freihandel oder die Frauenfrage, die amerikanische Weltmachtstellung, politische und gesellschaftliche Reformen etc. entwickelt und an Bedeutung gewonnen hat. Ein seriöser Roman muss sich zwingend mit solchen aktuellen Fragen und ihrer Bedeutung in Hinblick auf Macht, Geld, Sex und Gesellschaft auseinandersetzen.«
McCarthys Entschlossenheit, das Leben so zu akzeptieren, wie es war, entgegen der Wunschvorstellung davon, wie es hätte sein sollen, ist zweifellos auf ihre eigene schwierige Kindheit und Jugend zurückzuführen. Nachdem beide Eltern 1918 einer verheerenden Grippeepidemie zum Opfer gefallen waren, blieb die erst Sechsjährige als Vollwaise zurück und wuchs bei streng katholischen Verwandten auf, wo sie mit harter Hand erzogen und missbraucht wurde. Ihre Unschuld verlor sie mit vierzehn und fortan stand fest, dass sie Ehe und Sex niemals als angenehm oder gar lustvoll empfinden würde. In ihrem Buch Intellectual Memoirs (USA 1992; dt.: Memoiren einer Intellektuellen, 1997) beschreibt sie ihren zweiten Ehemann, den Kritiker Edmund Wilson, als »keuchenden, fetten, alten Mann mit Mundgeruch.« Sie behauptet, ihn nie geliebt und in die Ehe nur eingewilligt zu haben »zur Strafe dafür, mit ihm ins Bett gegangen zu sein.«
Auch wenn sich der Groll aus diesen Zeilen nur unschwer herauslesen lässt, zeigen sie zugleich doch McCarthys Scharfsinn, Sarkasmus und tiefschwarzen Humor, welche sie glänzend einzusetzen verstand, um tiefe Verbitterung in Satire zu verwandeln. In Die Clique wird ein Mann beschrieben, der »durch und durch nichts taugte, aber das waren natürlich gerade die Männer, die anständigen Frauen das Herz brachen.« Später erkennt Priss, eine der Heldinnen, dass in ihrem Mann »etwas steckte, dem sie misstraute, und das sie sich nicht anders erklären konnte als damit, dass er Republikaner war.« Indessen befällt Polly, eine weitere Heldin, mit sechsundzwanzig die Angst vor dem Alter, denn »schon jetzt behandelten einige ihrer Freundinnen sie wie eine Trouvaille aus einem Trödelladen – wie ein leicht beschädigtes Stück antiken Porzellans.«
McCarthy übt sich also nicht gerade in Zurückhaltung in Bezug auf ihren Plot und ihre Protagonisten. Leser, die vor allem Wert auf »sympathische Charaktere« legen, werden vermutlich eine gewisse Irritation empfinden angesichts der Tatsache, dass die Heldinnen der Clique ausnahmslos alle mit Fehlern behaftet sind: Sie sind je nachdem vom Ehrgeiz zerfressen, verwirrt, teilnahmslos, leiden unter Angststörungen, sind arrogant oder zickig; McCarthy entwirft die Persönlichkeit ihrer Protagonisten nicht, damit sie dem Leser gefallen, noch lässt sie sich dazu herab, sie von ihrem Schicksal zu erlösen. Vielmehr entwickelt sich das Leben ihrer Charaktere mit logischer und absolut realistischer Konsequenz.
Seit mir vor rund 15 Jahren Die Clique wieder in die Hände gefallen ist, habe ich das Buch wohl an die zehn Mal gelesen. Es ist ein grandioses Buch, nicht nur wegen des hinreißend spöttischen Stils, sondern auch wegen der großartigen Erzähltechnik, der glänzenden Monologe und scharfsinnigen Schilderungen. Jedes Mal, wenn ich das Buch lese, werde ich von Ehrfurcht ergriffen angesichts McCarthys schriftstellerischer Qualitäten. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nie ein Buch wie Die Clique zustande bringen werde, aber Mary McCarthy wird mich immer inspirieren.
Aus dem Amerikanischen von Sophia Sonntag
ERSTES KAPITEL
Im Juni 1933, eine Woche nach dem College-Abschluss, wurde Kay Leiland Strong, Vassar Jahrgang 1933, mit Harald Petersen, Reed Jahrgang 1927, in der Kapelle der episkopalischen St.-George-Kirche, die Pfarrer Karl F. Reiland unterstand, getraut. Sie war die Erste aus ihrem Jahrgang, die heiratete. Die Bäume draußen auf dem Stuyvesant Square waren dicht belaubt und die Hochzeitsgäste, die zu zweien und dreien in Taxis vorfuhren, konnten den Lärm der Kinder hören, die in den Anlagen am Stuyvesant-Denkmal spielten. Während sie den Fahrer bezahlten und sich die Handschuhe glatt strichen, sahen sich die jungen Frauen, Kays Studienkolleginnen, neugierig um, als seien sie in einer völlig fremden Stadt. Sie waren erst jetzt dabei, New York zu entdecken, obwohl manche von ihnen seit ihrer Geburt hier lebten, in langweiligen, klassizistischen Häusern mit viel zu viel Platz in einer der Achtziger Straßen oder in einer der eleganten Etagenwohnungen an der Park Avenue. Darum faszinierten sie solche abgelegenen Winkel wie dieser hier mit seinen Grünflächen und dem Quäker-Gemeindehaus aus rotem Backstein, das mit blanken Messingbeschlägen und weißem Stuck direkt neben die weinrote Kirche gebaut war. Sonntags bummelten sie mit ihren Verehrern über die Brooklyn-Bridge und erforschten die verschlafenen Brooklyn Heights. Sie durchstreiften die vornehme Wohngegend von Murray Hill und die malerischen Viertel MacDougal Alley, Patchin Place und Washington Mews mit den vielen Künstler-Ateliers. Sie entzückten sich am Plaza Hotel und seinem Springbrunnen, an den grünen Markisen des Savoy Plaza, an den Pferdedroschken und bejahrten Kutschern, die dort wie auf einer französischen Place darauf warteten, sie zu einer Fahrt durch den abendlichen Central Park zu animieren.
An jenem Morgen war ihnen recht abenteuerlich zumute, als sie behutsam in der stillen, fast leeren Kirche Platz nahmen. Eine Hochzeit, zu der die Braut persönlich und mündlich einlud, ohne dass ein Verwandter oder eine ältere, mit der Familie befreundete Person sich einschaltete, hatten sie noch nicht erlebt. Auch die Flitterwochen sollten, wie man hörte, ausfallen, weil Harald (er gebrauchte diese alte skandinavische Schreibweise) als Inspizient bei einer Theaterinszenierung tätig war und, wie gewöhnlich, auch heute Abend zur Stelle sein musste, um die Schauspieler abzurufen. Das fanden die Mädchen schrecklich aufregend, und das rechtfertigte natürlich auch die eigentümlichen Begleitumstände der Hochzeit: Kay und Harald waren eben viel zu beschäftigt und zu dynamisch, als dass sie sich durch Konventionen hätten behindern lassen. Im September wollte Kay bei Macy’s, dem großen Warenhaus, anfangen, um sich gemeinsam mit anderen ausgesuchten Studentinnen mit den verschiedenen Verkaufstechniken vertraut zu machen. Weil sie aber den Sommer über nicht herumsitzen und auf ihren Einstellungstermin warten wollte, hatte sie sich bereits für einen Schreibmaschinenkurs in einer Handelsschule gemeldet, der ihr nach Haralds Meinung einen Vorsprung gegenüber den anderen Lehrlingen geben würde. Und laut Helena Davison, Kays Zimmergenossin aus ihrem Juniorenjahr, war das Brautpaar, das noch kein einziges Stück Wäsche oder Silber besaß, für den Sommer in eine möblierte Wohnung in einem hübschen Block in den östlichen Fünfziger Straßen gezogen. Ja, die beiden hatten (wie Helena soeben mit eigenen Augen festgestellt hatte) die vergangene Woche, seit dem Examen, auf den in der Untermiete enthaltenen Bettlaken der eigentlichen Wohnungsinhaber geschlafen!
Das war echt Kay, meinten die Mädchen gerührt, als die Geschichte in den Kirchenbänken die Runde machte. Sie fanden, Kay habe sich durch einen Kurs in Verhaltenslehre bei der alten Miss Washborn (die ihr Gehirn testamentarisch einem Forschungsinstitut vermacht hatte) sowie durch die Regiearbeit unter Hallie Flanagan erstaunlich verändert: Aus einem scheuen, hübschen, etwas fülligen Mädchen aus dem Westen mit glänzender schwarzer Lockenpracht und dem Teint einer Wildrose, einer eifrigen Hockeyspielerin und Chorsängerin, die stramm sitzende Büstenhalter trug und zu starken Menstruationen neigte, war eine magere, zielstrebige, bestimmt auftretende junge Frau geworden, die in blauen Arbeiterhosen, baumwollenen Sporthemden und Tennisschuhen herumlief, Farbspritzer im ungewaschenen Haar, Nikotinflecken an den Fingern, die nonchalant von Maltechniken, von Triebleben und Nymphomanie sprach, die ihre Vorgesetzten beim Vornamen und ihre Freundinnen mit schmetternder Stimme beim Nachnamen nannte – »Eastlake«, »Renfrew«, »MacAusland« – und voreheliche Erfahrung und Partnerwahl nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten empfahl. Liebe, erklärte sie, sei eine Illusion.
Die Mitglieder ihrer Clique, die jetzt alle sieben in der Kirche zugegen waren, hatten Kays Entwicklung beunruhigend gefunden, nannten sie jedoch nachsichtig eine »Phase«. Gewiss, Hunde, die bellen, beißen nicht, vergewisserten sie sich immer wieder bei ihren nächtlichen Zusammenkünften in ihrem gemeinsamen Wohnzimmer im Südturm der Main Hall, wenn Kay noch Kulissen malte oder mit Lester an der Bühnenbeleuchtung arbeitete. Aber sie befürchteten, dass die Gute von einem, der sie nicht so genau kannte, beim Wort genommen werden könnte. Über Harald zerbrachen sie sich lange den Kopf. Kay hatte ihn im vergangenen Jahr an einer Sommerbühne in Stamford kennengelernt, wo sie als Volontärin arbeitete und Männer und Frauen im selben Gebäude untergebracht waren. Sie behauptete, er wolle sie heiraten, aber aus seinen Briefen war das nach Ansicht der Clique nicht zu ersehen. In ihren Augen waren das keine Liebesbriefe, sondern lediglich Berichte über persönliche Erfolge bei Theaterberühmtheiten – was Edna Ferber in seiner Gegenwart zu George Kaufman geäußert, wie Gilbert Miller ihn zu sich gebeten und ein weiblicher Star ihn angefleht habe, ihr im Bett aus seinem Stück vorzulesen. Die Briefe schlossen mit einem knappen »Betrachte Dich als geküsst« oder nur »B. D. A. G.« – sonst nichts. Von einem jungen Mann ihrer Kreise wären solche Briefe als beleidigend angesehen worden, aber es war ihnen von Haus aus eingeprägt worden, dass es falsch sei, aufgrund der eigenen begrenzten Erfahrung generelle Urteile zu fällen. Immerhin merkten sie, dass Kay ihres Haralds nicht so sicher war, wie sie tat. Manchmal schrieb er wochenlang nicht, und die Arme tappte im Dunkeln. Polly Andrews, die mit Kay den Briefkasten teilte, konnte sich dafür verbürgen. Bis zu dem Essen ihres Jahrgangs vor zehn Tagen glaubten die Mädchen, dass Kays viel diskutierte Verlobung im Grunde gar nicht existierte. Sie hatten sogar daran gedacht, jemand Erfahreneren zurate zu ziehen, eine der Professorinnen oder den College-Psychiater, kurzum, jemand, bei dem Kay sich vielleicht aussprechen könnte. Dann aber wandelte sich ihre Angst in wohlige Heiterkeit; an jenem Abend nämlich, da Kay um die lange Tafel lief, womit man nach altem Brauch dem ganzen Jahrgang seine Verlobung kundtat, und zwischen ihren heftig wogenden Brüsten einen komischen mexikanischen Silberring hervorzog. Da klatschten sie lächelnd und zwinkernd Beifall, als wollten sie sagen, sie hätten es längst gewusst. Mit Worten, die dem gesellschaftlichen Ereignis sehr viel angemessener waren, versicherten sie ihren Eltern, welche zu den Prüfungsfeierlichkeiten gekommen waren, dass die Verlobung seit Langem bestehe und dass Harald »schrecklich nett« und »schrecklich verliebt« in Kay sei. Jetzt, in der Kirche, zupften sie ihre Pelzkrägen zurecht und nickten einander überlegen lächelnd zu: wie ausgewachsene Edelpelztierchen. Sie hatten recht gehabt, Kays Schroffheit war nur eine Phase gewesen. Eins zu null für den Rest der Clique, dass ausgerechnet diese Rebellin und Spötterin als Erste vor dem Traualtar stand.
»Wer hätte das gedacht!«, bemerkte vorlaut Pokey, Mary Prothero, ein dickes, lustiges New Yorker Society-Girl, mit runden roten Backen und messingblondem Haar, die ihren Vater, einen passionierten Segler, kopierte und den Jargon der Herzensbrecher aus der McKinley-Zeit bevorzugte. Sie war das Sorgenkind der Clique, sehr reich und sehr faul. In allen Fächern benötigte sie Nachhilfestunden, sie mogelte bei den Prüfungen, fuhr heimlich übers Wochenende fort, stahl Bibliotheksbücher, kannte weder Bedenken noch moralische Hemmungen, interessierte sich nur für Tiere und Jagdbälle und wollte, wie im Jahresbericht zu lesen stand, Tierärztin werden. Gutmütig, wie sie war, hatte sie sich von den Freundinnen zu Kays Trauung schleppen lassen, wie sie sich früher auch zu College-Versammlungen schleppen ließ, wenn man sie durch Steinwürfe an ihr Fenster aufweckte, ihr den verknitterten Talar über den Kopf zog und das Barett aufstülpte. Nachdem man sie nun glücklich in der Kirche hatte, würde man sie im Lauf des Tages zu Tiffany bugsieren, damit Kay wenigstens ein wirklich vorzeigbares Hochzeitsgeschenk bekam. Pokey würde von selbst nicht auf den Gedanken kommen, denn für sie gehörten Hochzeitsgeschenke, Sicherheitspersonal, Brautjungfern, Geschwader von Limousinen, Empfänge bei Sherry’s oder im Colony Club zur Bürde der Privilegierten. Wenn man schon nicht zur Gesellschaft gehörte, wozu dann das Brimborium? Sie selbst, verkündete sie, hasse Anproben und Debütantinnenbälle, und mit demselben Gefühl sehe sie ihrer Hochzeit entgegen, zu der es ja zweifellos kommen werde, da sie, dank Papas Geld, unter den Verehrern nur zu wählen brauche. All das brachte sie während der Taxifahrt in ihrem enervierenden Salongeschnatter vor, bis sich an einem Rotlicht der Fahrer neugierig nach ihr umdrehte, nach ihr, die in blauseidenem Ripskostüm und Zobeln dasaß und ihrerseits ein brillantbesetztes Lorgnon vor die kurzsichtigen saphirblauen Augen hielt, ihn beäugte und mit seinem Foto über der Windschutzscheibe verglich, um mit lauter Flüsterstimme ihren Freundinnen zu verkünden: »Das ist nicht derselbe Mann!«
»Sehen sie nicht goldig aus?«, hauchte Dottie Renfrew aus Boston, um Pokey zum Schweigen zu bringen, als Harald und Kay nun, begleitet von Helena Davison, Kays Ex-Zimmergefährtin aus Cleveland, und einem fahlen, blonden, schnurrbärtigen Jüngling, aus der Sakristei kamen und ihre Plätze vor dem Vikar einnahmen. Pokey hob das Lorgnon an die Augen, die sie greisenhaft zukniff. Sie sah Harald zum ersten Mal, denn während seines einzigen Wochenendbesuchs im College war sie bei Freundinnen zur Jagd gewesen. »Nicht übel«, bemerkte sie, »bis auf die Schuhe.«
Der Bräutigam war ein magerer, nervös angespannter junger Mann mit glattem schwarzem Haar und einer sehr guten, drahtigen Fechterfigur. Er trug einen blauen Anzug, ein weißes Hemd, braune Wildlederschuhe und eine dunkelrote Krawatte. Pokeys kritischer Blick schweifte jetzt zu Kay, die ein blassbraunes, dünnes Seidenkleid mit großem weißem Seidenbatistkragen anhatte und dazu einen breitrandigen, margeritenbekränzten schwarzen Tafthut trug. Um eines der gebräunten Handgelenke schlang sich ein goldenes Armband, das von ihrer Großmutter stammte. Sie hielt einen Strauß von Feldmargeriten und Maiglöckchen in der Hand. Mit ihren glühenden Wangen, ihren glänzenden schwarzen Locken und den goldbraunen Augen wirkte sie wie eine Dorfschönheit auf einer alten kolorierten Postkarte. Ihre Strumpfnähte saßen schief und die Fersen ihrer schwarzen Wildlederschuhe waren blankgewetzt. Pokeys Gesicht verfinsterte sich. »Mein Gott, weiß sie denn nicht«, lamentierte sie, »dass Schwarz auf einer Hochzeit Unglück bringt?« – »Halt den Mund!«, knurrte es wütend von der anderen Seite. Pokey sah sich gekränkt zu der neben ihr sitzenden Elinor Eastlake aus Lake Forest um, der schweigsamen, brünetten Schönheit der Clique, die sie aus grünen Mandelaugen mordlustig anstarrte. »Aber Lakey!«, ereiferte sich Pokey. Dieses Mädchen aus Chicago, ohne Makel, intellektuell, hochmütig und fast so reich wie Pokey, war die Einzige aus der Clique, die ihr imponierte. Denn trotz all ihrer Gutmütigkeit war Pokey selbstverständlich ein Snob. Für sie war klar, dass von den vielen Vassar-Freundinnen nur Lakey erwarten konnte, zu ihrer Trauung eingeladen zu werden – und umgekehrt; die anderen würde man bloß zum Empfang bitten. »Idiotin!«, zischte die Madonna aus Lake Forest durch ihre perlweißen Zähne. Pokey rollte die Augen. »Übergeschnappt«, bemerkte sie zu Dottie Renfrew. Beide Mädchen schielten amüsiert auf Elinors hochmütiges Profil. Der klassisch geschnittene, feine weiße Nasenflügel bebte schmerzlich.
Für Elinor war diese Trauung eine Qual. Sie war ein einziger greller Missklang: Kays Kleid, Haralds Schuhe und Krawatte, der nackte Altar und die wenigen Gäste auf Seiten des Bräutigams (ein Ehepaar und ein Junggeselle), kein Mensch aus der Verwandtschaft. Die intelligente und krankhaft sensible Elinor schrie innerlich vor Mitleid mit den derart gedemütigten Hauptbeteiligten. Das wechselseitige Gezwitscher aus »furchtbar nett« und »wie aufregend«, welches statt eines Hochzeitsmarsches das Paar begrüßte, konnte sie sich nur als Heuchelei erklären. Elinor war stets fest von der Heuchelei anderer überzeugt, da sie einfach nicht glauben konnte, dass den anderen mehr entging als ihr. Auch jetzt nahm sie an, dass die Mädchen um sie herum sehen mussten, was sie selber sah, und sich – wie auch Kay und Harald – zutiefst beschämt fühlen mussten.
Der Vikar zog mit einem Hüsteln die Aufmerksamkeit der Gemeinde auf sich. »Vortreten!«, herrschte er das junge Paar an, und das klang, wie Lakey später bemerkte, mehr nach Autobusschaffner als nach Pfarrer. Der frisch ausrasierte Nacken des Bräutigams rötete sich. In dem geweihten Raum wurden sich Kays Freundinnen plötzlich der Tatsache bewusst, dass Kay erklärte Atheistin (auf wissenschaftlicher Grundlage) war; jede von ihnen bewegte der gleiche Gedanke: Was hatte sich bei der Besprechung mit dem Pfarrer abgespielt? War Harald praktizierender Christ? Kaum. Wie hatten die beiden es dann fertiggebracht, sich in einer so erzkonservativen Kirche trauen zu lassen? Dottie Renfrew, ein gläubiges Mitglied der Episkopalkirche, zog ihren Pelzkragen enger um den empfindlichen Hals; sie erschauerte. Am Ende wohnte sie gar einem Sakrileg bei. Sie wusste genau, dass Kay, die stolze Tochter eines Agnostikers – eines Arztes – und einer mormonischen Mutter, nicht einmal getauft war. Kay war, wie die Clique ebenfalls wusste, auch nicht gerade sehr wahrheitsliebend; ob sie den Pfarrer angelogen hatte? Wäre die Trauung dann etwa ungültig? Eine leichte Röte zeigte sich auf Dotties Schlüsselbein über dem v-förmigen Ausschnitt ihrer handgearbeiteten Crêpe-de-Chine-Bluse, ihre erschrockenen braunen Augen blickten forschend auf die Freundinnen, ihre allergische Haut zeigte Flecken. Was jetzt kam, wusste sie auswendig. »Wenn jemand berechtigte Einwände vorzubringen hat, wonach diese beiden vor dem Gesetz nicht verbunden werden dürfen, so spreche er jetzt oder schweige für immer.« Die Stimme des Priesters hielt fragend inne, sein Blick schweifte prüfend über die Kirchenbänke. Dottie schloss die Augen und betete, sie empfand die Totenstille in der Kapelle beinahe körperlich. Ob Gott oder Dr. Leverett, sein Pfarrer, wirklich wünschte, dass sie Einspruch erhebe? Sie betete, sie möchten es nicht wünschen. Die Gelegenheit war vorbei, als sie wieder die Stimme des Pfarrers vernahm, laut und feierlich, fast wie in Verdammung des Paares, dem er sich jetzt zuwandte. »Und so fordere und verlange ich von euch beiden, mir zu antworten, wie ihr antworten werdet, wenn einst aller Herzen Geheimnisse offenbar werden. Wenn einem von euch ein Hindernis bekannt ist, dessentwegen ihr vor dem Gesetz nicht den Bund der Ehe eingehen könnt, so sage er es jetzt. Denn seid euch gewiss, wenn Personen unter Umständen miteinander verbunden werden, die Gottes Wort nicht erlaubt, dann sind sie nicht rechtens verheiratet.«
Man hätte das Fallen einer Nadel hören können, wie die Mädchen später einmütig bezeugten. Jede von ihnen hielt den Atem an. Dotties religiöse Skrupel waren einer neuen Besorgnis gewichen, welche die ganze Clique teilte. Das gemeinsame Wissen, dass Kay mit Harald »gelebt« hatte, erfüllte plötzlich alle mit einem Gefühl des Verbotenen. Sie blickten sich verstohlen in der Kirche um und stellten zum x-ten Male fest, dass weder Eltern noch irgendwelche älteren Personen anwesend waren. Das Abweichen vom Herkömmlichen, vor dem Gottesdienst noch so »herrlich«, kam ihnen jetzt unheimlich und unheilvoll vor. Sogar Elinor Eastlake, die sich voll Verachtung klarmachte, dass Unzucht nicht zu den Hindernissen gehörte, auf die im Gottesdienst angespielt worden war, erwartete beinahe, dass ein Unbekannter sich erheben und der Zeremonie Einhalt gebieten werde. Für sie bestand gegen die Ehe ein Hindernis seelischer Art: sie hielt Kay für eine rohe, gewissenlose, dumme Person, die Harald nur aus Ehrgeiz heiratete.
Alle Anwesenden glaubten jetzt, aus den Pausen und Betonungen in der Rede des Vikars etwas Ungewöhnliches heraushören zu können. Noch nie war ihnen das »dann sind sie nicht rechtens verheiratet« so nachdrücklich entgegen geschleudert worden. Ein hübscher, verlebt aussehender junger Mann mit kastanienbraunem Haar, der neben dem Bräutigam stand, ballte plötzlich die Faust und murrte vor sich hin. Er roch fürchterlich nach Alkohol und wirkte nervös. Während der ganzen Zeremonie hatte er die wohlgeformten kräftigen Hände geballt und wieder gestreckt und sich auf die schön geschnitten Lippen gebissen. »Er ist Maler, gerade erst geschieden«, flüsterte zu Elinors Rechten die hellblonde Polly Andrews, die zwar zu den Stillen gehörte, aber stets alles wusste. Elinor beugte sich vor und erhaschte auch sofort seinen Blick. Da ist jemand, dachte sie, der sich ebenso angewidert und unbehaglich fühlt wie sie. In seinem Blick lag tiefe, bittere Ironie, und dann zwinkerte er unmissverständlich zum Altar hinüber. Der Vikar, beim Hauptteil des Gottesdienstes angelangt, hatte es plötzlich sehr eilig, als sei ihm jetzt erst eingefallen, dass er noch einen Termin habe und daher mit diesem Paar so rasch wie möglich fertig werden wolle. Man merkte ihm geradezu an, dass es sich hier nur um eine Zehn-Dollar-Trauung handelte. Kay unter ihrem großen Hut schien von allem nichts zu spüren, aber Haralds Ohren und Hals hatten sich stärker gerötet, und seine Antworten, die er mit einer gewissen schauspielerischen Bravour gab, waren betont langsam und zwangen den Geistlichen wieder zu einem der feierlichen Handlung angemessenen Tonfall.
Das Paar neben dem Bräutigam lächelte verständnisvoll, als kenne es Haralds Schwächen, aber die Mädchen in ihren Bänken waren über die Ungezogenheit des Geistlichen empört und genossen den Sieg, den Harald in ihren Augen errungen hatte. Sie hatten vor, ihm dies bei der Gratulationsrunde auch zu sagen. Einige nahmen sich vor, mit ihren Müttern darüber zu sprechen, damit diese bei Dr. Reiland Beschwerde führten. Die Fähigkeit, sich zu entrüsten, das Vorrecht ihrer Klasse, war durch ihre Erziehung gleichsam in umgekehrte Bahnen gelenkt worden. Die Tatsache, dass Kay und Harald arm wie Kirchenmäuse leben würden, war keine Entschuldigung dafür, so dachten sie in ihrer Loyalität, dass der Geistliche sich so benahm, noch dazu in einer Zeit, da alle sich einschränken mussten. Sogar ein Mädchen aus ihren Kreisen hatte ein Stipendium in Anspruch nehmen müssen, um ihr Studium beenden zu können, und keiner dachte deswegen etwa schlechter von ihr. Polly Andrews blieb trotzdem eine ihrer liebsten Freundinnen. Sie waren, das konnten sie dem Geistlichen versichern, aus ganz anderem Holz als die Mädchen des vorigen Jahrzehnts: Unter ihnen war keine, die nicht vorhatte, im kommenden Herbst zu arbeiten, und sei es als Volontärin. Libby MacAusland hatte eine Zusage von einem Verleger. Helena Davison, deren Eltern in Cincinnati, ach nein, in Cleveland von den Zinsen ihres Einkommens lebten, wollte Lehrerin werden – sie hatte sich bereits einen Job in einer privaten Vorschule gesichert. Polly Andrews – Hut ab vor ihr – würde als Laborantin im Medical Center tätig sein. Dottie Renfrew war für das Amt einer Fürsorgerin bei einer Bostoner Behörde ausersehen. Lakey ging nach Paris, wo sie Kunstgeschichte studieren und sich auf einen höheren akademischen Grad vorbereiten wollte. Pokey Prothero, die zur Abschlussprüfung ein Flugzeug bekommen hatte, machte gerade ihren Pilotenschein, um jede Woche für drei Tage zur Cornell Agricultural School zu fliegen. Und zu guter Letzt hatte die kleine Priss Hartshorn, die Streberin der Clique, gestern gleichzeitig ihre Verlobung mit einem jungen Arzt mitgeteilt und dass sie einen Job bei der National Recovery Administration bekommen habe. Nicht schlecht, fanden sie, für eine Clique, die mit dem Stigma der Hochnäsigkeit durch das College gegangen war. Und auch sonst, in Kays weiterem Freundeskreis, gab es eine ganze Reihe Mädchen aus besten Familien, die eine Laufbahn im Geschäftsleben, in der Anthropologie oder Medizin anstrebten, nicht etwa weil sie es nötig hatten, sondern weil sie sich imstande fühlten, zum weiteren Aufstieg Amerikas beizutragen. Die Clique fürchtete sich auch nicht davor, als radikal zu gelten. Sie erkannte das Gute an, das Roosevelt leistete, was immer ihre Mütter und Väter auch sagen mochten. Sie fiel nicht auf Parteiprogramme herein und fand, man solle den Demokraten eine Chance geben, damit sie zeigen könnten, was sie auf dem Kasten hätten. Erfahrung war nur eine Frage des Durch-Fehler-klug-Werdens. Selbst die Konservativsten der Clique gaben schließlich zu, dass ein ehrlicher Sozialist ein Recht darauf habe, gehört zu werden.