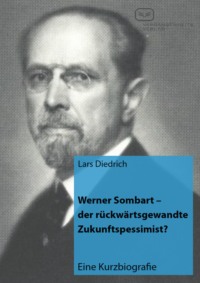Buch lesen: "Werner Sombart - der rückwärtsgewandte Zukunftspessimist?"
Lars Diedrich
Werner Sombart – der rückwärtsgewandte Zukunftspessimist?
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-86408-105-7 (epub) // 978-3-86408-106-4 (pdf)
Korrektorat: Alexander Schug
Grafisches Gesamtkonzept, Titelgestaltung, Satz und Layout: Stefan Berndt – www.fototypo.de
© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin / 2012
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Inhalt
Einleitung
Werner Sombart, Versailles und das Deutsche Reich
Flucht aus dem Elternhaus
Vorläufige Endstation Breslau
Kapitalismusforschung und die Gründung der deutschen Soziologie
Höhepunkt der Karriere und Niederlage im Krieg
Der „Proto-Nazi“
„Vom Menschen“ – Ende einer wissenschaftlichen Karriere
Nur ein rückwärtsgewandter Zukunftspessimist?
Anhang
Lebenstationen
Ausgewählte Schriften
Endnoten
Einleitung
„Fragen wir […], was wir denn nun an sicherem Wissen von den Vorgängen der Vererbung beim Menschen und damit von dem Verhältnis zwischen Geist und Natur beim Aufbau der Persönlichkeit besitzen, so kann die Antwort nur lauten: herzlich wenig.“1
Diesen Satz schreibt Werner Sombart 1938 in seinem Buch „Vom Menschen“. Er richtet sich damit gegen den Rassenwahn und die Herrenvolk-Ideologie der Nationalsozialisten. Die Idee, ein auserwähltes Volk zu sein, führt er auf menschlichen Eigendünkel und Eigennutz zurück, die jeglicher Objektivität entbehrten. Zwar werden die Nationalsozialisten mit keinem Wort erwähnt, doch ist diesen klar, auf wen sich der Autor bezieht. Sie zensieren das Buch und versuchen dessen Auslieferung zu behindern. So darf „Vom Menschen“ nicht in Buchhandlungen ausgestellt und nur auf Nachfrage verkauft werden. Auch Genehmigungen für öffentliche Vorträge werden Werner Sombart nun immer öfter verweigert.2
Dem Verbot des Buches steht wohl die Bekanntheit des Autors entgegen. Der 75-jährige Werner Sombart ist damals einer der berühmtesten Wissenschaftler Deutschlands. Seine Bücher erscheinen im In- wie im Ausland mit hoher Auflagenzahl und seine Vorträge erreichen in der Weimarer Republik und im Kaiserreich ein Massenpublikum. Er gehört wie Max Weber, Ferdinand Tönnies und Georg Simmel 1909 zu den Gründungsmitgliedern der heute noch immer einflussreichen Deutschen Gesellschaft für Soziologie (http://www.soziologie.de).
Dennoch gilt Werner Sombart heutzutage als Proto-Nazi, als einer der Wissenschaftler, der dem Nationalsozialismus mit seinen Schriften und Reden den Weg geebnet hat. Der Mitbegründer der modernen Soziologie ist heute weitestgehend unbekannt, während seine damaligen Freunde, Kollegen und Mitstreiter wie Max Weber, Georg Simmel oder Ferdinand Tönnies als deren Gründerväter gerühmt werden. Auch die Qualität seiner wissenschaftlichen Arbeit ist umstritten. Der Historiker Rolf Sieferle ist beispielsweise der Meinung, Werner Sombarts eigentliche wissenschaftliche Leistung wäre nicht umsonst in Vergessenheit geraten, denn sie sei widersprüchlich, platt und oberflächlich. Andere, wie der Sombart-Biograph Friedrich Lenger, fragen sich hingegen, ob nicht vor allen Dingen Sombarts Ruf als Proto-Nazi dazu geführt hat, dass sein Anteil an der Gründung der modernen Soziologie unterschlagen wird.3
Diese unterschiedliche Wahrnehmung der Person Werner Sombart wird erst verständlich, wenn man einen Blick auf dessen in weiten Teilen widersprüchliches Leben wirft. Denn Werner Sombart war sowohl ein innovativer und vom Fortschritt faszinierter Sozialwissenschaftler, als auch gleichzeitig ein vehementer, unreflektierter Gegner der modernen Welt.
Dieser Widerspruch ist interessant und zeittypisch dazu. Denn Werner Sombart lebt in einer Zeit, in der die Grundlagen der modernen Welt, wie sie uns heute vertraut ist, gelegt werden. Dinge, die unser heutiges Leben prägen, beginnen sich zu Sombarts Lebzeiten zu etablieren. Dazu gehören beispielsweise die Elektrizität, Straßen- und U-Bahnen, Autos, Flugzeuge, Filme, der Rundfunk, Telefone, die industrielle Massenproduktion von Gütern oder Kaufhausketten. Die Welt, in der Werner Sombart stirbt, unterscheidet sich grundlegend von der, in die er geboren wurde. Die Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf diese Veränderungen, teils mit großem Zukunftsoptimismus, teils mit einer radikalen Ablehnung der Moderne. Das Leben Werner Sombarts spiegelt eine mögliche Reaktion wider, die in dem fatalen Wunsch nach einer Rückkehr in die vorindustrielle Zeit und nach einem starken Führer gipfelt.
Die Wurzeln des Widerspruchs aus Faszination und Ablehnung der modernen Welt, der Werner Sombarts Leben prägt, werden bereits früh in dessen Kindheit gelegt. Denn er wird in einem Land geboren, das zwar wirtschaftlich innovativ und erfolgreich ist, gleichzeitig aber von Kaisern regiert wird, die ihre Herrschaft als gottgegeben betrachten …
Werner Sombart, Versailles und das Deutsche Reich
Die Proklamation des Deutschen Reiches in Versailles 1871 erlebt Werner Sombart als Kind im Alter von acht Jahren. Sein Vater Anton Ludwig Sombart ist ein angesehener preußischer Politiker und erfolgreicher Unternehmer. Er gehört zu den 30 Abgeordneten, die der Proklamation des neuen Deutschen Reiches in Versailles persönlich beiwohnen und dem preußischen König die Kaiserkrone überreichen. Es ist diese Zeit der großen Umwälzungen, die den Weg des berühmten Sozialwissenschaftlers prägen wird. Die Industrialisierung beginnt sich in den deutschen Einzelstaaten voll zu entfalten. Dampfmaschinen verändern die Gesellschaft grundlegend. Sie revolutionieren das Verkehrswesen und ermöglichen die Massenproduktion industrieller Güter, indem sie Webstühle, Druckerpressen oder Dampfhämmer antreiben. Lokomotiven oder Stahlschiffe befördern Personen und Güter in noch nie dagewesener Geschwindigkeit. Die Entfernungen verlieren an Bedeutung. Strecken, die man vor ein paar Jahren noch mühsam in mehreren Wochen zu Fuß oder Pferd bereiste, können nun bequem in wenigen Tagen zurückgelegt werden.4
Die alten Gesellschaftsstrukturen werden aufgebrochen. Traditionsreiche Handwerke, wie z.B. das der Weber, werden aufgrund der neuen, gnadenlos effizienten Webstühle obsolet. Für andere Handwerke wiederum, schafft die Industrialisierung weitere Beschäftigungsmöglichkeiten. Die schnell wachsenden Städte und Industrien benötigen handwerkliches Know-how im Häuserbau oder in der Rohstoffverarbeitung.5
Auch große Teile des Adels sind mit der neuen Zeit überfordert. Die adeligen Familien denken oft nicht marktwirtschaftlich genug, sondern verlassen sich zu sehr auf ihren althergebrachten Stand und die damit verbunden gesellschaftlichen Privilegien. Nun tritt dem Adel jedoch ein selbstbewusstes, wirtschaftlich erfolgreiches Bürgertum entgegen, das dieses Selbstverständnis in Frage stellt. Verarmte Adelsgüter werden oft von wohlhabenden Bürgern aufgekauft – nur ein Symptom von vielen, das die neuen Verhältnisse charakterisiert.
Auch politisch ist Deutschland in Bewegung. Seit dem leisen Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806, gibt es nur noch voneinander unabhängige deutsche Einzelstaaten. Das ehemalige Reich ist zu einem bunten Flickenteppich geworden: Neben dem mächtigen protestantisch-absolutistischen Preußen, gibt es liberale Stadtstaaten wie Hamburg und Bremen, die süddeutschen, katholisch geprägten Länder oder das Preußen militärisch lange Zeit ebenbürtige multikulturelle Österreich-Ungarn. Der Krieg gegen die napoleonische Besatzung bringt jedoch eine länderübergreifende patriotische Bewegung hervor, die einen demokratisch verfassten deutschen Staat mit einer zeitgemäßen Verfassung fordert. Artikuliert werden diese Ideen von dem aufstrebenden Bürgertum. Studenten, Akademiker, Beamte und Unternehmer wollen nicht länger nur die Zaungäste der Politik sein, sie wollen mitentscheiden und mitgestalten. Doch die traditionellen, adeligen Eliten halten dagegen. Sie sehen sich in ihrer Machtposition gefährdet, die sie als von Gott gegeben betrachten. 1848 kommt es zum Zusammenstoß der beiden Lager. In der preußischen Hauptstadt Berlin revoltiert die Bevölkerung gegen den König und es bricht ein blutiger Straßenkampf aus. Die Revolution entwickelt sich zum Flächenbrand und erfasst die anderen deutschen Staaten. Die adeligen Herrscher schaffen es noch, die revolutionäre Bewegung niederzuschlagen. Im liberalen Bürgertum ist die Enttäuschung groß. Es wird weitere 23 Jahre warten müssen, bis ein deutscher Staat entstehen wird. Das 1871 in Versailles proklamierte neue Deutsche Reich hat allerdings einen bitteren Beigeschmack, denn es wird nicht nach den Idealen des Bürgertums gestaltet. Die traditionellen Eliten verwirklichen ihre Vorstellungen von einem Staat, in dem der Kaiser die oberste staatliche Instanz ist und das Parlament nur eine untergeordnete Rolle einnimmt. Dennoch begeistert sich das Bürgertum für das geeinte Deutschland.6
Auch Werner Sombarts Vater Anton Ludwig ist unmittelbar an diesen Entwicklungen beteiligt. 1848 ist er 32 Jahre alt und Teil des politisch liberalen Bürgertums. Als die Revolution ausbricht, hängt er umgehend eine schwarz-rot-goldene Fahne aus seinem Fenster und hofft auf die Gründung eines deutschen Staates. Er arbeitet als Feldvermesser, kann aber seinen Beruf wegen eines Augenleidens nicht weiter ausüben. Stattdessen bewirbt er sich auf die Stelle des Bürgermeisteramtes in Ermsleben. Es ist die Zeit, in der der Zuckerrübenanbau in Europa beginnt, den teuer importierten Rohrzucker aus den Kolonien abzulösen. Werners Vater erkennt das Potential des Rübenzuckers und beschließt eine eigene Zuckerfabrik zu gründen. Die Fabrik floriert und Anton Ludwig wird ein erfolgreicher Geschäftsmann. Seinen Gewinn reinvestiert er in den Ankauf mehrerer Rittergüter von verarmten Adeligen und wird so zum erfolgreichen Agrarunternehmer und Agrarreformer. Aufgrund seines Ansehens und seiner gesellschaftlichen Stellung schafft er es als nationalliberales Mitglied in den preußischem Landtag gewählt zu werden.7
Er wird so Teil der preußischen bürgerlichen Elite, verkehrt in zahlreichen Vereinen und ist mit einflussreichen Persönlichen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft befreundet. So ist er z.B. neben den berühmten Nationalökonomen Gustav Schmoller und Adolph Wagner Mitglied des renommierten Vereins für Sozialpolitik, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die negativen sozialen Auswirkungen der liberalen Wirtschaftspolitik zu beheben. Bei der Proklamation des Reiches in Versailles speist er mit dem preußischen König und späteren deutschen Kaiser zu Abend und gehört zu einer Delegation von 30 Abgeordneten, die diesem die Kaiserkrone überreicht. Otto von Bismarck schlägt ihn für das Amt des Agrarministers vor, das Anton Ludwig Sombart aber aufgrund seines Augenleidens ablehnt.8
Die politischen Verpflichtungen des Vaters veranlassen die Familie Sombart, das Unternehmen zu verkaufen und nach Berlin zu ziehen, der neuen deutschen Hauptstadt.9
Anton Ludwig hat hohe Ansprüche an seinen Sohn und hofft, dass dieser an den renommierten Berliner Gymnasien die bestmögliche Schulausbildung erhält. Doch Werner ist nur ein mittelmäßiger Schüler. Er leidet unter den hohen Ansprüchen seines erfolgreichen und angesehenen Vaters und ist von Zweifeln geplagt, ob er es ihm jemals gleichtun kann. Werner ist wesentlich jünger als seine drei Geschwister, die das Haus nach und nach verlassen und lebt bald alleine bei seinen Eltern. Er schreibt damals an einen Freund, dass er sich einsam und von seinen Eltern nicht verstanden fühlt. Werner entfremdet sich immer mehr von seinem Vater. So oft es geht entflieht er der Enge des Elternhauses, trifft sich mit Gleichaltrigen oder zieht sich in sein Zimmer zum Lesen zurück. Er spielt Theater, schreibt Gedichte, diskutiert mit Freunden über Cicero und griechische Klassiker und ist ein großer Verehrer von Goethe und Schiller.10
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.