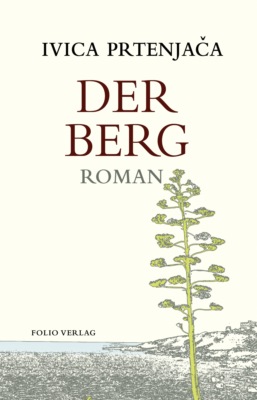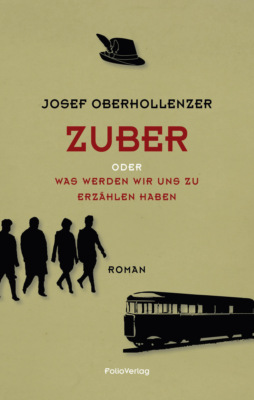Umfang 143 Seiten
0+
Über das Buch
Ein Roman über die Rückeroberung der Freiheit, die Möglichkeit der Veränderung und die Faszination des Mediterranen. Ein Mann aus der Kunst- und Verlagsszene lässt seinen bürgerlichen Alltag, Werbekampagnen und Vernissagen hinter sich und zieht sich einen Sommer lang auf eine kleine Adriainsel zurück. Er verdingt sich als Brandwächter auf einem Wachtturm, in Gesellschaft einzig von einem altersschwachen Esel und einem zugelaufenen Hund. Er begegnet modernen Pilgern, verirrten Bikern, trommelnden Sinnsuchern, verlorenen Seelen des turbokapitalistischen Zeitalters und traumatisierten Kämpfern aus dem Jugoslawienkrieg – Tätern wie Opfern. Die Monate der Einsamkeit auf dem Berg krempeln sein Leben völlig um, und er erlebt einen tiefen inneren Wandel.