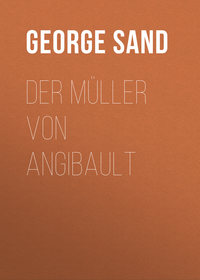Das Buch kann nicht als Datei heruntergeladen werden, kann aber in unserer App oder online auf der Website gelesen werden.
Buch lesen: "Der Müller von Angibault"
Einleitung
1. Kapitel
Es schlug ein Uhr nach Mitternacht, auf dem Turm der Kirche des heil. Thomas von Aquino, als eine kleine, schwarze Gestalt rasch die dunkle Mauer eines der schönen Gärten entlangglitt, welche sich noch auf dem linken Ufer der Seine in Paris vorfinden und die inmitten einer Hauptstadt von so unschätzbarem Werte sind.
Die Nacht war lau und heiter. Die Stechapfelblüten atmeten süße Düfte und standen wie große, weiße Gespenster in dem glänzenden Vollmondlicht. Die Architektur der breiten Freitreppe des Hotel Blanchemont zeigte alte Pracht und der weitläufige, gut unterhaltene Garten erhöhte noch das reiche, vornehme Aussehen dieser schweigsamen Behausung, an deren Fenstern kein Lichtschimmer mehr sichtbar war.
Die prächtige Mondhelle schien der jungen Frau, welche in Trauerkleidung, den dunkelsten Schatten suchend, auf eine kleine, am äußersten Ende der Mauer angebrachte Türe zueilte, Unruhe zu erregen. Sie ging jedoch dessen ungeachtet entschlossen vorwärts, denn es war nicht zum ersten Mal, dass sie um einer keuschen und jetzt auch legitimen Liebe willen ihren Ruf aufs Spiel setzte. Sie war seit einem Monat Witwe.
Unter dem Schutz einer dichten Akazienhecke gelangte sie geräuschlos an die kleine Nebenpforte, welche auf eine schmale und wenig gangbare Straße hinausging, und fast in demselben Augenblicke öffnete sich das Pfortlein, der zum Stelldichein berufene Mann trat verstohlen ein und folgte, ohne ein Wort zu sprechen, seiner Geliebten zu einer kleinen Orangerie, in welcher sie sich verschlossen. Von unwillkürlichem Schamgefühl geleitet, zog die junge Baronin von Blanchemont jedoch sogleich ein allerliebstes Feuerzeug von russischem Leder aus der Tasche, ließ einen Funken daraus hervorspringen und brannte ein in einem Winkel versteckt und verdeckt angebrachtes Wachslicht an. Der schüchterne und ehrfurchtsvolle Jüngling half ihr naiv das Innere des Pavillon erhellen. Es machte ihn ja so glücklich, sie sehen zu können.
Das Gewächshaus war durch enge Jalousien dicht geschlossen, eine Gartenbank, einige leere Kisten, Gartengerät und das kleine Wachslicht, welches keinen andern Leuchter hatte, als einen halbzerbrochenen Blumentopf, dies war das Mobiliar und die Beleuchtung des verlassenen Boudoirs, welches vor Zeiten einer Marquise zu wollüstiger Zurückgezogenheit gedient hatte.
Der Abkömmling dieser Marquise, die blonde Marcelle, war so keusch und einfach angezogen, wie es einer sittsamen Witwe zukam. Ihre schönen, goldig schimmernden Haare, die auf ihr Halstuch von schwarzem Krepp niederfielen, waren ihr einziger Kopfputz. Die Zartheit ihrer alabasterweißen Hände und ihres in Atlasstiefelchen steckenden Fußes waren die einzigen offenkundigen Anzeichen ihres aristokratischen Standes; im Übrigen hätte man sie für die naturgemäße Genossin des vor ihr auf den Knien liegenden Mannes nehmen können, für eine Pariser Grisette, denn es gibt Grisetten, welche auf ihrer Stirne die Würde einer Königin und die Reinheit einer Heiligen tragen.
Heinrich Lemor war von angenehmer, aber mehr durch geistigen Ausdruck, als durch Schönheit, ausgezeichneter Gestalt. Reiche schwarze Haare beschatteten seine blassen Züge. Man sah ihm deutlich an, dass er ein Kind von Paris war, stark durch seine Willenskraft, zart von Körperbau. Sein reinlicher und einfacher Anzug verriet nur sehr mittelmäßige Vermögensumstände, seine nachlässig geknüpfte Halsbinde zeigte einen völligen Mangel aller Ziererei und seine braunen Handschuhe genügten, um den Beweis zu liefern, dass er, wie sich die Lakaien des Hôtel Blanchemont ausgedrückt hätten, nicht der Mann war, welcher den Gemahl oder den Liebhaber der gnädigen Frau abgeben sonnte. Die beiden jungen, fast im gleichen Alter stehenden Leute hatten mehr denn einmal während der geheimnisvollen Stunden der Nacht in dem Pavillon süße Augenblicke verlebt, allein seit einem Monat, wo sie sich nicht gesehen, hatten große Beängstigungen den Roman ihrer Liebe getrübt.
Heinrich Lemor zitterte und sah bestürzt aus. Marcelle schien von Furcht durchfröstelt. Er hatte sich vor ihr auf die Knie geworfen, um ihr zu danken, dass sie ihm ein letztes Stelldichein gegeben: aber bald erhob er sich wieder, ohne ein Wort vorzubringen und nahm eine bange, fast kalte Haltung an.
»Endlich!…« sagte sie mit Anstrengung und reichte ihm ihre Hand, welche er mit einer beinahe krampfhaften Bewegung, und ohne dass ein Strahl von Freude seine Züge erhellt hätte, an seine Lippen führte.
›Er liebt mich nicht mehr!‹ dachte sie und drückte ihre Hände vor die Augen. Und sie blieb stumm und zum Tode erschrocken.
»Endlich?« wiederholte Lemor. »Wollten Sie nicht sagen: schon? Ich hätte die Kraft haben sollen, länger zu warten. Ich vermochte es nicht. Verzeihen Sie mir!«
»Ich verstehe Sie nicht«, versetzte die junge Witwe, indem sie kummervoll ihre Hände niedersinken ließ. Lemor sah ihre tränenfeuchten Augen und schrieb diese Bewegung einer falschen Ursache zu.
»O, ja!« sagte er, »ich bin schuldig. Ihr Schmerz lässt mich die Gewissensbisse, deren Schuld ich trage, erraten. Diese vier Wochen kamen mir so lang vor, dass ich nicht den Mut hatte, mir zu sagen, dass sie kurz seien. Deswegen hatte ich Sie heute Morgen kaum um die Erlaubnis gebeten, Sie zu sehen, als ich es schon bereute. Ich errötete über meine Feigheit, ich machte mir alle die Gewissensskrupel zum Vorwurf, welche ich Sie zu unterdrücken zwang, und als ich Ihre ebenso ernste, als gütige Antwort erhielt, sah ich ein, dass Sie mich nur noch aus Mitleid sehen wollen.«
»O Heinrich, wie weh tun Sie mir mit einer solchen Sprache! Soll das ein Spiel, ein Vorwand sein? Warum verlangten Sie, mich zu sehen, da Sie mit so wenig Liebe und Vertrauen zu mir kommen?«
Der Jüngling bebte und warf sich abermals vor seiner Geliebten nieder.
»Ich will Sie lieber stolz und vorwurfsvoll sehen«, sagte er, »als so. Ihre Güte tötet mich!«
»Heinrich, Heinrich!« rief Marcelle aus. »Sie haben also ein Unrecht gegen mich begangen? O, Ihre Miene ist die Miene eines Schuldigen! Sie haben mich vergessen oder verkannt, ich sehe es wohl!«
»Weder das eine noch das andere. Zu meinem ewigen Unglück achte ich Sie, bete ich Sie an, glaube ich an Sie, wie an Gott, kann ich auf der weiten Erde nur Sie lieben!«
»Wohl«, versetzte die junge Frau, indem sie ihre Arme um den gebräunten Hals des armen Heinrich legte, »es ist kein so großes Unglück, mich so zu lieben, denn ich liebe Sie nicht minder. Hören Sie mich, Heinrich. Ich bin frei, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe den Tod meines Mannes so wenig gewünscht, dass ich mir niemals erlaubte, daran zu denken, was ich wohl mit meiner Freiheit anfangen würde, wenn sie mir werden sollte. Sie wissen das, wir haben niemals davon gesprochen, Sie wissen auch schon lange, dass ich Sie leidenschaftlich liebe und dennoch ist es heute zum ersten Mal geschehen, dass ich es so offen gegen Sie aussprach. – Aber, mein Freund, wie bleich Sie sind! Wie eisig Ihre Hände! Sie scheinen zu leiden, Sie erschrecken mich!«
»Nein, nein, reden Sie, reden Sie!« erwiderte Lemor, unter der Last der süßesten und zugleich qualvollsten Eindrücke erliegend.
»Gut«, fuhr Frau von Blanchemont fort, »ich habe keineswegs die Skrupel und Gewissensbisse, welche Sie mir unterlegen. Als man mir den blutigen Leichnam meines Mannes, der um einer andern Frau willen im Duell gefallen, brachte, ward ich, ich gesteh’ es, von Bestürzung und Entsetzen erfasst; indem ich Ihnen diese grässliche Neuigkeit mitteilte und Ihnen sagte, Sie möchten sich einige Zeit über von mir fern halten, glaubte ich, eine Pflicht zu erfüllen; o, wenn es ein Verbrechen ist, diese Zeit lang gefunden zu haben, so hat mich Ihr pünktlicher Gehorsam streng genug bestraft! Aber während des Monats, wo ich so zurückgezogen lebte, einzig damit beschäftigt, meinen Sohn zu erziehen und nach meinen Kräften die Eltern des Herrn von Blanchemont zu trösten, habe ich mein Herz genau erforscht und konnte es nicht schuldig finden. Ich hatte diesen Mann nicht lieben können, welcher mich nie geliebt, und alles, was ich zu tun vermochte, war, seine Ehre zu achten. Gegenwärtig zolle ich seinem Andenken nur noch eine äußerliche, durch die Umstände gebotene Achtung. Ich werde Sie nur insgeheim und selten sehen, es muss so sein, bis meine Trauerzeit vorüber ist und dann in einem in zwei Jahren —«
»Dann, Marcelle, dann – in zwei Jahren?«
»Sie fragen mich, was wir einander sein werden, Heinrich? Sie lieben mich nicht mehr; ich wusste es wohl.«
Dieser Vorwurf bewegte Heinrich nicht. Er verdiente ihn so wenig! Mit ängstlicher Aufmerksamkeit den Worten seiner Geliebten lauschend, bat er sie, fortzufahren.
»Wohl denn«, fuhr sie fort, mit der Schamhaftigkeit eines jungen Mädchens errötend, »wollen Sie mich denn nicht heiraten, Heinrich?«
Heinrich ließ sein Haupt auf Marcelles Knie sinken und verharrte so einige Augenblicke, wie vor Freude und Dankbarkeit außer sich, aber bald wieder fuhr er heftig auf und die tiefste Verzweiflung malte sich auf seinen Zügen.
»Haben Sie denn in der Ehe nicht allzu traurige Erfahrungen gemacht?« fragte er mit einer Art von Härte, »und wollen Sie sich noch einmal unter das Joch beugen lassen?«
»Sie flößen mir Furcht ein«, sagte Frau von Blanchemont nach einem Augenblick schreckhaften Stillschweigens. »Verspüren Sie denn in sich tyrannische Gelüste oder fürchten Sie für sich das Joch einer ewigen Treue?«
»Nein, nein, nichts von alledem«, versetzte Lemor niedergeschlagen. »Was ich fürchte, ist, dass es mir unmöglich, Sie oder mich selbst zu unterwerfen. Sie wissen es: aber Sie wollen, Sie können das nicht verstehen. Wir haben hierüber so viel gesprochen zu einer Zeit, wo wir nicht im Entferntesten daran dachten, dass diese Erwägungen eines Tages uns persönlich angehen, ja dass sie für mich eine Lebensfrage werden würden.«
»Ist’s möglich, Heinrich? Bis zu diesem Grade hätten Sie sich in Ihre Utopien verrannt? Wie, selbst die Liebe sollte diese Chimären nicht beilegen können? Ach, wie schwach ist eure Liebe, ihr Männer!« setzte sie mit einem tiefen Seufzer hinzu. »Im Falle nicht das Laster eure Seelen austrocknet, so tut es die Tugend, und immerfort, möget ihr nun elende oder erhabene Charaktere sein, liebt ihr nur euch selbst.«
»Hören Sie mich, Marcelle. Wenn ich Sie vor Monatsfrist gebeten hätte, Ihre Grundsätze zu vergessen, wenn meine Liebe von Ihnen das erfleht hätte, was Ihre Religion und Ihr Glaube Sie als eine ungeheure unsühnbare Schuld ansehen ließ —«
»Sie haben das nicht gefordert, Heinrich«, unterbrach ihn Marcelle errötend.
»Weil ich Sie viel zu sehr liebte, um Sie um meiner willen leiden und weinen zu machen. Aber wenn ich es getan hätte, Marcelle, antworten Sie doch, wenn ich es getan?«
»Diese Frage ist unzart und gar nicht am Platze«, versetzte sie, sich zu einer Bewegung voll liebenswürdiger Koketterie zwingend, um der Antwort auszuweichen. Ihre Grazie und Schönheit machten Lemor erbeben. Er presste sie leidenschaftlich an sein Herz. Aber sogleich wieder diesem Moment der Trunkenheit sich entreißend, erhob er sich und wiederholte, heftigen Schrittes vor der Geliebten auf und ab gehend, mit erhöhter Stimme:
»Und wenn ich Sie jetzt bäte, mir dieses Opfer zu bringen, welches der Tod ihres Gatten plötzlich ungefährlich, weniger schrecklich, weniger furchtbar gemacht?«
Frau von Blanchemont wurde blass und ernsthaft und versetzte:
»Heinrich, dieser Gedanke muss mich notwendig im tiefsten Herzensgrund beleidigen und verwunden, in dem Augenblick, wo ich Ihnen meine Hand anbiete und Sie dieselbe auszuschlagen scheinen.«
»Ich bin doch recht unglücklich, mich nicht verständlich machen zu können und für einen Elenden angesehen zu werden, gerade dann, wenn ich den ganzen Heroismus der Liebe in mir fühle. Dies Wort wird Ihnen ehrsüchtig vorkommen und muss Sie mitleidig lächeln machen. Und doch ist es wahr … und Gott wird mir einst in Rechnung bringen, was ich leide … es ist entsetzlich … es übersteigt vielleicht bald meine Kräfte.«
Und er brach in Tränen aus. Der Schmerz des Jünglings war ein so tiefer und ehrlicher, dass Frau von Blanchemont erschrak. Es war in diesen heißen Tränen etwas, das einer unbesieglichen Abneigung gegen das Glück, einem Lebewohl für alle die Illusionen der Liebe und Jugend glich.
»O, mein geliebter Heinrich«, rief Marcelle aus, »was für ein Unheil wollen Sie denn über uns beide verhängen? Warum verzweifeln, jetzt, da Sie der Herr meines Lebens sind, da nichts mehr uns hindert, einander vor Gott und den Menschen anzugehören? Oder steht etwa mein Sohn hinderlich zwischen uns? O, Sie haben eine so große Seele, dass Sie wohl einen Teil der Zuneigung, welche Sie für mich hegen, auf ihn übergehen lassen können.«
»Ihr Sohn?« entgegnete Heinrich schluchzend. »Ich hege eine viel gewichtigere Besorgnis, als die, ihn nicht lieben zu können. Ich fürchte, ihn nur allzu sehr zu lieben und nicht ruhig zusehen zu können, wenn er sein Leben in einem von meinen Ansichten abweichenden Sinne verbringt. Sitte und Herkommen würden mich zwingen, ihn der Welt zu überlassen und ich möchte ihn ihr doch entreißen … nein, ich vermöchte ihn nicht mit solcher Gleichgültigkeit und Selbstsucht zu betrachten, um aus ihm einen Menschen werden zu lassen, wie seine Standesgenossen sind; … nein, nein! … Dies und anderes und alles in Ihrer Stellung und der meinigen türmt uns ein unübersteigliches Hindernis entgegen… Von welcher Seite ich immer unsere Zukunft ins Auge fasse, kann ich in ihr nur einen wahnwitzigen Kampf erblicken, Unglück für Sie, Fluch für mich. Es ist unmöglich, Marcelle, für immer unmöglich! Ich liebe Sie zu innig, um von Ihnen Opfer anzunehmen, deren Resultate Sie nicht vorhersehen, deren Ausdehnung Sie nicht ermessen können. Sie kennen mich nicht, ich sehe es wohl, Sie halten mich für einen unentschlossenen und schwachen Träumer. Ich bin aber ein entschlossener und unverbesserlicher Träumer. Sie haben mich vielleicht manchmal der Affektation beschuldigt, Sie haben geglaubt, dass ein Wort von Ihnen hinreichte, mich zu dem zurückzuführen, was Sie für vernünftig und wahr halten. O, ich bin weit unglücklicher, als Sie wähnen, und ich liebe Sie viel heißer, als Sie dermalen begreifen können. Später… ja, später werden Sie mir im Grund ihres Herzens dafür danken, dass ich es verstand, allein unglücklich zu sein.«
»Später? Und warum? Wann denn? Was wollen Sie sagen?«
»Später, sage ich Ihnen, wann Sie erwacht sein werden aus diesem finstern und unseligen Traum, womit ich Sie umsponnen, wann Sie zurückgekehrt sein werden in die Welt und die leichten und süßen Berauschungen derselben teilen, endlich, wann sie nicht mehr ein Engel sein, sondern herabgestiegen sein werden zur Erde!«
»Ja, ja, wann ich werde ausgedörrt sein durch die Selbstsucht und verdorben durch die Schmeichelei. Das wollten Sie sagen, das prophezeien Sie mir! In Ihrem wilden Stolz halten Sie mich für unfähig, Ihre Ideen zu fassen und Ihr Herz zu verstehen. Sprechen Sie das Wort aus: Sie betrachten mich als Ihrer unwürdig, Heinrich!«
»Was Sie sagen ist entsetzlich, gnädige Frau, und dieser Streit darf nicht länger dauern. Lassen Sie mich fliehen, denn wir können uns jetzt nicht verständigen.«
»Und so wollen Sie mich verlassen?«
»Nein, ich verlasse Sie nicht, denn auch fern von Ihnen trage ich Ihr Bild in mir und verwahre es in dem Tabernakel meines Herzens. Ich werde meinen Kummer zu tragen wissen, aber in der Hoffnung, dass Sie mich vergessen werden, mit der Reue, Ihre Zuneigung ersehnt und gesucht zu haben, aber auch mit dem Trost, dass ich diese Zuneigung wenigstens nicht niederträchtig gemissbraucht.«
Frau von Blanchemont war aufgestanden, um den Geliebten zurückzuhalten, allein wie vernichtet fiel sie auf die Bank zurück und sagte, als sie sah, dass er sich entfernen wollte, mit kaltem, beleidigtem Ton:
»Aber weswegen haben Sie mich denn zu sehen verlangt!«
»Ja, ja, Sie haben ein Recht zu diesem Vorwurf. Es ist dies eine letzte Schwachheit von mir. Ich empfand das Bedürfnis, Sie noch einmal zu sehen, und gab ihm nach… Ich hoffte, es werde in Ihren Gefühlen gegen mich eine Veränderung vorgegangen sein, Ihr Schweigen machte mich dies glauben… ich war von Kummer verzehrt und glaubte in Ihrer Kälte die Stärke zu finden, die Fesseln meiner Liebe zu zerbrechen. Warum bin ich gekommen? Warum lieben Sie mich? Bin ich nicht der einfältigste, undankbarste, wildeste, hassenswerteste der Menschen? Aber es ist besser, dass Sie mich so sehen, dass Sie erfahren, Sie hätten meinen Verlust nicht zu bedauern. Es ist besser so und ich tat recht zu kommen… nicht wahr?«
Heinrich hatte dies in einer Anwandlung von Verzweiflung gesprochen, seine ernsten und reinen Züge waren verstört, seine sonst harmonische und sanfte Stimme hatte einen harten, schrillenden Klang angenommen, dass sie dem Ohr wehtat. Marcelle sah seinen Schmerz deutlich, aber ihr eigener war so stechend, dass sie nichts tun oder sagen konnte, was Ihnen gegenseitig Erleichterung verschafft hätte. Bleich und stumm, mit krampfhaft verschlungenen Händen bewegungslos dasitzend, glich sie einer Statue. Im Begriff, sich zu entfernen, wandte sich Heinrich nach ihr um und ihr Anblick ließ ihn zurückkehren, sich zu ihren Füßen werfen und dieselben mit Tränen und Küssen bedecken.
»Lebe wohl«, sagte er, »schönste und reinste der Frauen, gütigste der Freundinnen, hochherzigste der Geliebten! Möchtest du ein des deinigen würdiges Herz finden, einen Mann, der dich liebt, wie ich dich liebe, und nicht Trostlosigkeit und Verabscheuung des Lebens dir zur Mitgift bringt. Möchtest du glücklich sein und segenspendend, ohne die Kämpfe einer Existenz, wie die meinige ist, durchmachen zu müssen, und möchtest du endlich, wenn in der Welt, in welcher du lebst, noch ein Funke von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sich findet, denselben mit deinem göttlichen Hauch zur Flamme anblasen und vor Gott Gnade finden für deine Kaste und für dein Jahrhundert, welches zu erlösen du allein würdig bist!«
So sprechend, stürzte Heinrich hinweg, vergessend, dass er Marcelle in Verzweiflung zurückließ. Er schien von den Furien gehetzt zu sein. Frau von Blanchemont blieb lange wie versteinert. Endlich kehrte sie in ihre Wohnung zurück und ging bis zum Morgen mit leisen Schritten in ihrem Gemach auf und ab, ohne eine Träne zu vergießen, ohne mit einem Seufzer das Schweigen der Nacht zu stören.
Es wäre Verwegenheit, zu behaupten, dass diese junge Witwe von zweiundzwanzig Jahren, schön, reich und in der Gesellschaft durch Grazie, Talente und Geist glänzend, wie sie war, nicht tief gedemütigt und gekränkt worden wäre dadurch, dass ein Mann ohne Geburt, ohne Vermögen, ohne irgendeine Auszeichnung, ihre Hand ausgeschlagen. Der beleidigte Stolz der jungen Frau diente, statt des ihr mangelnden Mutes, trefflich dazu, sie aufrecht zu erhalten. Allein bald führte der wahrhafte Adel ihrer Gefühle sie zu viel ernsteren Gedanken, und zum ersten Mal warf sie jetzt einen tieferen Blick aus ihr eigenes Leben und aus das ihrer Umgebungen. Sich alles ins Gedächtnis zurückrufend, was Heinrich zu verschiedenen Zeiten zu ihr gesagt, als zwischen ihnen noch von nichts anderem die Rede sein konnte, als von einer hoffnungslosen Liebe, musste sie erstaunen, dass sie das nicht ernster genommen habe, was sie da, als für romanhafte Ideen des jungen, wahrhaft biedern Mannes gehalten hatte. Sie begann ihn mit jener Ruhe zu beurteilen, welche ein edler und starker Wille inmitten der heftigsten Bewegungen des Herzens wiederbringt. In dem Maße, in welchem die Nacht verlief und die Uhren der Nachbarschaft mit ihrer silbertonigen Stimme eine Stunde nach der andern über die große, schlummerbefangene Stadt hinriefen, gelangte Marcelle zu jener Erleuchtung des Geistes, womit die Sammlung einer langen Nachtwache die Stelle des Schmerzes ersetzt.
Erzogen in ganz andern Lebensansichten als die, welche Lemor hatte, hatte es das Schicksal dennoch gefügt, dass sie die Liebe dieses Plebejers teilen und in derselben eine Zuflucht suchen sollte gegen die Langeweile und die Traurigkeit des aristokratischen Lebens. Sie war eine jener zugleich zarten und starken Seelen, welche das Bedürfnis der Hingebung empfinden und kein anderes Glück kennen, außer dem, welches sie selbst geben. Unglücklich in ihrer Ehe, gelangweilt von der Gesellschaft, hatte sie sich mit dem romanhaften Vertrauen eines jungen Mädchens dieser Liebe überlassen, welche ihr gar bald zu einer Religion geworden. Aufrichtig fromm, musste sie für einen Liebhaber, welcher ihre Skrupel achtete und ihre Keuschheit ehrte, leidenschaftlich eingenommen werden. Ihre Frömmigkeit selbst hatte sie für diese Liebe begeistert und sie zu dem Entschlusse getrieben, dieselbe durch unauslösliche Bande zu heiligen, sobald sie sich frei sah. Sie hatte mit Freude daran gedacht, die materiellen Vorteile, welche die Welt so hoch anschlägt, mutig zum Opfer zu bringen, und nicht minder die eingebildeten Vorrechte der Geburt, welche ihr Urteil nie hatten irreführen können. Sie glaubte, viel zu tun, das arme Kind, und sie hätte in der Tat viel getan, denn die Welt hätte sie entweder darob geschmäht oder verhöhnt. Sie hatte nicht vorhergesehen, dass dies alles nichts sei und dass der Stolz des Plebejers ihr Opfer fast wie eine Beleidigung aufnahm.
Mit einmal von Schrecken und Schmerz, sowie von dem Widerstand Lemors erleuchtet, wiederholte sich Marcelle alles, was sie von der sozialen Krise vernommen, welche unser Jahrhundert in Bewegung setzt. Es ist dieser Gegenstand dem Gedankenkreis hochgestellter Frauen dermalen kein fremder mehr und kann es nicht sein. Sie alle können, je nach dem Grade ihrer Bildung und ihrer Einsicht, ohne affektiert zu erscheinen, ohne lächerlich zu werden, unter allen möglichen Formen, in Journalen und Revuen, in philosophischen, politischen und poetischen Werken immer wieder das große, traurige, widerspruchsvolle und doch so tiefe und bedeutungsvolle Buch der Gegenwart und ihrer Probleme wiederfinden und lesen. Marcelle wusste also ebenso gut, wie wir alle, dass unsere schlaffe und kranke Gegenwart im Streite liegt mit der Vergangenheit, von welcher sie rückwärts gezogen, und mit der Zukunft, von welcher sie vorwärts gerufen wird. Sie sah gewaltige Blitze über ihrem Haupt sich kreuzen und vermochte eine große Umwälzung in näherer oder entfernterer Zeit vorauszusehen. Sie war keine kleinmütige Natur, sie hatte keine Furcht und schloss nicht die Augen. Die Klagen, die Schrecken, die Vorwürfe und Beschuldigungen ihrer Großeltern hatten sie so sehr unempfänglich für die Furcht gemacht! Die Jugend ist nicht gewillt, ihre Blütezeit zu verwünschen, und die Jahre ihrer Reize sind ihr teuer, seien sie auch von Stürmen getrübt. Die zärtliche und mutvolle Marcelle sagte sich, dass man bei Donner und Hagel unter dem Schutz des ersten besten Strauches lächeln könne, so einem das Wesen, das man liebe, zur Seite wäre. Der drohende Kampf der materiellen Interessen erschien ihr demzufolge nur als ein Spiel. ›Was tut es, ruiniert, exiliert, eingekerkert zu werden?‹ fragte sie sich, wenn sie in ihrer Umgebung den ahnungsvollen Schrecken über den anscheinend Glücklichen des Jahrhunderts schweben sah; die Liebe wird man nicht verbannen können und, ›was mich betrifft, so liebe ich ja, Dank dem Himmel! einen Proletarier, welcher verschonet bleiben wird.‹ Nur daran hatte sie nicht gedacht, dass durch diesen dumpfen und geheimnisvollen Kampf, welcher sich vollenden wird, allen offiziellen Gewaltmaßregeln einerseits und aller scheinbaren Entmutigung andererseits zum Trotz, ihre Neigungen bis ins innerste Mark getroffen werden könnten.
In diesem Kampf der Gefühle und der Gedanken, welcher gegenwärtig bereits heftig sich entfacht hat, sah sich Marcelle mitten aus ihren Illusionen herausgestürzt, so plötzlich, wie man aus einem Traum auffährt. Der intellektuelle und moralische Krieg war zwischen den verschiedenen, von entgegengesetzten Überzeugungen und Leidenschaften geleiteten Klassen erklärt und Marcelle sah in dem Manne, welcher sie anbetete, eine Art von unversöhnlichem Feind. Anfangs in Schrecken gejagt von dieser Entdeckung, machte sie sich vertraut mit den neuen Ideen, welche ihr dann vorher ungeahnte, noch edlere und romantischere Aussichten eröffneten als die, welche sie sich seit einem Monat geschaffen, und als sie endlich den langen nächtlichen Spaziergang durch ihre einsamen und schweigenden Gemächer beendigte, hatte sie die Ruhe zu einem Entschluss gewonnen, welchen vielleicht nur sie allein ohne ein Lächeln der Bewunderung oder des Mitleids ins Auge fassen konnte.