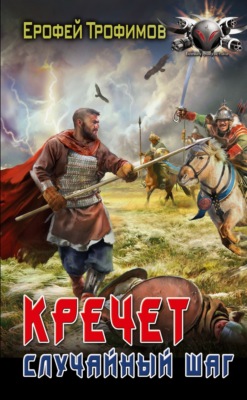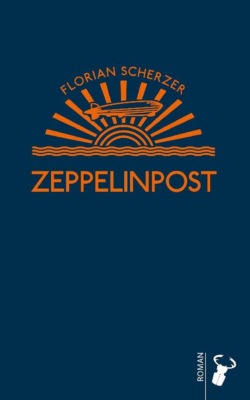Buch lesen: "Zeppelinpost"


1. Auflage, September 2019
Text, Gestaltung: Florian Scherzer
Gedruckt in der EU
© Hirschkäfer Verlag, München 2019
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-940839-62-6
Besuchen Sie uns im Internet:
www.hirschkaefer-verlag.de




Inhalt
Kapitel 0
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73

Therese, nur du hast mir das letzte Jahr lebenswert gemacht. Verzeih, dass ich dich töten musste.
Im Jahr 1997 wurde das sogenannte Karl-Valentin-Haus in der Zeppelinstraße 41 im Münchner Viertel Au renoviert. Dabei wurde in einem Kellerabteil des Vorderhauses neben vielen anderen Gegenständen, Möbeln und Müll aus den über hundert Jahren davor, ein ramponierter Schreibtisch gefunden. Der Entrümpler hielt ihn für wertlos und verkaufte ihn zusammen mit einigen anderen Möbeln aus dem Haus für zehn Mark weiter. Der Tisch landete in der Werkstatt des Restaurators Kagerer in der Rumfordstraße und wartete dort über zwanzig Jahre darauf, weggeworfen oder hergerichtet zu werden.
Als es endlich soweit war, begann der Restaurator als Erstes damit, die stark verklemmte Schublade mühselig herauszulösen. In der Hoffnung, dort einen kleinen Schatz zu finden. Münzen oder alte Geldscheine, die sich noch an Sammler verkaufen ließen. Das passierte nicht gerade selten. Zwar eher in Nachtkästchen oder Bettgestellen als in Schreibtischen, aber man wusste ja nie. Schließlich konnte man es sogar klappern hören, wenn man den Tisch rüttelte. In der Schublade war aber nichts als ein einzelner sehr dicker Briefumschlag mit vielen maschinengeschriebenen Seiten darin. Zwischendrin hand- und maschinengeschriebene Briefe, an deren Rand kleine Zettel geklebt waren, die offenbar einzelne Passagen der Briefe kommentierten. Das Kompendium war die ausführliche Lebensbeichte eines Carl Dürrnheimer. Die eigentlich viel interessantere Geschichte aus dem Haus in der Zeppelinstraße 41. Spannender als die Lausbubengeschichten aus der Jugend von Karl Valentin. Aber dafür deutlich weniger lustig.
Kagerer schenkte das Bündel Papier meinem Cousin, als er ihm den aufpolierten Schreibtisch für sein erstes Büro abkaufte. Der schenkte es mir, weil »du dich doch für so Historisches interessierst«. Ich las es und wollte meine Facharbeit am Gymnasium darüber schreiben. Mein Geschichtslehrer war dagegen und ich beschloss, im Studium oder später mal irgendeine Arbeit darüber zu schreiben. Irgendwann.
Als ich viele Jahre später unseren Keller räumen musste, weil seit Jahren Abwasser ins Mauerwerk gesickert war und alles renoviert werden musste, fiel mir dieses überraschend gut erhaltene Bündel Papier in die Hände. Gleich daneben fand ich, deutlich aufgeweichter, meinen Collegeblock mit meinen sehr kryptischen Aufzeichnungen von damals, als ich noch dachte, dass dies das Thema meiner Facharbeit sein würde.
Mein Kind ist nun groß genug, um meistens alleine zurechtzukommen, die Frau arbeitet Vollzeit, und ich habe plötzlich Freiräume, die es mir ermöglichen, alles noch einmal von Neuem anzusehen, zu lesen und dieses Buch daraus zu machen:

1
München, im April 1933
Mein Name ist Carl Dürrnheimer. 31 Jahre. Geboren am 12. Februar 1902 in Neustadt an der Haardt/Pfalz (Kgr. Bayern). Wohnhaft Zeppelinstraße 41 in München.
Ich werde in den nächsten Stunden verhaftet werden und bin mir sicher, dass ich in den folgenden Wochen wegen des Mordes an meiner Verlobten Therese Aumiller zum Tode verurteilt werde. Oder zumindest zu lebenslänglich. Ich werde mich nicht gegen das Urteil wehren und während des Prozesses schweigen. Wenn es denn einen gibt. Das weiß man ja heutzutage nicht mehr. Ich habe mich zu sehr in einem undurchdringlichen Geflecht aus Geschichten und Erfundenem verstrickt, um jemals mit der Wahrheit glaubwürdig zu sein. Ich wüsste gar nicht, wie ich in dieser Situation noch meine Unschuld beweisen könnte. Das haben mir die beiden Polizisten mehr als deutlich gemacht. Es ist leichter, mich meinem Schicksal zu ergeben als zu kämpfen. Ich bin auch zu erschöpft, um mich noch groß gegen Ermittler und Staatsanwälte aufzubäumen. Mein Leben mit Therese war so erfüllt, dass es mir nicht schwerfällt, einfach auch zu verschwinden, jetzt, wo sie weg ist. Ohne Therese hat mein Leben ohnehin keinen Inhalt mehr. Das muss ich mir eingestehen. Nichts würde mein Weiterleben rechtfertigen. Was soll auch nach diesem wundervollen Jahr mit ihr noch kommen?
Ich schreibe dies, um die Wahrheit von der Seele zu haben. Ohne die Hoffnung, dass dieser Zettelhaufen jemals zu meiner Rehabilitierung beitragen könnte. Ich bin es Therese einfach schuldig, alles niederzuschreiben. Ich schreibe alles nach
bestem Wissen und Gewissen auf. Aber auf mein Gedächtnis ist Verlass. Vielleicht können Sie mich ja ein klein wenig verstehen und merken, dass es Ihnen in meiner Situation nicht anders gegangen wäre.

2
Ich wurde im Jahr 1902 als einziges Kind des Ehepaars Dürrnheimer in Neustadt an der Haardt in der bayerischen Pfalz geboren. Ich hatte wahrscheinlich eine sehr glückliche frühe Kindheit. Meine Erinnerungen daran sind natürlich sehr verschwommen und undeutlich. Deshalb weiß ich es nicht mehr so genau. Aber neben jenen an die Zeiten mit Therese, sind es die schönsten Erinnerungen meines Lebens.
Wir wohnten in einem Haus mit Garten. Die Mutter war für mich da, es gab Nachbarskinder, Tiere, eine Sandkiste und eine Teppichstange zum Turnen. Alles, was sich ein kleiner Bub wünscht. So hat es jedenfalls die Mutter immer erzählt, und so wirkt es auf den wenigen Fotografien, die von damals noch existieren. Ich selbst erinnere mich nur verschwommen an ein Versteck in einem Gebüsch, einen toten Vogel, den wir beerdigten und Lurche oder Molche in einem großen Weckglas. Eine normale Kindheit in einer frohen und zufriedenen Familie. So, wie man es den meisten Menschen wünscht.
In meinen Erinnerungen an den Vater, saß dieser immer in seinem Arbeitszimmer in der oberen Etage und erfand Kreuzworträtsel oder Zahlenrätsel für Zeitungen und Zeitschriften. Ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich sein Beruf oder nur eine Nebenbeschäftigung war. Oder ob er mir als Kind nicht erklären konnte, was er wirklich tat. Offenbar war mit seiner Arbeit nicht viel Geld zu verdienen, denn wir verhielten uns zwar gutbürgerlich, waren jedoch in Wirklichkeit eher arm. Meine Mutter war gelernte Laborantin, aber sie kümmerte sich ausschließlich um mich, ihr einziges Kind. Vielleicht wäre es uns besser gegangen, hätte sie gearbeitet und mein Vater wäre bei mir geblieben. Sie hätte bestimmt, obwohl sie nur eine Frau war, mehr Geld nach Hause gebracht als der Vater. Meine Eltern waren sehr liebevoll und fürsorglich. Manchmal zu sehr, manchmal zu wenig. Wie die meisten Eltern wären, wenn sie könnten.
1908 mussten wir nach München ziehen. Er habe eine neue Arbeit angeboten bekommen, die er nicht ausschlagen könne, sagte der Vater. Erst große Vorfreude, dann ein Schock für ein Kind aus der Kleinstadt.
Für eines der modernen, neuen und wohlhabenden Viertel wie Schwabing reichte es natürlich nicht, deshalb zogen wir in das Arbeiterviertel Au. In die Nachbarwohnung der Wohnung, in der die Familie Fey gewohnt hatte. Die Familie des Münchner Komikers Karl Valentin. Das ganze Haus in der Zeppelinstraße, die damals noch Entenbachstraße hieß, hatte ursprünglich den Feys gehört. 1906 jedoch waren Karl Valentin und seine Mutter, nach dem Tod des Vaters und der Pleite der familiären Spedition, nach Zittau umgezogen, und das Haus gehörte von da an erst Adolf Weiß und ab 1910 Ludwig Weinberger. Das wussten weder meine Eltern noch ich. Es hätte uns auch nicht interessiert. Erst nach dem Krieg, als ich einen der Filme Valentins im Kino sah, sagte mir eine Nachbarin, dass er hier im Haus gewohnt hatte.
Als Sechsjähriger war ich begeistert, als ich während der Zugfahrt nach München erfuhr, dass wir in die Entenbachstraße ziehen sollten. Ich erinnere mich noch genau an meine Vorstellung von einem kleinen Bach voller Fische und Enten, an dessen Ufer ich mit meinen neuen Münchner Freunden spielen konnte. Und ich weiß auch noch, wie enttäuscht ich gewesen bin, als ich die graue Stadtstraße von der Droschke aus sah. Ich sei wohl in Tränen ausgebrochen und habe einige Tage durchgeweint und wollte nicht auf die Straße, so erzählte es mir meine Mutter einige Jahre später. Die Entenbachstraße wurde 1910 in Zeppelinstraße umbenannt. Das machte es aber nicht besser. Obwohl ich sagen muss, dass der Name bei dem, worüber ich hier noch schreiben werde, eine gewisse Rolle spielt. Ohne den Straßennamen hätte ich wahrscheinlich nie Zeppelinpost bekommen.
Für mich, als behüteten, verhätschelten Kleinstadt-Buben, hatte sich mit dem Umzug nach München alles geändert. Alles war komplizierter, enger, unpersönlicher geworden und machte mir Angst. Meine Eltern konnten sich deutlich weniger um mich kümmern, und obwohl der Vater wohl mehr verdiente, waren wir doch ärmer, da in München alles teurer war als in der Pfalz.
Die Au war ein zu hartes Pflaster für ein Kind wie mich. Dort lebten fast ausschließlich Arbeiterfamilien mit meistens acht Kindern oder mehr. Während wir recht komfortabel auf drei Zimmern wohnten, hausten die Nachbarsfamilien oft alle zusammen in einem oder zwei Zimmern. Ich hatte zwar nicht viel Spielzeug, konnte aber wenigstens mit meinen Bauklötzen in meinen eigenen vier Wänden spielen oder so tun, als würde ich meine Kinderbücher lesen. Alle anderen Kinder waren immer in den Treppenhäusern unterwegs oder liefen bei jedem Wetter barfuß auf der Straße und in den Höfen herum.
Die ersten Monate nach unserer Ankunft in München wollte ich nur vom Fenster zur Straße aus den Kinder unseres Viertels zusehen und nicht selbst dabei sein. Mich gruselte vor den wild anmutenden Kinderbanden, die alle keine Schuhe trugen und einen komischen, kaum verständlichen Dialekt sprachen. Da war es mir deutlich angenehmer, nur vom Fenster aus zuzusehen, als mich selbst in die Höhle der Löwen zu wagen und mitzuspielen. Ich bitte Sie, stellen Sie sich einfach mal die Kinder aus der Au vor dem Krieg vor. Wild, unbeobachtet von den Eltern, schmutzig, arm und immer hungrig. Den Grammer und den Schneider, die endlos vielen Schmadererbrüder und die Wagners. Wunden an den Knien und Ellenbogen, ausschließlich Schimpfwörter benutzend. Wären Sie da so einfach mitgerannt? Ohne Angst? Aber was mir am meisten Respekt einflößte, waren die kahl rasierten Schädel der Buben. Läuse- und Flohprävention. Die Jungen wirkten auf mich wie die entlaufenen Sträflinge aus meinem Kinderbuch ›Der schwarze Peter‹. Ich wollte und konnte da nicht mitmachen. Vorerst, dachte ich. Irgendwann würde ich den Mut fassen und mit den fremden Kindern einfach sprechen und mitspielen. Aber das war nicht so. In diesen Wochen der Furcht legte ich den Grundstein für das Motto meiner Kindheit: Nicht dabei sein.
Als sich meine Mutter irgendwann dazu entschloss, mich auf die Straße zu zwingen, war es schon zu spät. Die anderen hatten mich im Zimmer hinter geschlossenen Fenstern sitzen gesehen, erkannt, dass ich wochenlang nicht mitspielen hatte wollen und mich aus ihrem Spielkameraden-Repertoire gestrichen. Ich weiß nicht, ob sie mich für hochnäsig oder verhätschelt oder schlichtweg uninteressant hielten. Vielleicht war es auch etwas ganz anderes.
Während sie sich die Knie aufschlugen, um Schusser wetteten und Abenteuer in den Hinterhöfen erlebten, wurde ich von keinem der Kinder in der Au überhaupt mehr wahrgenommen. Ich hatte mich irgendwann, als ich die Buben aus der Lilienstraße über unsere Hinterhofmauer klettern sah, runtergetraut und mich dazugestellt. Die Schmadererbrüder kickten einen toten Vogel hin und her, wie einen Fußball und die anderen lachten. Ich lachte mit und dachte, so das Eis brechen zu können. Aber es klappte nicht. Als die Jungen weiterliefen, rannte ich mit. Aber sie hängten mich ab. Später begegnete ich ihnen in der Zeppelinstraße wieder und fragte einen, wo sie gewesen seien. Er schaute nur zu den anderen und reagierte nicht weiter.
Ich ließ mich die ersten Wochen noch nicht entmutigen und versuchte weiterhin, Anschluss zu finden. Vergeblich. Ich
durfte nicht nur nicht mitspielen, sondern wurde noch dazu nicht einmal gehänselt oder gequält, wie man es von meiner Situation als Neuer und ›Schnösel‹ mit Schuhen und Mütze hätte erwarten können. Obwohl ich das eigentlich gar nicht war. Weder graute mir vor Schmutz noch hatte ich Angst vor Abenteuern, noch sprachen wir zu Hause Altgriechisch oder Siezten uns. Ich versuchte mir immer mehr bayerische Wörter und Phrasen anzueignen, damit ich wenigstens sprachlich zu den Originalauern passte. Auch meine Schuhe versteckte ich im Keller und ging nur noch barfuß nach draußen. Meine Mutter machten meine schmutzigen Fußsohlen nicht wütend, sondern sie weckten die Hoffnung in ihr, dass ich mich langsam mit den Kindern des Viertels anfreundete. Ihr war es lieber, dass ich Freunde hatte, als dass sie sich vor dem schlechten Einfluss der Straßenbuben fürchtete. Die Kinder ignorierten mich weiter und mein Wunsch dabei zu sein, wurde immer größer und brennender. Ein einziges Mal erlebte ich so etwas wie Aufmerksamkeit. Einer der Jungen stahl mir meine Mütze vom Kopf und warf sie in einen Baum, in der Hoffnung, dass sie in den Ästen hängenblieb. Immer wieder schmiss er die Mütze hoch, bis sie sich tatsächlich irgendwo nicht allzu weit oben in einem Ast verfing. Der Bub lachte, aber als die anderen nicht mit einfielen, hörte er wieder damit auf. Als gäbe es ein ungeschriebenes Gesetz, das den Kindern der Au verbot, mich wahrzunehmen: §123 Absatz 5. Jeglicher Kontakt zu Carl Dürrnheimer ist den Kindern der Zeppelinstraße, der Lilienstraße und des Kreuzplätzchens untersagt. Bei Zuwiderhandeln werden sie mit Gruppenausschluss auf unbestimmte Zeit bestraft. Im Laufe der Zeit entwickelte ich eine regelrechte Sehnsucht danach, wieder so geärgert oder gequält zu werden wie an jenem Tag. Lieber der Depp sein als der Niemand.
Meine Mutter gab mir jeden Morgen ein Fünferl mit auf den Weg in die Schule, von dem ich mir ein Nusshörnchen
kaufen konnte. So eine Art Trostpflaster, denke ich. Sie bekam ja mit, wie ich immer noch keinen Anschluss zu den anderen bekam. Das tägliche Hörnchen und mein nicht vorhandener Bewegungsdrang ließen mich dicklich werden. Aber nicht einmal mein unförmiger Körper brachte die Straßenkinder dazu, mich wahrzunehmen und zu hänseln. Wie gerne hätte ich einmal »He, schaut euch den Wambo an! Wir schmeißen ihm Steine nach, dann muss er rennen, der Gwamperte!« gehört oder wäre einmal mit Schnee eingeseift worden. Ich blieb aber stets nur der stumme Beobachter, von dem keiner zu wissen schien, dass er existierte.
Manchmal drängte ich mich den anderen Kindern sogar regelrecht auf und versuchte möglichst viel Angriffsfläche zu bieten. Ich zog bunte Hosenträger an, die ich auf dem Speicher gefunden hatte oder benutzte Ausdrücke wie ›mich dünkt‹ oder Wörter wie ›Gevatter‹. Oder ich versuchte besonders mutig und waghalsig zu sein und ließ mich extra beim Klingelputzen erwischen, um mit den Ohrfeigen, die ich von den Geärgerten bekam, anzugeben. Niemand hörte sich meine aufgeregten Erzählungen davon an. Oder ich ›stahl‹ für alle Nusshörnchen beim Bäcker (in Wirklichkeit kaufte ich sie). Sie wurden zwar gegessen, aber alle taten so, als wären die Hörnchen einfach aus dem Nichts aufgetaucht.
In der Schule war es nicht besser. Mein hochdeutsch eingefärbtes, immer ein wenig gekünstelt klingendes Bayerisch und die Tatsache, dass ich in der Schule auch im Sommer Schuhe trug, ließen meine Lehrer und die Mitschüler vermuten, dass ich aus ›gutem Hause‹ und deshalb besonders intelligent und gebildet war. Ich war aber eher unterdurchschnittlich talentiert. Noch dazu schwieg ich meistens im Unterricht und hatte keine schöne Handschrift. Ich schaffte es nur durch den Einsatz und den Ehrgeiz meines Vaters auf das Gymnasium. Der paukte den Schulstoff unter enormem Aufwand in mich hinein und dank irgendwelcher Verbindungen, die er zum Direktor des Theresien-Gymnasiums hatte, schaffte ich es dorthin. Dass er mich aufs Gymnasium schickte, machte mich aber nicht glücklicher. Es bedeutete für mich eine noch stärkere Trennung von den Kindern, die ich so gerne als Freunde gehabt hätte. Sie Volksschule, ich Gymnasium. Der Graben wurde unüberbrückbar. Immer wenn ich meinem Vater und dem endlosen Gepauke entkommen konnte, floh ich aus der engen Wohnung in die Hinterhöfe und versuchte weiterhin, mich bei den Straßenkindern des Viertels anzubiedern. Weiterhin ohne Erfolg.
3
Anfangs auf dem Gymnasium, in der Sexta, versuchte ich mich bei meinen neuen Mitschülern einzuschmeicheln. Ich wollte neu anfangen und alles anders machen als vier Jahre zuvor. Also stellte ich mich dort als verwegener Auer Bub dar, der nur zufällig auf dem Gymnasium gelandet war. Ich sprach so breit Bayerisch, wie ich nur konnte, spuckte andauernd auf den Boden und zog mich sogar so an, wie ich es bei den anderen Kindern in der Au gesehen hatte. Nur den rasierten Schädel traute ich mich nicht. Das brachte mir anfangs auch Aufmerksamkeit und einiges an Respekt. Ich erzählte von meinen Erlebnissen im Glasscherbenviertel Au, und die Kinder aus den Villen rund um die Theresienwiese machten große Augen. Ich berichtete vom Klingelputzen, vom Stehlen, von toten Tieren, die wir fanden und zerlegten und vom Bier, das wir heimlich tranken. Ein echter Gesetzloser. Damit konnte ich auch meine schlechten Noten begründen. Ich habe so viel mit meinem Rabaukentum zu tun, dass ich nicht zum Lernen komme, erzählte ich in der Klasse herum. In Wirklichkeit büffelte mein Vater viel und oft mit mir. Es brachte aber nichts. Der Aufwand, den wir für einen Vierer in Latein oder Mathematik treiben mussten, stand in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Zur Einschulung auf dem Gymnasium hatte mir mein Vater die Bücher von Tom Sawyer und Huckleberry Finn geschenkt. Es waren zwei der wenigen Bücher, die ich gerne und ohne dazu gezwungen zu werden las. Der Junge Tom gefiel mir, und ich wollte gerne so verwegen und beliebt sein wie er. Also verwendete ich die Geschichten, die ich wieder und wieder im Buch las und erzählte sie mit ausgetauschten Namen und Orten meinen Mitschülern am Gymnasium. Wenn ich heute so darüber nachdenke, griff ich damit dem, was achtzehn Jahre später passieren sollte vorweg. Scheinbar ein weiteres Prinzip meines Lebens. Ich erfand einen eigenen Huckleberry Finn und nannte ihn nach einem Buben aus der Lilienstraße, den ich sehr bewunderte, Grammer Georg. Indianer-Joe wurde zum zwielichtigen Juden Goldberg mit seinem koscheren Laden in der Humboldtstraße. Der entlaufene Sklave Jim aus dem zweiten Buch wurde zu einem unschuldig inhaftierten und dann entlaufenen Häftling aus Stadelheim, von dem ich in der Zeitung gelesen hatte und der in meinen Erzählungen unter der Wittelsbacherbrücke hauste. Becky Thatcher nannte ich Regina Thalhammer, wie die Tochter einer Bekannten meiner Mutter, und die Isarauen in der Flaucherwildnis wurden zu meinem Mississippi. Ich verwendete die Geschichte mit der toten Katze und dem Warzenzauber aus Tom Sawyer, dem Zaunstreichen und dem toten Muff Potter (bei mir: Matthias Pottner).
Erst als ich eines Tages erzählte, dass mein Huckleberry und ich vorhatten, Isarpiraten zu werden, wurde einer meiner Mitschüler skeptisch und brachte am nächsten Tag seine Ausgabe des Tom Sawyer mit. Er zeigte die entsprechenden Stellen in der Klasse herum. Mein Kartenhaus fiel in sich zusammen, und ich musste mich selbst ins innere Klassenexil begeben, um nicht vollends zum Klassendeppen zu werden. Diesmal war ich selbst die Ursache für meine Einsamkeit und mein Außenseitertum. Ich denke, dass es damals hätte klappen können, mit dem Anschlussfinden. Aber ich wollte zu schnell, zu viel Aufmerksamkeit und Im-Mittelpunkt-Stehen.
Die kurzzeitige Beliebtheit bei den Klassenkameraden hatte mir gezeigt, dass ich nicht ohne Beachtung leben wollte. Ich war zu allem bereit, um vom Unsichtbaren zum Sichtbaren zu werden. Ob gute oder schlechte Aufmerksamkeit spielte keine Rolle, Hauptsache ich existierte.
Das Gymnasium war dafür verbrannte Erde. Also versuchte ich mich wieder an den Kindern in der Au. Neuer Versuch, neues Glück, dachte ich, pirschte mich wieder an die Straßenbuben heran und schloss mich an meinen freien Nachmittagen und an den Sonntagen ungefragt den Buben aus der Lilienstraße, dem großen Grammer (dem Vorbild für meinen Huckleberry), seinem kleinen Bruder und dem Schweiger an. Ich beobachtete sie bei ihren Streichen und lachte lauter als die anderen darüber. Bis eines Tages etwas mit einem der wohlbehüteten Mädchen vom anderen Isarufer passierte, das so nicht hätte geschehen dürfen. Ich wollte unbedingt ein Teil der Gruppe sein. Mir war natürlich auch damals schon klar, wie falsch es war, was wir, und im Speziellen ich, dem anderen Kind antaten, aber das spielte damals für mich eine kleinere Rolle als die Aussicht auf Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Ich weiß den Namen des Mädchens nicht mehr, aber sie lief jeden Tag um fünf Uhr nachmittags mit ihrem weißen Spitz auf dem Isarspazierweg an der Erhardtstraße entlang. Manchmal war sie alleine, manchmal lief sie mit einem anderen Mädchen, das fast genauso aussah wie sie: blonde Zöpfe, ein sauberes blaues Kleid, weiße Schürze und weiße Schuhe. Eine »Gspickte«, eine Reiche, sagte der große Grammer und »um die ist es nicht schade«. »Die nehmen wir aus, so wie ihr Vater meinen Vater ausnimmt«, sagte der Schweiger. Ob das irgendwas mit der Realität zu tun hatte und die beiden Väter in echt in einem Arbeitsverhältnis zueinander standen, wusste ich nicht. Wahrscheinlich war der Vater des Mädchens irgendwo ein Chef, der Vater vom Schweiger irgendwo anders ein kleiner Arbeiter, der lange und hart schuftete, aber zu wenig verdiente, um seine unzähligen Kinder durchzubringen. Wahrscheinlich hatten die beiden gar nichts miteinander zu tun.
Eines Tages sahen die drei Buben (immer mit mir im Schlepptau, ohne dass sie es wollten oder bemerkten), wie das
Mädchen in einem Geschäft für fünfzig Pfennige türkischen Honig kaufte. Ein sehr großes Stück. Sie packte es aus, schleckte kurz daran und verfütterte die Süßigkeit dann an den Spitz. Türkischer Honig war für Auer Arbeiterkinder ein unerschwingliches Luxusgut. Die drei Buben waren entsetzt und sich sofort einig: Für diese Verschwendung musste das Mädchen büßen! Von uns hatte noch nie einer jemals ein so großes Stück türkischen Honig in der Hand gehalten. Außerdem, dachten wir uns, wer so viel Geld für Süßigkeiten hat, hat bestimmt noch mehr. Alleine fürs Geldhaben musste sie eigentlich schon blechen. »Und Hunde, die Süßigkeiten fressen, scheißen immer weiß. Das ist noch ekelerregender als normale Hundescheiße«, sagte der Schweiger.
Der große Grammer war ein Angeber, aber gleichzeitig ein Feigling. Deshalb befahl er seinem kleinen Bruder, das Mädchen bei ihrem nächsten Spaziergang abzufangen und abzulenken. Warum er für diese undankbare Aufgabe seinen Bruder nahm und nicht mich, den Deppen aus der Zeppelinstraße, der sich als Handlanger förmlich aufdrängte, fragte ich mich schon gar nicht mehr. Es kam mir schon zu normal vor. Die beiden anderen Buben wollten, während das Mädchen nicht aufpasste, den Spitz entführen, um dann wieder über den redegewandten kleinen Bruder Lösegeld zu verlangen, »sonst landet das Viech in der Isar und dersauft«.
Alles lief zuerst wie geplant. Der kleine Grammer verwickelte das Mädchen in ein Gespräch, die beiden anderen Buben schnappten sich den Spitz und alle drei (vier, mit mir) liefen weg. Wir hörten das Mädchen noch schreien, liefen aber weiter mit dem Hund unter Schweigers Arm über die Reichenbachbrücke zurück in unser Revier.
Etwa eine Stunde später gingen wir vier mit dem Hund wieder auf das gute Isarufer. Der große Grammer und der Schweiger versteckten sich mit dem Spitz im Gebüsch. Der kleine Grammer und ich gingen auf den Isarweg, wo wir auch auf das Mädchen trafen. »Wenn du deinen Hund wiederhaben willst, musst du uns zehn Mark geben. Anderweitig dersauft das Viech in der Isar«, rief ihr der kleine Grammer schon von Weitem zu und glaubte, dass das Mädchen sofort so viel Angst um ihr Tier haben würde, dass sie uns das Geld gleich geben würde. Wir waren uns auch sicher, dass die Kinder der Reichen immer sehr viel Geld mit sich herumtrugen. Sie war aber nicht so unbedarft, wie sie auf uns gewirkt hatte. Das Mädchen war viel selbstbewusster als wir. Sie behandelte uns nicht mit dem Respekt, den man vor gefährlichen Verbrechern hat, sondern mit der Hochnäsigkeit, mit der Menschen ihres Standes ihre ungehorsamen Dienstboten behandelten. Sie blieb ganz ruhig und drohte uns mit ihrem Vater und der Polizei und sagte: »Nichts bekommt ihr! Außer einer Tracht Prügel. Und dann bekommen eure Eltern Probleme, weil ›Eltern haften für ihre Kinder‹.« Der kleine Grammer war ratlos und bekam es mit der Angst vor seinem Vater zu tun. Sowohl wir beiden Lösegeldforderer als auch die beiden anderen im Gebüsch wussten in dem Moment nicht, wie wir weitermachen sollten. Mit dieser Reaktion hatten wir nicht gerechnet. Den Hund freilassen und weglaufen? Da witterte ich meine Chance, endlich die Aufmerksamkeit und Anerkennung der anderen Kinder zu bekommen und reagierte sofort. Ich lief zu den beiden Buben im Gebüsch, nahm ihnen den Hund ab und warf ihn in die Isar. »Wer hat jetzt ein Problem? Dein Scheißviech wohl«, schrie ich das Mädchen an.
Der Hund verschwand im kalten Wasser, die drei Buben aus der Lilienstraße rannten weg und ich hinterher.
Am nächsten Tag stand mittags ein Gendarm vor der Schule und schaute sich alle herauslaufenden Kinder an. Die drei Buben wurden sofort erkannt und bestraft. Sie mussten den Hund in Raten ersetzen (fünfundzwanzig Mark) und bekamen von den eigenen Eltern und dem Chauffeur der Familie des Mädchens Prügel. Alle drei mussten für mehrere Monate drei Nachmittage die Woche nachsitzen und Sätze aufschreiben wie: »Ich werde nie wieder einem anderen Menschen das Haustier wegnehmen …«. Was sie dabei lernen sollten, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das große ›Nie-wieder-Hunde-stehlen‹?
Der große Grammer war schon über zwölf und musste später noch für sechs Wochen in den Jugendarrest. An mich, als Hauptmörder, dachte niemand. Ich stellte mich sogar selbst dem Gendarmen im Viertel und gestand meine Hauptschuld. Der zuckte nur mit den Schultern. »Wir haben die Täter schon. Brauchst nicht den Helden zu spielen.« Im Weggehen glaubte ich ihn noch »Gschaftler« murmeln zu hören. Für die drei Buben war ich weder Verräter, noch Held. Ich blieb einfach unsichtbar. Trotz meiner Bemühungen.