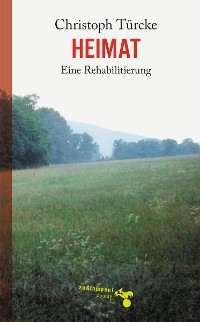Buch lesen: "Heimat"
Christoph Türcke
Heimat
Eine Rehabilitierung

Dank
an Oliver Decker für die kritische Lektüre
des Manuskripts
© 2006 zu Klampen Verlag · Röse 21 · D-31832 Springe
info@zuklampen.de · www.zuklampen.de
Satz: thielen VERLAGSBÜRO, Hannover (Gesetzt aus der Concorde BE)
Umschlag: Matthias Vogel (paramikron), Hannover
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014
ISBN 9783866743304
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.ddb.de› abrufbar.
Inhalt
Cover
Titel
Dank
Impressum
Vorwort
1. Kindheit
2. Nation
3. Globus
4. Heimatkunde
Anmerkungen
Vorwort
Heimat ist ein deutsches Wort, das sich nicht umstandslos in andere Sprachen übersetzen läßt. Heim, Haus, Schutz, Seßhaftigkeit schwingen da mit. Heimat ist, wo man zu Hause, geborgen, mit allem vertraut ist. Das lateinische patria hat dagegen schon einen herrschaftlichen Anklang, spielt auf den Vater als die Recht und Ordnung setzende Autorität an, auch wenn das Vaterland im alten Rom noch nicht zu jener neuzeitlichen Größe geschwollen war, für die nationale Heere zu Marschmusik in die Schlacht ziehen, sondern ganz nüchtern das Land bedeutete, wo der Vater wohnte. Das französische pays natal oder das englische native place wiederum bescheiden sich beim Geographischen, geben lediglich das Land oder den Ort an, wo jemand geboren ist, ohne Verweis auf eine Autorität, aber auch ohne jeden Beiklang von Vertrautheit oder Geborgenheit. Letzteren hat am ehesten das englische homeland. Dennoch klingt es nüchterner. Es hat sich weniger Bedeutung, Erwartung, Sehnsucht darin abgelagert als in Heimat.
Heimat ist ein Idiom – schwer belastet mit Geschichte. Deutsche Romantik, deutsche Volkstümelei und deutscher Faschismus haben sich ausgiebig seiner bedient. Unzählige Male ist es mißbraucht und verhunzt worden. Nicht, daß es daran vollkommen unschuldig wäre. In jedem Wort steckt eine Prise Mehrdeutigkeit, jedes strahlt etwas Zwielicht aus. Es gibt keine reinen Worte, nur mehr oder weniger mißhandelte. Aber ihr Mißbrauch raubt ihnen keineswegs alle Berechtigung. Nur weil die Worte Freiheit und Gerechtigkeit so oft verdreht wurden, soll man sie nicht mehr verwenden dürfen? Im Gegenteil; ihr verantwortungsvoller Gebrauch wird um so dringlicher. Das gilt nicht minder für Heimat. Solange das Gefühl, das sich Heimweh nennt, bei kleinen und großen Kindern – und wer ist schon hundertprozentig erwachsen – nicht ausstirbt, gibt es keinen vernünftigen Grund, das Wort Heimat aus der deutschen Sprache zu tilgen. Es wird vielmehr Zeit, sich ihm erneut zu stellen. Es hat eine dunkle Geschichte, die der Erhellung bedarf, und es hat womöglich mehr Zukunft, als uns lieb ist. Je mehr Heimatlosigkeit die mobile, flexible neoliberale Welt mit sich bringt, desto mehr drängt sich Heimat auf.
1. Kindheit
Fragt man jemanden nach seiner Heimat, so will man gewöhnlich wissen, wo er geboren ist. Dabei ist Geburt geradezu das Gegenteil von Heimat. Ein Kind kommt »zur Welt«, das heißt, es verliert die bergende, wärmende, nährende Hülle des Mutterleibs. Es wird hinausgedrängt, um nicht zu sagen, gepreßt – in eine ihm schlechterdings fremde Umgebung. Hände, die es anfassen, Stimmen, die auf es einreden, Licht, das seine Netzhaut strapaziert: nie hat es zuvor so etwas erlebt. Vielleicht ist ein Mensch nie fremder als im Moment seiner Geburt. Er ist buchstäblich ausgesetzt, muß nun eigens ernährt, gewärmt, geborgen werden, sonst ist er verloren. Neugeborene sind heimatlos, aber sie tun alles, was in ihren bescheidenen Kräften steht, um eine Heimat zu bekommen. Und Kräfte sind ja da: der Greifreflex, der Saugreflex, das Strampeln, und vor allem, bis zum Überdruß der Eltern, das Schreien. Neugeborene schreien, greifen, saugen sich Heimat herbei. Und dabei nehmen sie zu: an Kräften, Umfang, Gewicht. Sie wachsen. Wachsen aber können sie nicht, ohne dabei der Umgebung, in der sie sich vorfinden, anzuwachsen. Und wenn man eine erste Definition wagen soll, so könnte es diese sein: Heimat ist die erste Umgebung, der Menschen nach ihrer Geburt anwachsen.
»Anwachsen« ist hier selbstverständlich nur noch Metapher. Nie – wenn man vom furchtbaren Ausnahmefall siamesischer Zwillinge oder gar Drillinge einmal absehen darf – wachsen Geborene wieder so ihrer Umgebung an, wie es Ungeborene im Mutterleib waren. Sie müssen nun auf eigene Faust atmen, schreien, trinken, verdauen. Keine Mutter kann das mehr für sie tun. Die Nabelschnur ist ein für allemal durchtrennt. Es gibt kein Zurück. Und doch ist das Herbeischreien, -greifen, -saugen einer vertrauten Umgebung ein einziges Zurückwollen: in den Zustand des Gewärmt-, Genährt- und Geborgenseins. Den erstrebt der Säugling, wenn er versucht, in die Mutter zurückzukriechen. Vom Mutterleib als Objekt hat er noch nicht die geringste Vorstellung. Objekte existieren für ihn noch gar nicht. Gerade das hilflose Zurückwollen aber treibt die Säuglinge voran: setzt ihre eigene Atmung, ihren eigenen Verdauungsapparat, ihre eigene Motorik in Gang und bringt erste Modulationen in ihre Stimme. Die Umgebung aber, der sie dabei metaphorisch anwachsen, ist immer schon ein Ersatz für diejenige, in die sie nicht zurück können: gewissermaßen zweite Heimat. Die erste Heimat also der Mutterleib?
Ja und nein. Zur Heimat gehört, daß sie als solche erlebt wird. Der Embryo, dieses Gebilde aus wenigen Zellen, erlebt aber noch gar nichts, und der Fötus anfangs sehr wenig. Die nervlichen Verbindungen, die ihn empfindungsfähig machen, entstehen ja erst allmählich. Sind sie aber schließlich so weit entwickelt, daß er die Wärme und Geborgenheit im Mutterleib als behaglich zu verspüren beginnt, dann nähert sich auch schon der Zeit der Wehen, die ihn in Unruhe versetzen und ihm ankündigen: Hier bleibst du nicht mehr lange. Überhaupt ist die Wahrnehmung im Mutterleib recht diffus. Der Fötus ist empfindlich für Temperatur – und hoch empfindlich für Erschütterungen. Die Bewegungen des mütterlichen Organismus, sein Stoffwechsel, seine Stimme: dies alles teilt sich dem werdenden Leben durchdringend mit. Es hielte diese Erschütterungen gar nicht aus, wäre es nicht von einer schützenden Fruchtblase umgeben. Wahrnehmen und erschüttert werden sind anfangs ungeschieden – von einer dumpfen Intensität, der es aber an spezifischer Sinnlichkeit noch mangelt. Dem Fötus sind die Augen noch nicht aufgegangen. Er ist praktisch blind, und wie weit er schon etwas riecht oder schmeckt, ist fraglich. Kurzum, es fehlen ihm entscheidende Voraussetzungen dafür, den Mutterleib als Heimat zu erleben.
Rundum erlebnisfähig ist der Organismus erst, wenn er hinausgepreßt worden ist. Erst die Geburt bringt sein Sensorium voll in Gang. Der Geburtsschock stimuliert die Sinne wie nichts zuvor, und ihre spezifische Wahrnehmungsleistung entwickelt sich beim Versuch, ihn wegzuarbeiten – rückgängig zu machen. Erst dabei, also nachträglich, wird der Mutterleib das, was er nicht war, solange das Kind sich darin befand: Heimat. Die erste Heimat ist ein Unding, ein Nicht-Ort, griechisch: utopos. Sie entsteht postum: wenn sie verloren und der Rückweg in sie versperrt ist. Dann aber begleitet sie das weitere Leben wie der Schatten das Licht. Noch der Erwachsene hört nicht auf, die Rückkehr ins Versperrte zu simulieren. Er legt ja abends nicht nur die Kleidung ab. »Man darf hinzufügen, daß er beim Schlafengehen eine ganz analoge Entkleidung seines Psychischen vornimmt, auf die meisten seiner psychischen Erwerbungen verzichtet und so von beiden Seiten her eine außerordentliche Annäherung an die Situation herstellt, welche der Ausgang seiner Lebensentwicklung war. Das Schlafen ist somatisch eine Reaktivierung des Aufenthalts im Mutterleibe mit der Erfüllung der Bedingungen von Ruhelage, Wärme und Reizabhaltung; ja viele Menschen nehmen im Schlafe die fötale Körperhaltung wieder ein.«1
Die biblische Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies ist zwar nicht nur eine Geburtsgeschichte, aber auch. Sobald Adam jedem Tier seinen Namen gegeben und selbst eine »Hilfe«, will sagen eine Frau bekommen hat, das Paradies also komplett ist und das selige Leben darin losgehen könnte, hört es auch schon auf. Das Menschenpaar ißt von der verbotenen Frucht, es »gehen ihm die Augen auf«, es setzt damit die paradiesischen Wehen in Gang, die es aus dem Garten Eden hinaustreiben. Kein Wort davon, daß Adam und Eva den paradiesischen Zustand erst einmal gründlich genossen hätten. Ihre erste gemeinsame Handlung besteht darin, ihn zu verspielen. Erst nachträglich, als verspieltes, verlorenes, ist das Paradies Paradies. Das »Aufgehen« der Augen hat hier zwar den übertragenen Sinn des Erkennens; Adam und Eva werden ihrer natürlichen Beschaffenheit als Nacktheit inne, sie schämen sich ihrer, sind nicht mehr eins mit ihrer Natur, treten aus der Unbefangenheit heraus in die Reflexion. Aber auch in ganz wörtlichem Sinn gilt: Erst wenn Lebewesen geschlüpft sind, sei es aus dem Ei oder dem Mutterleib, gehen ihnen die Augen auf. Zur Welt kommen heißt sehend werden. Und Sehen verlangt eine gewisse Distanz. Neugeborene aber begehren Nähe. Kleine Katzen und Hunde etwa, die sich am Euter der Mutter festsaugen und sich in ihr warmes Fell einzunisten versuchen, haben nicht minder einen Geburtsschock zu bewältigen als der menschliche Säugling; auch sie wollen in den nunmehr versperrten Mutterleib zurück, auch sie werden durch ihr Zurückwollen vorwärts getrieben. Nur kommt das Menschenkind noch schutzloser, unfertiger, bedürftiger zur Welt als andere Säuger. Es laboriert daher am Geburtsschock besonders intensiv und hat dabei im Laufe von vielen Jahrtausenden auch etwas ganz Besonderes gelernt: sich für Entzogenes, Versperrtes, Abwesendes zu entschädigen durch Halluzinationen, Vorstellungen, Begriffe davon, oder, um es mit einem berühmten Buchtitel von Ernst Bloch zu sagen, durch den Geist der Utopie.
Auch für das Menschenkind ist nach der Geburt die erste Umgebung vorwiegend die mütterliche. Aber der Säugling bekommt nur noch die Außenseite des Mutterleibs zu spüren. Die ist zwar weich und warm und bietet Zipfel, an denen sich trefflich saugen läßt. Nichts hilft denn auch besser über den Geburtsschock hinweg als dieses Saugen. Es überspielt ihn. Das Kind fühlt sich wieder eins mit dem, wovon es getrennt wurde, und zieht daraus Saft und Kraft. Es trinkt die Milch der Mutter. Das ist anstrengend, lustvoll und nahrhaft, und erst wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, kann ernstlich davon die Rede sein, daß das Kind den Mutterleib genießt. Nichts geht über anfänglichen Genuß. Das Saugen des Neugeborenen ist geradezu sein Archetypus – und der Saugtrieb zunächst durchaus kein Partialtrieb, sondern Trieb schlechthin. Aller Trieb ist anfangs Saugtrieb. Einerseits ist er kaum mehr als ein Naturreflex, andererseits etwas geradezu Mystisches. Versucht er doch nichts Geringeres, als den Mutterleib in sich und sich in den Mutterleib hineinzusaugen. Erst nachdem diese primäre unio mystica fehlgeschlagen und der Saugtrieb vielfältig frustriert worden ist, wird er partial – in dem Maße, wie sich andere Körperzonen erogen aufladen, die Lustempfindung bis in Lenden und Oberschenkel absinkt und der ganze Körper zu versuchen beginnt, was den Lippen allein nicht glücken wollte.2
Am Säugling zeigt sich, was genuine Lust ist. Sie ist eine Haut-, genauer: eine Schleimhauterfahrung. Sie beginnt am Kopf, nicht am Unterleib. Sie ist untrennbar von der höchsten Anstrengung, zu der der kleine Organismus fähig ist. Und mit dem Vereinigungsbegehren wird auch der Hunger gestillt. Beide sind noch ungeschieden. Nie wieder vielleicht ist dem menschlichen Wesen später eine so erfüllende, erschöpfende Lusterfahrung beschieden. Dennoch ist die genuine Lust keine ungetrübte. Zum einen ist ihr Genuß nicht von Dauer; immer wieder weicht er neuer Bedürftigkeit. Zum andern ist sein Glück trügerisch. Es besteht darin, sich eins zu fühlen mit etwas, womit eine physische Einheit nicht mehr besteht. Der Milch spendende Leib mag noch so nahe sein; aber er ist außen. Seine warme, weiche Haut ist auch die Wand, die verunmöglicht, daß der Säugling in den Uterus dahinter zurückkehrt. Kurzum, der Mutterleib ist nicht mehr das, was er war: dauerhaft schützende und nährende Hülle. Selbst die fürsorglichste Mutter kann ihr Kind nicht ununterbrochen an der Brust haben.
Damit wird die Mutterbrust zu einem geradezu tragischen Organ. Sie ist es, die dem diffusen Begehren des Säuglings einen ersten Halt gibt und ihm genuine Lust verschafft. Aber was er bei der Geburt verlor, vermag sie ihm nicht wiederzugeben. Sie gibt ihm alles, was sie hat, und gerade dabei narrt sie ihn. Wenn sie ihn nährt, nährt sie nämlich auch sein trügerisches Gefühl, eins mit ihr zu sein. Sobald sie sich ihm aber nur ein klein wenig entzieht, untergräbt sie dieses Gefühl. So kommt es, daß sie »vom Kind so erlebt wird, als sei sie in eine gute (befriedigende) und eine böse (versagende) Brust gespalten«.3
Während sich das Kind an sie zu gewöhnen beginnt, beginnt sie auch schon mit seiner Entwöhnung. Gerade am Ort seines ersten Genusses bekommt es abermals eine Trennung zu spüren – nicht so schockhaft wie bei der Geburt, aber ebenfalls schmerzlich. Der Prozeß der Enttäuschung hebt an, und zwar in seinem ganzen Doppelsinn: Der Säugling beginnt seinen primären Genuß zu verlieren, aber auch die Täuschung, mit dem Genußspender eins zu sein. Der Genußzipfel, das Bindeglied zum Inneren der Mutter, der äußerste Zipfel der entschwundenen, unzugänglich gewordenen Vorwelt, macht sich als etwas bemerkbar, was dem Säugling weder gehört noch gehorcht, und davon, wie er mit dem Entzug dieses Zipfels fertig wird, hängt sein späterer Umgang mit Trennungen und Abschieden in nicht geringem Maße ab.
Dem Säugling ist zunächst völlig egal, wem dieser Zipfel gehört. Er hat keinen Begriff davon, wer seine Mutter ist. Legt man ihn nach Durchtrennung der Nabelschnur sogleich einer Amme an die Brust, so hat er kaum eine Chance, in ihr eine andere Person als seine Mutter wahrzunehmen. Er nimmt nämlich überhaupt noch keine Personen wahr, ja nicht einmal Objekte. Seine Objektwahrnehmung fängt selbst erst tastend an, und zwar in dem Maße, wie seine Umgebung sich zu ihm als obiectum verhält: als Widerstand, der seinem Begehren Grenzen setzt. Solcher Widerstand kann die Form der Präsenz haben, etwa wenn der stillende Leib nicht zuläßt, daß er in ihn hineinkriecht; aber auch der Absenz, nämlich wenn dieser Leib sich der Zumutung entzieht, eins mit dem Säugling zu sein.
Widerstand erfahren heißt zurückgestoßen, unterschieden, getrennt werden: von einem Anderen. Und erst diese Erfahrung des Anderen, des Außen, des Fremden lehrt das Eigene kennen. Das Eigene ist das Andere des Anderen. Ein Säugling ist zwar ein in Umfang wie Kräften sehr begrenzter Organismus, aber er weiß noch nichts von seinen Grenzen, zumal sie ständig expandieren, wächst er doch unablässig. Er muß sich als etwas Eigenes, als ein unaustauschbares Selbst erst erfahren, und das geschieht zunächst vorzugsweise an den Rändern seines Körpers. An der Außenhaut bekommt er Widerstand und Trennung zu spüren, hier beginnt – zunächst ganz diffus und sporadisch – jene Grenzziehung, lateinisch: definitio, zwischen Eigenem und Fremdem, dem Selbst und seinen Objekten, die im Laufe eines Lebens nie zum endgültigen Abschluß kommt: der Prozeß der Identitätsbildung. Es ist also nicht so, daß zuerst ein homogenes, mit sich zufriedenes Selbst oder gar Ich da wäre, das dann allmählich seine Grenzen erführe, durch Frustration beschädigt, fragmentiert, gespalten würde. Der Säuglingsorganismus ist vielmehr der Ort eines Begehrens oder Wünschens, das noch keine Grenzen kennt, unfähig ist, zwischen innen und außen, eigen und fremd, fiktiv und real, Wollen und Tun zu unterscheiden, und ohne Gespür für seine tatsächliche Reichweite. Das Begehren weiß noch nichts von Moral und Unmoral; es ist ebenso rücksichts- wie selbstlos. Erst durch die fortgesetzte Erfahrung von Widerstand und Trennung lernt das Kind, daß es ein Außen gibt, das Rücksicht verlangt, Grenzen setzt, und in dem Maße, wie diese Grenzen sich konturieren, lernt es das Andere als strukturierte Objektwelt kennen und formiert sich an deren Widerstand zum Selbst – mit allen Beigaben des Egoismus.
Das Selbst ist also ein Reflexionsprodukt, und zwar im ursprünglichen Wortsinn. Reflectere heißt zurückbiegen, und der Widerstand, den der Säugling erfährt, biegt sein Begehren förmlich auf seinen eigenen Organismus zurück. Er wird zum Säugling seiner selbst. »Ein Teil der Lippe selbst, die Zunge, eine beliebige andere erreichbare Hautstelle – selbst die große Zehe – werden zum Objekt genommen, an dem das Saugen ausgeführt wird.«4 Das Fachwort dafür: Autoerotismus. Das Kind beginnt, den eigenen Körper lustvoll zu erkunden. Es wird gewahr, daß es aus ihm etwas von dem Genuß ziehen kann, den der sich entziehende Genußzipfel zunehmend versagt. So lernt es, sich auf sich selbst zu beziehen, sich als etwas Eigenes, von der Mutter Abgetrenntes wahrzunehmen, anzunehmen, zu bejahen. Es merkt: Ich bin nicht nichts ohne die Mutter, sondern selbst etwas. Und dieses Gefühl ist die erste Plattform der Selbstsicherheit – unabdingbar, um sich der Objektwelt zu öffnen und erfahrungsfähig für sie zu werden. So wichtig aber für die weitere Kindesentwicklung diese Rückwendung auch ist: Sie geschieht nicht freiwillig. Erst das von der Mutterbrust koordinierte und zurückgewiesene Begehren krümmt sich und biegt sich auf den eigenen Organismus zurück. Reflexion ist Verbiegung, Verkehrung des Begehrens: eine erste Form, mit Versagung fertig zu werden.5 Der eigene Körper verschafft bloß einen Ersatz für den Genuß, den der stillende Zipfel einst bot. Der Zipfel entzieht sich, er tritt zurück, wird zum bloßen Teil der Mutter, die nun mehr und mehr als Person wahrgenommen wird, und die Mutter tritt ihrerseits zurück und wird zum Bestandteil einer weiteren Umgebung, des Raums der Familie, des Spielzeugs, der Haustiere. In dem Maße, wie das Kind diese Umgebung als mütterlich imprägniert, als muttergemäß erlebt, mit ihr vertraut wird, sich in sie einübt und einlebt, wird sie ihm zur Heimat.6
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.