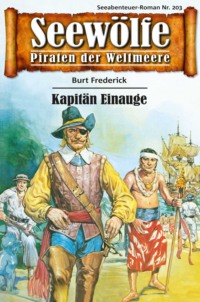Buch lesen: "Seewölfe - Piraten der Weltmeere 203"
Impressum
© 1976/2016 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
ISBN: 978-3-95439-539-2
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
1.
Das Meer verwandelte sich in flüssige Lava.
Weit entfernt, im Osten, entstand die hellrote Glut als winziger Fleck, breitete sich aber aus wie ein gefräßiges Ungeheuer aus rätselhaften Tiefen. Erst jetzt erschien der Feuerball, als habe er sich seine Freiheit mit grimmiger Urgewalt erkämpfen und die starre Linie des Horizonts erst durchbrechen müssen, um sich nun als strahlender Sieger erheben zu können.
Während die Sonne rasch höher stieg, schob sich der Widerschein ihrer Glut mit dem Wellengang des Ozeans auf die Insel zu und schien sie verschlingen zu wollen.
Der einsame Wächter erschauerte, zog die dunkle Decke fester um seinen schmalen, doch muskulösen Körper. Sein Gesicht war mit schwarzer Erde eingerieben, sein jettschwarzes Haar besorgte ein übriges, um ihn mit dem düsteren Felsenhintergrund verschmelzen zu lassen. Er zählte zu den Jüngsten im Volk des Raja Sohore Jugung Moharvi, doch seinen Dienst an diesem heiligen Ort verrichtete er nicht zum ersten Male.
Noch immer bereitete ihm aber das Wissen um die Nähe der Götter Unbehagen. Sie wohnten nur einen Lanzenwurf weit über ihm, im Krater des Vulkans Prakjat. Doch sie duldeten seine Nähe, denn er gehörte zu den Auserwählten, die davon befreit waren, die vorgeschriebene weiße Kleidung anzulegen, wenn sie ihnen gegenübertraten. Von der kleinen Felsplattform unterhalb des Vulkankegels genoß der Wächter einen hervorragenden Blick in die drei Himmelsrichtungen Osten, Süden und Westen. Und nur von Südwesten waren die Feinde zu erwarten. Nur von dort ging die ständige Bedrohung für das Volk des Raja aus.
Die Brahmanen hatten lange um die Entscheidung gerungen, einen Wächter am heiligen Ort zu postieren. Mehrere eindeutige Zeichen waren abgewartet worden, ehe man sich des Wohlwollens der Götter sicher gefühlt hatte.
Der junge Inselbewohner blickte auf das Meer hinaus, das sich im Sonnenaufgang glutrot gefärbt hatte. Weniger die Nähe der Götter als dieses glühende Rot war es, das ihm Unbehagen einflößte. Er hatte es selbst nie miterlebt, wenn die Götter zürnten und feurige Lava über die Insel spien. Doch aus den Erzählungen der Alten kannte er das Grauen, das dann aus dem Schlund der Erde hervorbrach. Unzählige Vorväter der Bewohner von Seribu waren jenem Todeshauch göttlichen Zorns nicht entronnen. Alle, die heute auf der Insel lebten, brachten immer wieder Opfergaben dar, mit denen sie ihr Leben in Frieden zu sichern hofften.
Unvermittelt erstarrte der Wächter in seiner Haltung. Seine Augen wurden schmal, während er nach Süden spähte.
Segel schoben sich über die Linie des Horizonts. Große, helle Segel.
Der Herzschlag des jungen Kriegers begann zu rasen. Jähe Anspannung griff nach ihm wie eine übermächtige Faust.
Dem menschlichen Zorn konnten sie niemals entrinnen. Dafür waren auch jene Opfer sinnlos, mit denen sie das Wohlwollen der Götter auf ihrer Seite hatten. Denn die Andersgläubigen von jenseits des Meeres verachteten die Götter, nach deren Maßregeln die Menschen auf der Insel Seribu lebten.
Das fremde Schiff näherte sich mit weißschäumender Bugwelle. Noch wartete der Wächter, bis er Einzelheiten erkennen konnte. Bald darauf hatte er Gewißheit. Es war eins dieser Schiffe, wie es die weißen Männer aus der fremden Welt verwendeten. Nur, dieses Schiff war größer und stolzer als das eine, das er kannte. Etwas Majestätisches ging davon aus. Er mußte sich von dem Anblick losreißen und sich selbst daran erinnern, daß es nichts anderes als eine tödliche Bedrohung sein konnte, die dort mit dem heraufziehenden Morgen nahte.
Eilends verließ er die Felsplattform. Mit federnden Bewegungen, die seine jungen und gestählten Muskeln erlaubten, lief er den Hang hinunter, bis der tropische Dschungel ihn verschluckte.
Die Menschen auf Seribu würden gewarnt sein – rechtzeitig, bevor das große Schiff die Insel erreichte. Dieses Schiff hatte sich mit dem Feind verbündet. Eine andere Möglichkeit gab es nicht.
„Scheint unbewohnt zu sein“, sagte Ben Brighton, während er das Spektiv sinken ließ.
Philip Hasard Killigrew legte seine Hände auf die Steuerbordbalustrade des Achterkastells und nickte. Feine Gischt, die von der schäumenden Bugwelle der „Isabella VIII.“ aufstieg, wehte ihm ins Gesicht. Der Wind wühlte im schwarzen Haar des Seewolfs, ein handiger Südost, der die Galeone über Backbordbug vor sich hertrieb.
Es war vorerst nicht mehr als ein sattgrüner Fleck, der sich Steuerbord voraus in der Javasee abzeichnete. Ein deutlicher Kontrast, weil die Morgensonne dem Waschbrettmuster des Wellengangs eine unvergleichliche Färbung verlieh.
„Ob bewohnt oder nicht“, entschied Hasard, „wir werden uns um diese hübsche kleine Insel nicht kümmern. Unsere Frischwasservorräte reichen für mehr als zwei Wochen.“ Was den Proviant betraf, hatten sie noch weniger Sorgen. Auf Java, das hinter ihnen lag, hatten sie der „Isabella“ den Bauch kräftig vollgeschlagen.
„Bist du sicher, daß die Seekarten stimmen?“ Ben Brighton blickte Hasard von der Seite an. „Inseln sind jedenfalls nicht verzeichnet. Oder?“
„Das muß nichts heißen, Ben. In der Sundastraße soll es eine Menge kleinerer Eilande geben. Überhaupt scheint mir dieses ganze Südostasien eine Inselwelt von unvorstellbarer Größe zu sein.“
Ben Brighton hob wieder den Kieker. Er war ein besonnener und ruhiger Mann, der möglichen Überraschungen stets dadurch begegnete, daß er sich mit Unbekanntem gründlich beschäftigte – sofern die Zeit dazu blieb. An diesem Morgen hatten sie an Bord der „Isabella“ allesamt Zeit im Überfluß. Der stete Südost bereitete keine Schwierigkeiten, und der klare Himmel ließ vermuten, daß es auch den Tag über so bleiben würde.
Pete Ballie, der stämmige Rudergänger mit Fäusten so groß wie Ankerklüsen, konnte es sich leisten, dem Wortwechsel zwischen dem Seewolf und dem Ersten mehr Aufmerksamkeit zu widmen als dem Steuerruder. Und die Crew konnte sich mit Hingabe einem herzhaften Frühstück widmen, das der Kutscher mit nicht geringerer Hingabe in der Kombüse zusammengezaubert hatte.
Fütterung der Raubtiere, hatte Edwin Carberry, der bullige Profos, augenzwinkernd gebrummt, bevor er selbst ins Logis verschwunden war, um das zu betätigen, was in seinem herzhaften Sprachgebrauch unter der Bezeichnung Futterluke rangierte. Entsprechend ruhig war es an Deck. Moses Bill, der als Ausguck im Großmars ausharrte, hing seinen Gedanken nach. Außer dem grünen Farbtupfer der Insel gab es nichts mehr zu vermelden, denn weit und breit glich die See besagtem Waschbrett, an dessen Muster sie erinnerte. Sir John, der Arakanga-Papagei, hockte hoch oben auf der Vormarsrah und ließ sich den frischen Wind durch das karmesinrote Gefieder blasen. Schon in einer Stunde, wenn die Sonne ihren Aufstieg beschleunigte, würde es wieder drückend heiß sein. Die extrem hohe Luftfeuchtigkeit in diesen Breiten hatte das Schiffsholz mit einem glitschigen Belag überzogen.
Die „Isabella“ lag auf Nordwestkurs. Dabei würde sie die Insel mit einer Distanz von etwa zwei Seemeilen nach Steuerbord passieren. Für eine Kursänderung gab es keinen Anlaß.
Das Kartenmaterial, über das der Seewolf verfügte, war ziemlich ungenau. Es entsprach dem geringen Wissensstand, den europäische Seefahrer über diesen Teil der Welt hatten. Dennoch war Hasard nach seinen Berechnungen sicher, daß sie sehr schnell die Küste von Sumatra erreichen mußten. Jene Insel, die Java an Größe noch um etliches übertraf.
Einzelheiten wurden nun deutlich.
„Das sieht nicht sehr einladend aus“, bemerkte Ben Brighton.
Hasard sah es mit bloßem Auge. Ein schwarzer Vulkankegel reckte sich aus dem grünen Teppich des Tropenwaldes hoch, der die Insel bedeckte. Ruhig und friedlich thronte dieser kegelförmige Koloß dort inmitten üppiger Vegetation. Doch das Bild mochte trügen. Geschichten, die aus fernöstlichen Breiten überliefert wurden, berichteten von furchtbaren Katastrophen durch Vulkanausbrüche.
Es schien also denkbar, daß diese Insel tatsächlich unbewohnt war, wie Ben vermutete. Hasard schätzte die Größe des Eilands auf höchstens hundert Quadratmeilen. Dank der rauschenden Fahrt der „Isabella“ näherten sie sich rasch.
„Deck!“ tönte unvermittelt Bills Stimme aus dem Großmars. „Dort, am Strand! Ein Wrack!“
Ben Brighton justierte die. Optik des Spektivs. Auch der Seewolf nahm seinen Kieker zur Hand.
Der Strand dieser Insel war dunkel, fast schwarz. Stellenweise reichte die Vegetation bis unmittelbar ans Wasser. An anderen Stellen wiederum verlief der Strand flach und ausgedehnt bis zu düsteren Gesteinsmassen, die sich landeinwärts erstreckten. Erkaltete Lava zweifellos, die vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten das Dickicht unter sich begraben hatte.
Das Wrack, das Bill erspäht hatte, war selbst mit dem Spektiv nicht eben leicht zu entdecken. Denn die Entfernung betrug immerhin noch einige Seemeilen. Hasard mußte anerkennend feststellen, über was für gute Augen der Moses verfügte. Es war nicht das erste Mal, daß sich Bill auf solche Weise bewährte.
Wenn es einen Kontrast zu dem schwarzen Strand gab, dann nur die hellere, ausgebleichte Farbe verwitterten Schiffsholzes. Es handelte sich um eine Jolle, die fraglos nicht hier in Asien, sondern irgendwo im heimischen Europa zusammengezimmert worden war.
Hasard hielt sich nicht mit der morschen Nußschale auf, die offenbar auf den Strand getrieben worden war. Er ließ das Blickfeld des Spektivs weitergleiten. Stück für Stück und sorgfältig suchte er auf diese Weise den Strand ab. Ben Brighton tat es ebenso, und nahezu im selben Moment erspähten sie den Körper.
„Da!“ rief Ben. „Haargenau vor dem Palmengürtel!“
Hasard nickte, ohne den Kieker abzusetzen.
Es war ein regloser menschlicher Körper, der dort langgestreckt auf dem düsteren Sandboden lag. Nur wenige Schritte trennten ihn von jenem Palmengürtel, der der grünen Wand des Regenwalds vorgelagert war. Es handelte sich um einen Mann. Soviel war eindeutig festzustellen. Außer einigen hellen Stoffetzen trug er nichts mehr auf dem Leib. Alles deutete darauf hin, daß er sich mit letzter Kraft den Strand hinaufgeschleppt hatte und dann zusammengebrochen war. Vor Entkräftung, Hunger oder gar wegen einer Verwundung – es gab viele Möglichkeiten.
„Vielleicht ist er schon tot“, sagte Ben Brighton gedehnt. „Oder aber …“ Er sprach nicht weiter.
Hasard wußte auch so, was Ben sagen wollte. Dieser breitschultrige, untersetzte Mann hatte jene innere Ruhe, die auch sein Äußeres ausstrahlte. Selten ließ sich der Erste Offizier der „Isabella“ zu einer unbedachten Äußerung hinreißen. In diesem Fall hegte er eben Zweifel daran, ob der Schiffbrüchige auf dem Strand der Vulkaninsel wirklich schon tot sein konnte. Berechtigte Zweifel.
Jeder Mann an Bord der „Isabella“ wußte, welchen Launen des Schicksals man unterworfen war, wenn man sein Glück auf den Weltmeeren suchte. Für viele bedeutete die Seefahrerei letzten Endes alles andere als Glück. Davon konnten alle, die jemals einen Fuß auf Schiffsplanken gesetzt hatten, ein Lied singen. Jeder der Männer, die unter dem Kommando des Seewolfs fuhren, hatte schon die irrwitzigsten Zufälle erlebt. Böse Zufälle waren es meist gewesen, die das Leben gekostet hätten, wenn es nicht eine glückliche Fügung des Schicksals gegeben hätte.
Dies war es, was Ben Brighton ebenso in seinen Gedanken bewegte wie der Seewolf selbst. Sie konnten nicht einmal ahnen, durch welche Umstände der Schiffbrüchige dort auf die Insel getrieben worden war. Wenn es aber noch Hoffnung für ihn gab, so war die „Isabella“ in diesem Moment jene glückliche Fügung, die es auf See so äußerst selten gab.
Es gab Pflichten, denen sich ein Mensch nicht entziehen konnte. Daran hatte es für Philip Hasard Killigrew noch nie den geringsten Zweifel gegeben. Menschlichkeit war in einer Situation dieser Art für ihn das oberste Gebot.
Noch einmal betrachtete er die gestrandete Jolle genauer. Das Boot war verwittert, vom Salzwasser angefressen. Soviel war trotz der Entfernung zu erkennen. Welche Umstände dazu geführt hatten, blieb vorerst unklar.
„Wir sehen nach dem Rechten“, entschied der Seewolf.
Ben Brighton setzte das Spektiv ab und blickte ihn an.
„Ich habe es gewußt“, sagte er mit einem kaum erkennbaren Lächeln. „Hoffen wir nur, daß es keinen Ärger gibt.“
Hasard zog die breiten Schultern hoch. Er war mehr als sechs Fuß groß und schmal in den Hüften.
„Damit muß man immer rechnen. Hinter einem Zufall können sich die schlimmsten Überraschungen verbergen. Aber willst du dein Gewissen damit belasten, jemandem nicht geholfen zu haben, wenn es um sein Leben geht?“
„Nein“, erwiderte Ben Brighton entschlossen.
„In Ordnung. Wir ankern vor der Insel und setzen ein Boot aus. Sechs Mann. Sie sollen sich freiwillig melden.“
„Aye, aye, Sir.“ Bens Stimme klang jetzt fast militärisch. Er schob das Spektiv mit einem Ruck zusammen und trat an die vordere Schmuckbalustrade des Quarterdecks. „Alle Mann an Deck!“ Sein energischer Befehlston drang bis in den letzten Winkel der Galeone.
Innerhalb weniger Minuten wurde es auf der Kuhl lebendig. Nackte Fußsohlen klatschten auf die von der Feuchtigkeit glitschigen Planken. Stimmengewirr beendete die fast idyllische Ruhe, die bis eben noch geherrscht hatte.
Während sie sich der Insel näherten, vergewisserte sich Hasard abermals. Der Schiffbrüchige hatte sich nicht vom Fleck gerührt. Allem Anschein nach war jegliche Kraft aus seinem Körper gewichen, möglicherweise kam jede Hilfe für ihn schon zu spät.
2.
In gleichmäßigem Takt tauchten die Riemenblätter ins kristallklare Wasser. Das kleine Beiboot der „Isabella“ glitt mit rascher Fahrt durch den Wellengang, der sich klatschend am Bug brach und Gischtfahnen über die Köpfe der Männer wehen ließ. Die Sonne war höher gestiegen und stand mittlerweile über den Kronen der mächtigen Kokospalmen. Schon jetzt ließ sich die bevorstehende Hitze des Tages ahnen, denn die frische Morgenluft wich allmählich einsetzender drückender Schwüle.
Der Küstenstreifen erstreckte sich etwa in Nord-Süd-Richtung; der Strand bildete eine weitgeschwungene dunkle Linie vor der grünen Kulisse des Tropenwaldes. Vereinzelt lagen darin die erkalteten Lavafelder und erinnerten an häßliche Zahnlücken in einem menschlichen Gesicht.
Edwin Carberry, der bullige Profos der „Isabella“, pullte mit kraftvollen Zügen als Backbord-Schlagmann auf der achteren Ducht. Dan O’Flynn, schlank, jung und hochgewachsen, saß neben dem Profos und hatte keine Mühe, Carberrys Schlagzahl mitzuhalten.
Auch den anderen stand es in den Gesichtern, daß der kleine Landausflug eher ein Vergnügen als eine anstrengende Geschichte war. Luke Morgan, der gewitzte Bursche, der einst aus der englischen Armee desertiert war, hatte ein verwegenes Grinsen aufgesetzt. Wie stets, wenn sie sich Unbekanntem näherten. Die Messernarbe über Lukes Stirn leuchtete, er befand sich in dieser Stimmung, in der er mit Kußhand den Teufel ins Fell gezwackt hätte.
Matt Davies stand seinen Gefährten in nichts nach, obwohl er dort, wo sich einst seine rechte Hand befunden hatte, nur noch einen Stahlhaken an einer Ledermanschette trug. Einen spitzgeschliffenen Haken allerdings, den Matt im Nahkampf als gefährliche Waffe einzusetzen wußte. Das Haar des kräftig gebauten Mannes war grau. Alle an Bord der Galeone erinnerten sich an jene Nacht, die Matt Davies allein auf einem Floß in der Karibik zugebracht hatte. Haie hatten ihn umlagert, und es war wie ein Wunder gewesen, daß es der Isabella-Crew gelungen war, ihn zu retten. Doch sein früher dunkelblondes Haar war in dieser einen Nacht grau geworden.
Die beiden anderen Männer im Beiboot waren Sam Roscill und Bob Grey. Der schlanke, dunkelhaarige Sam Roskill hatte wilde Zeiten als Pirat in der Karibik hinter sich. Seit er unter dem Kommando des Seewolfs fuhr, hatte er sich als Draufgänger und zuverlässiger Kämpfer bewährt. Ebenso Bob Grey, ein drahtiger blonder Mann, dessen persönliche Geschichte so verworren war, daß er damit unter den Seefahrern dieser Zeit kaum eine Ausnahme bildete. Bob war als Waise von Geistlichen erzogen worden, hatte irgendwann die Nase gründlich vollgehabt und war ausgerissen. Die See war sein neues Zuhause, die Planken der „Isabella“ seine vertraute Umgebung. Kein anderer an Bord war so geschickt als Messerwerfer wie Bob Grey.
Ed Carberry schob sein Rammkinn vor und blickte über die Schulter zur Insel. Noch drei Kabellängen. Die Risse im morschen Holz der gestrandeten Jolle waren bereits zu erkennen.
„Schlaft nicht ein, ihr gottverdammten Kanalratten!“ knurrte er. „Falls ihr es noch nicht kapiert habt: Der Tag fängt erst an! Wenn ihr glaubt, daß ihr euch jetzt schon aufs Ohr hauen könnt, habt ihr euch mächtig getäuscht. Ho, ihr faulen Säcke, wollt ihr wohl pullen? Oder braucht ihr erst einen Tritt in eure Affenärsche, damit ihr wach werdet?“ Zur Untermalung seiner wohlmeinenden Ansprache legte Carberry noch einen Schlag zu, und die Männer paßten sich grinsend an.
Die Herzlichkeiten ihres Profos waren wie das Salz in der Suppe. Keiner von ihnen mochte sich den Tag ausmalen, an dem sie Ed Carberrys Sprüche einmal nicht mehr hörten.
Achteraus schrumpfte die schlanke Galeone in ihrem Blickfeld. Hasard hatte sämtliches Tuch aufgeien lassen, die „Isabella“ schwojte sacht um die Ankertrosse.
Edwin Carberry und die fünf anderen hatten sich freiwillig gemeldet, wie der Seewolf es erwartet hatte. Doch wenn es nach dieser Freiwilligkeit gegangen wäre, dann hätte sich jetzt die gesamte Crew auf dem Weg an Land befunden. So hatte der Profos kurzentschlossen die Auswahl getroffen. Außer ihren Entermessern hatten sie sich mit Steinschloßpistolen bewaffnet und zusätzlich drei Musketen mitgenommen.
Denn wer oder was sie außer dem Schiffbrüchigen auf der Insel erwartete, mochte derzeit allein der Teufel wissen. Zwar vermutete Ben Brighton nach wie vor, daß es sich um eine unbewohnte Insel handelte. Aber die Seewölfe hatten dem Gehörnten zu oft in die grinsende Visage geblickt, um noch gutgläubig zu sein.
Wenn es dann noch solche haarsträubenden Überraschungen gab, wie sie es in Australien erlebt hatten, dann rüsteten sie sich lieber vorher für alles Mögliche und Unmögliche. Menschenfressern, deren grausiges Handwerk sie dort auf dem Kontinent der Känguruhs und Beuteltiere erlebt hatten, wollten sie kein zweites Mal begegnen.
Unvermittelt knirschte der Kiel des Beiboots auf Sand. Die Männer pullten noch einen kräftigen Schlag, holten dann die Riemen ein und sprangen außenbords. Das seichte Wasser reichte ihnen bis zu den Kniekehlen. Sie zogen das Boot an Land, nur ein paar Schritte von der verwitterten Jolle entfernt.
Der Schiffbrüchige lag unverändert an jener Stelle, an der sie ihn schon von Bord der „Isabella“ aus beobachtet hatten.
„Sehen wir uns den komischen Stint ein bißchen näher an“, knurrte Edwin Carberry und stapfte voraus. Im dunklen Sand hinterließen seine kahnförmigen Seestiefel tiefe Abdrücke. Wer den Profos kannte, wußte, daß seine Bemerkung durchaus fürsorglich gemeint war.
Dan O’Flynn, Matt Davies und die anderen folgten ihm. Die Entermesser klatschten gegen ihre Hüften, unter ihren Ledergürteln ruhten die schweren Pistolen. Sie nahmen sich nicht die Zeit, die Jolle zu untersuchen. Der Mensch, der sich hier in so offenkundiger Not befand, war wichtiger als alle Nebensächlichkeiten.
Ed Carberry kniete als erster vor dem reglosen Körper und beugte sich über ihn.
Seine Gefährten sahen sich um. Nirgendwo bewegte sich etwas, kein Laut war zu hören. Für diesen bedauernswerten Kerl hatte es auf der Insel allem Anschein nach keine helfende Hand gegeben. Sein persönliches Pech, daß er sich ausgerechnet dieses öde Eiland ausgesucht hatte.
„Merkwürdig“, brummte der Profos, „unterernährt sieht dieser Hering nicht gerade aus. Und atmen tut er auch noch. Wollen doch mal sehen …“ Er packte ihn an der Schulter, um ihn auf den Rücken zu drehen.
Die gesamte Crew hatte sich an Deck versammelt. Ausgenommen der Kutscher, der seinen Platz in der Kombüse nur dann zu verlassen pflegte, wenn sich Sensationen anbahnten. Und danach sah es seiner Meinung nach beim besten Willen nicht aus. Den Männern, die am Steuerbordschanzkleid der Kuhl lehnten, genügte indessen die Tatsache, daß sechs ihrer Gefährten unterwegs waren, um eine höchst unklare Sache klarer zu machen.
Diese Insel sah wahrhaftig aus wie ein toter Haufen Erde, wozu der gewaltige Vulkankegel in erheblichem Maße beitrug. Es schien nur noch eine Frage von Jahren oder Jahrzehnten zu sein, bis die Lavamassen auch den Rest des Tropenwaldes unter sich begraben haben würden. Menschen gab es hier bestimmt nicht. Davon waren die Seewölfe überzeugt. Wer konnte schon unter der ständigen Bedrohung durch so einen elenden Vulkan leben?
„Dad, was tut unser alter Affenarsch jetzt?“ erklang eine helle Stimme auf dem Achterkastell.
Die Männer auf der Kuhl konnten sich ein Grinsen nicht verkneifen. Doch sie hüteten sich, in Gelächter auszubrechen. Der Seewolf verstand eine Menge Spaß. In dieser Beziehung aber nicht.
Hasard setzte das Spektiv mit einem Ruck ab und wandte den Kopf zur Seite. Ben Brighton, der neben ihm stand, mußte sich abwenden, um sein Lächeln nicht zu zeigen.
„Eins schreibe dir hinter die Ohren, Sohn“, sagte der Seewolf energisch. „Unser Profos heißt für dich nicht ‚unser alter Affenarsch‘, sondern immer noch Mister Carberry oder ‚Sir‘, wenn du ihn direkt anredest. Das gilt übrigens für euch beide. Sonst ist zu sagen, daß ich selbst nicht genau erkennen kann, was Mister Carberry gerade tut. Er untersucht nämlich den Schiffbrüchigen, und die anderen stehen um ihn herum.“
Hasard junior zog den Kopf zwischen die Schultern, biß sich auf die Unterlippe und senkte den Blick.
„Aber Dad“, entgegnete Philip junior ziemlich lautstark, „ich dachte, wir sollen nur dann nicht ‚unser alter Affenarsch‘ sagen, wenn er in der Nähe ist! Und im Moment ist er doch so weit weg, daß er uns gar nicht hören kann.“
Hasard schickte einen ergebenen Blick zum Himmel. Dann wandte er sich seinen Söhnen zu. Manchmal dachte er, daß es einfacher sein mußte, einen Sack Flöhe zu hüten, als diese beiden Strolche zu anständigen Kerlen zu erziehen.
„Ich sage es noch einmal laut und deutlich“, begann er gedehnt. Dabei zwang er sich, nicht den Zeigefinger zu erheben, denn das wäre ihm selbst lächerlich erschienen. „Es gibt grundsätzlich keinen alten Affenarsch. Wir haben überhaupt keinen solchen an Bord, mit Ausnahme Arwenacks. Jeder, der zur Crew gehört, ist für euch ‚Mister‘ plus Nachname, und er heißt ‚Sir‘, wenn ihr mit ihm sprecht. Noch Fragen?“
Die Zwillinge wechselten einen schnellen Blick. Äußerlich ähnelten sie sich wie ein Ei dem anderen. Beide waren schlank und schwarzhaarig und hatten scharfgeschnittene Gesichter wie ihr Vater. Geschmeidig wie Katzen waren sie in ihren Bewegungen, und schon jetzt, mit ihren zehn Lebensjahren, waren sie prachtvolle Burschen geworden.
„Nein, Sir, keine Fragen“, erwiderte Hasard junior lässig, daß dem Seewolf in väterlichem Zorn die Haarwurzeln kribbelten.
„Vielleicht nur eine“, fügte Philip vorsichtig hinzu, „gilt das auch für Bill, unseren Moses? Soll er jetzt auch ein ‚Mister‘ für uns sein?“
Hasard verschlug es für einen Moment die Sprache. Er fühlte sich buchstäblich auf den Arm genommen, und garantiert grinsten sich diese beiden kleinen Halunken innerlich eins.
Bevor er jedoch zu einer passenden Entgegnung ansetzen konnte, meldete sich der, von dem die Rede war. Wieder einmal bestätigte sich das Sprichwort über den Teufel, von dem gesprochen wird.
Die Stimme Bills ertönte in geradezu schrillem Diskant.
„Deck! Segler Steuerbord achteraus!“ Bills helles Organ steigerte sich zu höchster Alarmstimmung. „Entfernung acht bis neun Kabellängen! Ein Zweimaster! Alle Segel sind gesetzt! Kollisionskurs!“
Die Köpfe der Männer waren herumgeruckt. Hasard und Philip vergaßen alle Aufmüpfigkeit wegen des Disputs über vorgeschriebene Anredefloskeln. Mit einem Satz waren sie an der Schmuckbalustrade und starrten in die Richtung, in die bereits ihr Vater und Ben Brighton mit dem Spektiv spähten.
Hasard brauchte nur eine Sekunde, um zu erkennen, was da unter Vollzeug auf die „Isabella“ zurauschte.
Handfester Verdruß!
Der Zweimaster mußte an der Südostseite der Insel gelauert haben – unsichtbar für den Seewolf und seine Crew. Möglicherweise gab es dort sogar eine Landzunge, die prächtigen Sichtschutz für einen solchen Überraschungsplan bot.
Hasard wirbelte herum. Mit diesem Schiffbrüchigen hatte er von Anfang an ein ungutes Gefühl gehabt. Jetzt bestätigte es sich. Deshalb bestand nicht der geringste Zweifel darüber, von welcher Sorte die Absichten waren, die die Kerle auf dem Zweimaster hegten.
„Ben!“
„Sir?“
„Hoch mit dem Anker! Kurs etwa West-Nord-West. Klar Schiff zum Gefecht!“
„Aye, aye, Sir!“ Ben Brighton war mit zwei Schritten bei der vorderen Schmuckbalustrade.
Der Seewolf brauchte nicht hinzuzufügen, daß höchste Eile geboten war. Seine Männer und er waren mehr als einmal mitten in die Hölle gesegelt. Jeder an Deck konnte beim Anblick des fremden Seglers zwei und zwei zusammenrechnen. Deshalb wußten sie alle, daß jetzt, von diesem Augenblick an, jede Sekunde zählte.
„Hoch mit dem Anker!“ tönte Ben Brightons energische Befehlsstimme über das Deck. „Klar zum Setzen von Blinde, Focksegel, Großsegel und Marssegel! Tempo, Tempo, bewegt euch!“
Er brauchte es nicht zweimal zu befehlen. Augenblicklich entstand Wuhling auf der Kuhl und zum Vordeck hin. Doch das scheinbare Durcheinander trog. Jede Bewegung der Männer, die in fliegender Hast auseinanderspritzten, war aus jahrelanger Erfahrung heraus geplant.
Ben Brightons Befehle erklangen jetzt in unablässiger Folge, begleitet vom Knarren des Ankerspills.
„Al Conroy, Batuti und Big Old Shane. Seht zu, daß unsere Lady Isabella gefechtsklar ist! Fangt mit den achteren Drehbassen an!“
„Aye, aye, Sir!“ tönte es von der Kuhl zurück, und es klang fast wie ein Freudenschrei. Was indessen daraus sprach, war nichts als wilde Entschlossenheit, es diesen Halunken zu zeigen, die nichts anderes als eine krumme, hinterhältige Tour im Kopf haben konnten.
„Was steht ihr noch herum!“ herrschte der Seewolf seine Söhne ungewollt grob an, während er schon wieder das Spektiv hob. „Holt Pützen mit Wasser! Streut Sand auf die Decksplanken! Und dann meldet euch beim Kutscher wegen der Kohlebecken!“
„Aye, aye, Sir!“ Die Zwillinge stießen es strahlend hervor, und dann rannten sie los, daß es eine wahre Freude war. Mit affenartiger Geschwindigkeit hasteten sie den Niedergang zur Kuhl hinunter.
Ben Brightons Befehle fetzten knapp und präzise über die „Isabella“, deren erstes Tuch sich entfaltete. Ein Ächzen ging durch die Beplankung, als sich das Focksegel unter dem Wind blähte. Im nächsten Moment griff der Südost auch in das Blindesegel. Sofort darauf senkte sich auch das mächtige Großsegel von der Rah. Mit katzenhafter Gewandtheit enterten die Männer höher hinauf, zu den Marssegeln.
„An die Brassen!“ rief Ben Brighton, als die ersten Männer von der Blinde und vom Ankerspill zurückhasteten.
Auch die Marssegel wurden mittlerweile von den Geitauen befreit. Das Ächzen der Beplankung ließ nach, während die Galeone Fahrt aufnahm.
Jetzt zeigte sich der Vorteil ihrer ranken Bauweise, wie sie vom besten Schiffsbauer Englands konzipiert und verwirklicht worden war. Dieses Schiff hatte nichts von der Plumpheit einer Seekuh, an die die alten spanischen Galeonen bisweilen erinnerten. Nein, die „Isabella“ war der schlagende Beweis dafür, daß Konstrukteure ihren Grips nur ein wenig anzustrengen brauchten, um die überlieferten Schiffsbauprinzipien in zeitgemäße Pläne umzuwandeln.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.