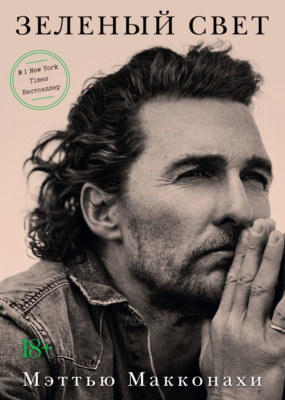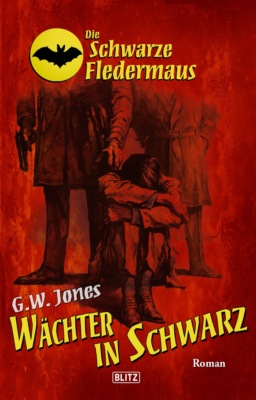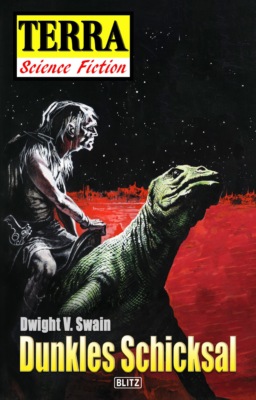Buch lesen: "ZWISCHEN ZWÖLF UND MITTERNACHT"
Alfons Winkelmann
ZWISCHEN
ZWÖLF und
MITTERNACHT
Roman
Bärenklau Exklusiv
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer mit Kerstin Peschel, 2022
Satz: Kapitel VOR DEM SPIEGEL und DER VERGITTERTE HIMMEL: Designstudio Conni Schmidt, Aachen
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Zwischen Zwölf und Mitternacht
Kurze Vorbemerkung
Die Geschichte und ihre Personen
Erscheinen
Aufbruch
Unterwegs
Das blendende Licht
Begegnung
Die große Ewigkeit
Die Tote
Prater Stern
Das böse Auge
En Attendant
Interim
Die Hüter der Liebe
Verhör
Die Kaiserin von Österreich
Die wüste Stadt
Besuch
Die vergessene Filmrolle
Hobby-Leben
Nachtstück I
neuwiener zweitfrühling
Sonnenfinsternis
Das Puppenheim
Der Trip
Nachtstück II
Verfolgung
Vor dem Spiegel
Die Staubbücher
Brasilien hinter den Bergen
Der vergitterte Himmel
Zeugung
Das Buch

Willkommen im Labyrinth! Diese Geschichte, sie beginnt in Göttingen, spielt jedoch größtenteils in Wien im Jahr 1984. Sie ist nicht nur eine wundersame, sondern auch eine wilde. Sie ist eine Liebesgeschichte, ein Verwirrspiel, ein Rätsel. Peter Piechowiak und Christine Bellinger sind ein Liebespaar. Siegfried Börries, ihr Chef, ist offenbar hinter ihr her. Seine Frau Elène kommt anscheinend unter mysteriösen Umständen ums Leben und eine sexbesessene Baronesse namens Angélique von Lichtblau ist aus unerfindlichen (oder doch offensichtlichen) Gründen hinter Herrn Börries her. Hin und wieder taucht ein Mann auf, der sich ganz unauffällig und grau gibt und offenbar Elènes Tod untersucht, außerdem ein anderer Mann, von dem immer nur gesagt wird, er sei ein Glatzkopf mit Brille und würde Zigaretten rauchen…
Berichtet wird das Ganze von uns, einem Reporterteam, bestehend aus mir, dem namenlosen Erzähler, und meinem Kameramann Willi Be.
Durch die gesamte Geschichte hüpft und springt auch ein kleines Mädchen namens Anaëlle mit einem Stoffherzen unter dem Arm – Anaëlle der Schutzengel der Liebe.
***
Zwischen Zwölf und Mitternacht
Eine Reportage
Eine Reportage?
***
Lass mich niemals so ’n geistiger Vorfurzer wer’n.
(Peter Piechowiak)
Kurze Vorbemerkung
Wir haben es hier mit einem wunderlichen Ich-Erzähler zu tun. Nicht nur, dass er keinen Namen hat, sondern er spricht auch häufig etwas seltsam. Selbst ich, der Autor, habe eine Weile gebraucht, mich auf ihn einzuhören. Aber nachdem mir das gelungen ist, habe ich festgestellt, dass die Sprache des namenlosen Ich-Erzählers durchaus ihren eigenen Rhythmus hat, auf den man sich einschwingen muss. Dazu gehört unter anderem die nicht immer grammatikalisch korrekte Satzstellung (die er wohl einem anderen Autor abgeguckt hat, nämlich Peter Kurzeck), dazu gehören ebenso die wilden Assoziationen (die allerdings manchmal auch von seinem Kameramann Willi Be stammen können) und Anspielungen, auch auf andere Bücher. (Da muss man jedoch nicht alles verstehen.) Dazu gehören weiterhin die nicht immer korrekten Schreibweisen von Worten, mal zusammengezogen aus zwei anderen Worten, mal altertümelnd, mal völlig neu erfunden. Auf jeden Fall immer: eigenwillig.
Alfons Winkelmann
Die Geschichte und ihre Personen
Willkommen im Labyrinth! Diese Geschichte, sie beginnt in Göttingen, spielt jedoch größtenteils in Wien, und zwar im Jahr 1984, ist nicht nur eine wundersame, sondern auch eine wilde. Sie ist eine Liebesgeschichte, ein Verwirrspiel, ein Rätsel. Peter Piechowiak, 25, seines Zeichens arbeitslos, Ex-Student der Mathematik, der Germanistik und bis vor Kurzem Verkaufsfahrer, und Christine Bellinger, 22, Buchhändlerin, sind das Liebespaar. Siegfried Börries, Besitzer eines „Fast-Book-Shops“, wie er seinen kleinen Buchladen nennt, ist Christine Bellingers Chef – er spricht von ihr immer ganz altmodisch als „Fräulein Bellinger“ und ist offenbar hinter ihr her. Weiterhin eine Rolle spielen Elène, Herrn Börries’ Ehefrau, die aber anscheinend unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt oder gekommen ist, und eine sexbesessene Baronesse namens Angélique von Lichtblau, die aus unerfindlichen (oder doch offensichtlichen) Gründen hinter Herrn Börries her ist. Hin und wieder taucht ein gewisser Mann auf, Herr Brahms, keine Verwandtschaft, der sich ganz unauffällig und grau gibt und offenbar den Tod Elènes untersucht, außerdem ein anderer Mann, von dem immer nur gesagt wird, er sei ein Glatzkopf mit Brille und würde Zigaretten rauchen.
Berichtet wird das Ganze von uns, einem Reporterteam, bestehend aus mir, dem namenlosen Erzähler, und meinem Kameramann Willi Be (Sollen wir etwas verraten? Das ist eine Anspielung auf William Burroughs. Aber nicht weitersagen).
Ach ja, und nicht zu vergessen: Durch die gesamte Geschichte hüpft und springt ein kleines Mädchen mit einem Stoffherzen unter dem Arm – „Anaëlle“ (Weshalb gerade ein Stoffherz? Hat es etwas damit zu tun, dass Anaëlle der Schutzengel der Liebe ist?).
Erscheinen
Diese Geschichte, es ist eine wundersame, eine wilde Geschichte, das vor allem, lassen wir wie kaum eine vor ihr in Göttingen beginnen. In Göttingen, im südlichsten Zipfel Niedersachsens, den Touristen und Besuchern zufolge eine malerische Stadt mit vielen alten Häusern. Aufgemöbeltes Fachwerk allerorten – kriegsunversehrt, trotz und alledem leidend am Karies der Zeit, und die Füllungen alles andere als zufriedenstellend. Gelegen in einem weiten, offenen Tal, fließt die Leine hindurch, ein Fluss, oder vielmehr, ein Flüsschen, und einige Hänge der umliegenden Hügel sind gut mit Neubauten bewachsen.
Wir erreichen die Stadt von Norden über die Autobahn Hannover-Würzburg. Wir kommen mit einem Auto, denn wir wollen nicht so mir nichts, dir nichts in der Stadt auftauchen und eventuell die Bürger und -innen völlig verschrecken, indem wir einfach so auf der Straße, vielmehr, dem Bürgersteig, erscheinen. Das nicht in unserer Absicht. Obwohl wir es könnten. Sind wir doch völlig substanzlos, unwirklich. Habe zumindest ich nicht mal einen Namen – wozu auch! –, anders als mein Kameramann, der sich Willi Be nennt. Auf ihn, das weiß ich schon jetzt, werde ich im Weiteren gut achtgeben müssen. Ist schließlich er derjenige mit dem Hang zu den wilden Geschichten, zu den ganz wilden. Werden wir das noch erleben, da bin ich mir sehr sicher. Ich kann schließlich nicht vierundzwanzig Stunden am Tag auf ihn aufpassen. Zunächst jedoch fahren wir ganz normal wie die anderen und verlassen an der Ausfahrt Göttingen/Dransfeld die Autobahn. Ebenso gut hätten wir schon die Ausfahrt Göttingen-Nord nehmen können, haben diese jedoch verpasst. Vor uns liegen die grünen Hügel Groß Ellershausens, und fahren wir jetzt auf einer modisch-praktischen Vierspurstraße in die Stadt, sind uns, zunächst, unserer Umgebung nur halb bewusst. Das deren Fremdheit. Am Ortseingangsschild müssen wir uns in die Grüne Welle einschwimmen lassen und bewundern derweil das grellbunt gemusterte Schuh-Center: Begrüßung mit Stepp und Pop.
Jetzt und in die Grüne Welle eingetaucht, trauen wir den Vorampeln mit ihren Richtgeschwindigkeiten nicht so recht, stets den rechten Fuß in Bereitschaft, das Pedal zu wechseln. Der dicke Bus vor uns kurvt bemerkenswert geschmeidig in die Haltestellenbucht. Zuvor jedoch die Tankstelle: tankte unser Fahrzeug dort neues Leben. Und weiterfahren. Verbergen sich vor Willi Bes Kameraaugen die Neue-Heimat-Hochhäuser, von denen uns berichtet – Lebenspferche für diejenigen, denen Faustrecht noch immer als alleiniges Recht gilt, für Kinder, die sich in RamboZombiePorno besser auskennen als im Stundenbuch der Liebe. Aber was soll’s uns kümmern. Unser Ziel liegt woanders.
Und weiterfahren. Neben dem Stadtfriedhof – dort hat der allmächtige EAM-Block (Elektrizitäts-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland, mit anderen Worten: Strom- und Energieversorger für die Stadt und den Landkreis. Aber das nutzt denen, die dort auf dem Friedhof liegen, auch nichts mehr.) von gegenüber seine Macht verloren, das Leben ausgeströmt – gebietet uns die Grüne Welle Einhalt: Gedenket der Toten und hupt nicht gar so ungeduldig! Spielt nicht gar so nervös mit dem Gaspedal, eure ärmeren Zu-Fuß-Mitmenschen werden’s euch danken. So gern liegt niemand nicht dort unter nasskaltem oder trockenheißem Rasen. Willi Be hat sich offenbar die städtische Dröhnung schon wieder eingeworfen; können wir endlich unserer Ungeduld freien Lauf lassen, rasen vorüber an der alten Gerichtslinde, deren Blätter unsere Abgase noch geduldig schlucken, am neuen Wohnblock, Posthof genannt, weiße Wände, rotbemalte Fensterlider. Stop dem Atomtod! hängt da ein Bettlaken aus einem Fenster gegenüber. Und weiterfahren, die Normaluhr zeigt elf. So langsam und merken wir nicht, dass unsere Autos selbst jetzt tödliche Geschosse.
Da, nun über den schmalen Fluss, die Leine, rächt sich für die Eindämmung mit alljährlichem Hochwasser, setzt Straßen und Fußballplatz unter schmutziges Nass. Was alles schon wieder vergessen?
Und weiterfahren. Die Straße noch immer vierspurig, hat das denn niemals ein End’. Unter unseren Achseln Stadtschweiß. Nun, da die Eisenbahn, über die Straße, der Tunnel darunter Schrecken vieler Frauen, Pinkelhöhle für Heimkehrer aus der kneipenbewehrten Stadt. Aber auch das soll uns nicht weiter kümmern. Überhaupt, dieses Göttingen ist ja bloß der Aufhänger für unsere Geschichte, und was wir hier darüber berichten, das haben wir uns vorher aus Reiseführern angelesen. Wer also mehr darüber erfahren möchte, soll selbst dort nachlesen.
Auch benötigen wir keinen Stadtplan und kein Hinweisschild, wissen wir so, dass wir uns auf die rechte Linksabbiegerspur einordnen müssen. Aus dem Wohnbunker rechter Hand glotzen uns schwarze Fenster entgegen. Sind das wohl moderne Spukhäuser, Spukpaläste mit Gängen, in denen sich tagtäglich die Bewohner verlaufen. (Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Aber es könnte die Wahrheit sein.)
Ariadne so weit.
Stinken die Gänge nach Pisse? Putz bröckelt, High-Noon während des Tages und fürchten sie jähes Klingeln an der Wohnungstüre. Wollen alle so schnell wie möglich entrinnen, könnten sie auf dem Klingelbrett draußen vor der Tür Ziehharmonika spielen und brächten dennoch keine Melodie zustand’.
Und die Ampel zeigt grünes Licht, beinahe einen Radfahrer, einen Studenten wohl, angefahren. Droht er uns mit der Faust, schimpft, wer weiß, ob er des Nachts auch Licht am Rad gehabt hätte. Wissen wir doch, dass Studenten manchmal sehr rechthaberisch sind und behaupten, sogar des Nachts leuchtende Wissenschaftler zu sein. Vorüber am Bahnhof. Stehen wir schon wieder an einer Ampel, schleichen uns durch den Stau an die nächste Kreuzung heran. Hat’s einen kleinen Unfall gegeben, sind sie Gott sei Dank ja alle bestens versichert. Blaulicht rotiert auf dem Dach eines Polizeiwagens, wir werden noch zu spät kommen. Denken nur kurz darüber nach, wie wir uns zu gut ins Blech gewickelt, als dass wir uns im Notfall umarmen könnten. Immerzu Raubritter auf dem Weg zum täglichen Kleinkrieg.
Weiter geradeaus, biegen wir bald rechts ab, lassen die Universität links liegen. Schrauben uns in die Innenstadt. Suchen. Suchen eine ganz bestimmte Adresse. Ja, wir haben sie gefunden. Nur dass es hier keinen Parkplatz. Kurven wir weiter, in die Burgstraße, vorüber an einem Beerdigungsinstitut, an einem Kopierladen, gegenüber eine Galerie. Nennt sich Apex und ist doch bestimmt seit mindestens fünf Jahren out of time, wie alles hier in dieser Stadt. Finden wir endlich einen Parkplatz vor der Post. Parkscheibe in bester Ordnung.
So vieles versäumt unterwegs, was uns allerdings auch nicht interessierte. Nicht der Biologische Garten, nicht das Deutsche Theater, nicht die alte Laterne auf dem Theaterplatz. Nun Sommer: Der Boden rings umher bekleidet mit Blumen. Die Stadt brodelt von Menschen, hacken Tausende von Absätzen uns Löcher ins Trommelfell. Gehen wir hinüber zu einer Straße, die „Obere Karspüle“ heißt, vorüber an der Volkshochschule, und da treffen wir ihn, den wir unbedingt haben treffen wollen. Den wir uns für unsere Reportage ausgesucht haben. Von dem wir hoffen, dass er uns nicht im Stich lassen wird (Er wird uns nicht im Stich lassen. So viel sei schon jetzt verraten.).
Aufbruch
„Nachdem sie mich jetzt entlassen haben“, erzählt Peter Piechowiak, „besitze ich noch genau zweitausendfünfhundert Mark. Natürlich überlege ich mir, was ich tun kann. Der Gedanke, mich beim Arbeitsamt zu melden, behagt mir nicht.“
Ein Passant hat das Kamerafeld gekreuzt. Willi Be schreit uns ärgerlich zu, er müsse diese Einstellung noch einmal drehen.
„Nachdem sie mich jetzt entlassen haben“, erzählt Peter Piechowiak, „besitze ich noch genau zweitausendfünfhundert Mark. Natürlich überlege ich mir, was ich tun kann. Der Gedanke, mich beim Arbeitsamt zu melden, behagt mir nicht.“
„Gibt es denn in Göttingen nicht auch eine Arbeitslosenselbsthilfe?“
„Natürlich. Die Überlegung, es dort zu versuchen, ist gewiss nicht die schlechteste. Die meisten meiner Bekannten haben mir sogar dazu geraten. Aber es widerstrebt mir.“
„Können Sie das näher erläutern?“
Sitzen wir inzwischen im Cheltenham-Park (Cheltenham: Partnerstadt Göttingens in England). Hinter einem kleinen Häuschen liegt ein verträumter Teich neben dem Wall, unter vielen hohen Bäumen. Ein malerischer Anblick, könnte ich mir vorstellen.
Klappe: Peter Piechowiak die zweite.
„Ich habe sogar einmal die Telefonseelsorge angerufen. Die Frau am Apparat bemühte sich auf geradezu vorbildliche Weise, mich zu einer eigenen Entscheidung zu führen. Das lernen die nämlich da.“
„Aha. Und, hat sie?“
„Sie fragte mich: ‚Wollen Sie wirklich aufs Arbeitsamt und Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe beantragen und warten, dass man etwas für Sie tut?‘“
„Eine Zwischenfrage, Herr Piechowiak. Was sind Sie von Beruf?“
„Von Beruf?“ Peter Piechowiak lächelt in Willi Bes Kamera. „Das ist ja das Elend. Was heißt, Elend! Das ist ja die Freiheit. Genau genommen habe ich keinen Beruf. Ich bin Student der Germanistik, der Chemie, der Mathematik, der Philosophie und was weiß ich nicht noch alles. Aber eben halt nix, das bürgerlich anerkannt wäre.“ Erneut lächelte Peter Piechowiak in Willi Bes Kamera. Haben sich eine Menge Göttinger und -innen um uns versammelt. Eine Kamera zieht die Welt an sich und ist die Welt in dieser Provinzstadt, die ihre Filmvergangenheit restlos und blind verspielt hat.
„Wie kann ich das verstehen?“
„Tja, wie Sie das verstehen können – woher soll ich das wissen? Aber Sie dürfen mich, wie vereinbart, heute gern begleiten.“
Willi Be, jetzt sind wir dran. Jetzt müssen wir uns einen Tag ausdenken. Nehmen wir an, wir hätten Piechowiak an einem Dienstag um Viertel nach elf Uhr getroffen, dann wäre das erste Gespräch vermutlich gegen fünf vor halb zwölf schon wieder beendet.
Willi Bes Kamera verfolgt Peter Piechowiaks Turnschuh-Schritt, das graue, eckige Straßenpflaster, wechselt die Perspektive, fährt zu dessen Händen mit dem Dreckrand unter den Fingernägeln hoch, zu dessen grobgestrickten blauen Pullover – eigentlich viel zu warm für diesen Sommertag –, zu dessen Kinn, dessen Mund, dessen Nase, dessen Augen. Peter Piechowiak nicht im Geringsten irritiert. Um uns herum Stadtdröhnen: stinkende Busse, Schritte, Rufen, Lachen, Schreien, Fahrradklingeln. Music in front of some shops. Gäbe es keine Schaufenster, flögen uns allerorten Jeans und T-Shirts, Schaufensterpuppen, Ringe, Uhren, Fischbrötchen, Videorekorder, Apfelsinen, Bücher um die Ohren.
So eine Weile lang weiter, immer weiter, zehn Minuten, zwölf Minuten, eine Viertelstunde lang, eine weitere Viertelstunde. Und noch eine. Einmal die Weender Straße hinauf, einmal hinunter. Noch einmal hinauf, noch einmal hinunter. Immer wieder Blicke in Schaufenster, halb neugierig, halb interesselos. Hin und wieder lässt er sich auf eine Frage meinerseits ein.
„Fahrer“, sagt er irgendwann vor einem Schaufenster. „Sachen ausgeliefert. An Geschäfte. Auch an das hier.“ Eine Buchhandlung. „War manchmal anstrengend, wenn die Sachen schwer waren.“ Weitergehen. „Firma war wohl zu klein. Aufträge zurückgegangen. Haben mich nicht mehr gebraucht.“ Ganz sachlich, ohne Bitterkeit. „Und da stehe ich jetzt also mit zweitausendfünfhundert Mark. Aber das habe ich, glaube ich, bereits erwähnt.“
Kommen wir an einem Straßenmusikanten vorbei. Jemand, der schlecht Gitarre spielt und noch schlechter singt. Schlager. Grinst Peter Piechowiak und sagt, er könne das viel besser. Übt er fast täglich zu Hause. Alle möglichen Lieder, erzählt er. Vielleicht, so fügt er hinzu, könne er sich damit ja noch einen kleinen Nebenverdienst sichern. Aber nicht hier. Hier würde das nichts einbringen. Und so gehen wir weiter, und Willi Be lässt die Kamera laufen, ununterbrochen.
Zwölf Uhr dreißig. Peter Piechowiak betritt eine Fleischerei. Bestellt das angebotene Mittagessen: Rotkohl, Bratwurst, Püree. Mikrowellenheiß. Stellt er sich an einen schmalen kunststoffweißen Tisch und isst. Ruhig, ohne Hast, gemächlich, habe Zeit, viel Zeit. Hat uns die Verkäuferin extra freundlich angeschaut wegen der Kamera. Hat sie extra deutlich gesprochen: „Vorsicht, der Teller ist heiß.“ Sprang ein Junge hoch und winkte, jetzt fürs Leben geadelt. Wird seinen Enkeln noch erzählen, dass er im Fernsehen. Wir beide, Willi Be und ich, wir brauchen nichts zu uns zu nehmen, substanzlos, wie wir sind. Mag die Kamera auch noch so schwer sein, Willi Be macht es nichts aus. Er trägt sie, als würde sie schweben.
„Manchmal habe ich Lust, etwas völlig Verrücktes zu tun“, sagt Peter Piechowiak zwischen zwei Bissen. Hier wird Willi Be natürlich sofort hellhörig.
„Und was?“
„Das weiß ich doch jetzt noch nicht“, entgegnet er, kaut, schiebt etwas Rotkohl nach, kaut weiter.
„Machen Sie sich keine Sorgen, von was Sie demnächst leben sollen?“
Peter Piechowiak hält inne, jetzt offenbar irritiert, schüttelt den Kopf.
„Nein, merkwürdigerweise nicht. Ich mache mir keine Sorgen, vertraue meinem Glück, das mich bisher noch nie im Stich gelassen hat. Sehen Sie, bevor ich Auslieferungsfahrer wurde, war ich auch völlig abgebrannt. Zufällig hörte ich im Bus, mit dem ich zum Rathaus, zum Sozialamt, fahren wollte, jemanden erzählen, diese Firma, die jetzt mehr oder minder pleite ist, suche einen Fahrer. Bin ich also gleich hin und habe die Stelle bekommen. So einfach war das damals.“
Er wischt sich mit der Serviette den Mund. „Warum sollte das jetzt anders sein?“
Willi Be und ich hatten uns beim Herkommen darauf geeinigt, dass schönes Wetter sein soll. Daher hat es Peter Piechowiak auch nicht nötig, noch einmal in die Fleischerei zurückzugehen, um seinen Regenschirm zu holen, nachdem wir sie verlassen haben.
Die Jacobi-Kirchturmuhr schlägt die volle Stunde. Die akademische Buchhandlung nebenan zieht sich aus dem nach wie vor brodelnden Trubel vornehm akademisch zurück und schließt ihre Glastüre. Wahrscheinlich stehen die Studenten in der Mensa mittlerweile Schlange. (Aber auch das zu erzählen ist nicht unsere Aufgabe.) Wir heften uns weiterhin an Peter Piechowiaks abgelatschte Turnschuhfersen. Wenn Willi Be gehofft hat, dass er ein gewisses Interesse an den Pornos im Royal zeigen würde, so sieht er sich getäuscht. Er hätte Peter Piechowiak liebend gern dort beobachtet, wie er sich einen runterholt, während auf der Leinwand Bumsfrauen vor sich hin stöhnen, Muskelpakete hinter ihrem Arsch – alles natürlich nur zu Reportagezwecken.
Stattdessen: Stehenbleiben vor dem Schaufenster eines Reisebüros. Von einem Plakat strömt uns der Amazonas entgegen. Traumreise nach Brasilien. Dorthin fahren, so sagt Peter Piechowiak zu uns, vielleicht sogar dort leben, das könnte ein Traum sein. Vielleicht. Er habe sogar einmal angefangen, auf eine solche Zukunft zu sparen. Bevor er sich überlegt habe, dass das naturgemäß kompletter Blödsinn sein müsse. Denn Peter Piechowiak hat niemals Portugiesisch gelernt, erst recht kein brasilianisches.
Trotzdem: In den Ufersümpfen müsse noch ein Geheimnis stecken. Zwischen den mächtigen Urwaldstämmen, zwischen den buntschillernden Schmetterlingen, die nirgends so groß und bunt seien wie dort. O-Ton: „Brasilien steht, glaube ich manchmal, für meine Sehnsucht, einmal etwas völlig Verrücktes zu tun. Etwas Wahnsinniges. Halt etwas, von dem alle Menschen sagen: ‚Das ist doch Wahnsinn.‘ Genau dann wüsste ich, dass ich das Richtige täte. Andere investieren riesige Summe in Erste-Klasse-Intercity-Fahrten mit Essen im Speisewagen, inklusive überteuerter Rotweine. Darauf habe ich wirklich nie viel gegeben.“ Lacht leise. „Worin investiere ich? In Zukunft, trotz AIDS, Atombomben und …“
Allem, was sonst noch kommen wird.
Währenddessen weiterhin auf der Weender Straße. Der entkommt in Göttingen niemand. Willy Bes Kamera schleicht über die Gesichter etlicher Passanten. Frohe, gehetzte, traurige, glückliche, nichtssagende Gesichter sind es, die Willy Be da auffängt und verewigt. Können sie uns immer wieder ansehen.
„Ein Glück“, sagt jetzt Peter Piechowiak, „dass schönes Wetter ist. Wissen Sie, in meiner engen Bude hält mich nichts. Der Nachbar schlägt den ganzen Tag und die halbe Nacht lang Krach – Sie werden’s kaum glauben, aber selbst ich habe schon mal die Polizei gerufen –, und auf Dauer in irgendeinem Café oder einer Kneipe sitzen macht auch keinen Spaß. Ist zudem zu teuer. Meine noch vorhanden Bekannten sind alle bejobt, familiert, bekindert. Eigentlich bin ich niemand, der gern allein lebt, müssen Sie wissen. Vieles in mir liegt zu offen, schreit bei jeder Berührung von außen, müsste abgedeckt werden durch ein Gegenüber. Aber ich bin durchaus leidensfähig. Und lebensfähig. Und hoffnungsfähig.“
Was tut man, wenn man ziellos über oder durch Straßen treibt? Eben genau dies, nichts anderes.
„Was ich so denke? Merkwürdig – indem Sie mich das fragen, weiß ich’s nicht mehr. Wenn ich Ihnen jetzt etwas sage, dann deshalb, weil Sie mich gefragt haben. Zum Beispiel, dass mir die Sonne warm aufs Gesicht scheint oder dass manchmal Touristen da vorne vor dem alten Fachwerkhaus stehenbleiben, genau, das mit dem scheußlichen Laden unten drin, und dann erst fällt mir auf, dass das Haus ansonsten schön ist.“
Willy Be richtet seine Kamera auf dieses Haus.
„Das ist jedoch alles nur schöner Schein, denn genau wie die meisten der Touristen weiß auch ich nichts über dieses Haus. Ob es zum Beispiel nur noch Fassade ist. Wer darin wohnt. Ob überhaupt noch jemand darin wohnt. Ob da nicht nur noch Büros drin sind.“ Er geht weiter, und wir, wir folgen ihm. „Wahre Schönheit kommt von innen, nicht?“ Er bleibt stehen und dreht sich zu uns um. „Einen dümmeren Satz kenne ich nicht.“ Er geht weiter, und beim Gehen spricht er zu uns. „Ich träume manchmal von einem Mädchen, einer jungen Frau, die ich irgendwann irgendwo, nein, nicht hier in Göttingen, kennenlernen werde, mit der ich eine Tochter haben werde, obwohl ich mir im Augenblick kaum vorstellen kann, Vater zu sein. Ihre Zuschauer werden sich vermutlich wundern, dass ich nicht wesentlich mehr über meine momentane Lage nachdenke, nicht darüber nachdenke, wie ich sie wohl ändern könnte. Vermutlich erwarten Ihre Zuschauer sogar Patentrezepte. Oder wollen sich einfühlen, das heißt, sie wollen sich in mir entdecken. Ob das möglich sein kann? Hoffentlich haben Sie sich nicht das falsche Demonstrationsobjekt ausgesucht.“
Er lacht, und Willi Be fängt das Lachen auf. Darin ist er sehr gut.
Die Wissenschaft ist der größte Betrug am Menschen!, knallt uns ein Schild in die Augen, das ein Mann vor der akademischen Buchhandlung in die Höhe hält, inmitten einer Wolke aus Neugier, Spott, Interesse, Bewunderung, Gleichgültigkeit.
„Das könnte etwas für mich sein“, sagt Peter Piechowiak. Er stellt sich neben eine Edelpunkerin mit lila Haarsträhne über den wirren Augen, Haare bis weit über die Ohren abrasiert. An der Leine einen struppigen Hund, der dem Mann mit dem Schild beinahe ans Bein gepinkelt hätte.
Auch das hat Willi Be bereits im Kasten.
Die Edelpunkerin beäugt uns misstrauisch, zerrt ihren Hund beiseite und verschwindet in Richtung Rathaus und Gänseliesl, wo sie sich vermutlich mit ihresgleichen treffen wird. Schwarze, durchlöcherte Strumpfhose, schwarzer Pullover, unter dem die vorschriftsmäßig lange rosa Bluse hervorschaut. Die Einkaufstaschen der Hausfrauen sehen ihr empört nach. (Zumindest sieht das auf den Aufnahmen, die Willi Be von dieser Begebenheit gemacht hat, so aus.)
Als sich auch nach einer Weile nichts weiter tut, macht Peter Piechowiak sich wieder auf den unbestimmten Weg. Er kommt an einer Litfaßsäule vorüber, bleibt stehen, sieht sich die Plakate an, zeigt auf eines und sagt: „Sehen Sie, da gehe ich heute Abend hin.“ Es ist ein handgefertigtes Plakat, die Ankündigung einer Lesung. „21 Uhr, Galerie Apex“, steht da. „Walter Traunstein stellt vor. Heute: Leo Perutz.“
Schon hat Willi Be auch dieses Plakat im Kasten, und ich möchte natürlich wissen, weswegen Peter Piechowiak unbedingt dorthin will.
„Hat das etwas mit Ihrer Arbeitslosigkeit zu tun?“
Sieht er mich verständnislos an. „Sagen Sie, was ist Ihnen eigentlich wichtiger: Peter Piechowiak, der Arbeitslose, oder Peter Piechowiak, der Mensch? Mich auf die Arbeitslosigkeit zu verengen – das empfinde ich beinahe als Beleidigung.“
„Aber darum sollte es doch in diesem Bericht gehen.“
„Naundwennschon!“, faucht Peter Piechowiak.
„Was meinen Sie damit?“
„Was ich damit meine? Ich will nicht bemitleidet werden. Ich will nicht benutzt werden von Leuten, denen gar nichts Besseres geschehen kann, als dass es so viele Arbeitslose gibt. Ich will nicht betreut werden. Für mich, für mich allein weitergehen, wie ich es möchte, das ist für mich der Weg.“
Inzwischen sind wir zur Leine hinüber und gehen einen schmalen Weg entlang. Vor Willi Bes Kameraaugen biegt sich das Gebüsch nur unwillig beiseite.
„Aber selbst das dient ja wieder nur Ihrer Sucht zum Klassifizieren. Am Ende lasse ich mich auf nichts einengen, auf überhaupt nichts. Noch nicht einmal auf Peter Piechowiak!“
Oh, wie zornig er geworden ist! So zornig, dass er eine Handvoll Grashalme ausreißt und in die Luft wirbelt. Träge sinken sie auf das Objektiv der Kamera, und jetzt ist es Willi Be, der zornig wird.
„Ei, sag dem Armleuchter, er soll solche Späße gefälligst sein lassen.“
Noch ein wenig, und es wäre zu einer Schlägerei gekommen.
Gerade noch verhindert hat es ein kleines Mädchen mit einer Rüschenbluse, einem blau-weiß karierten Rock, das ein Stoffherz unterm Arm hält. Peter Piechowiak sieht dem Mädchen lange nach, genau wie wir, und Willi Bes Kamera, vom Grase befreit, hört erst auf zu surren, als das Mädchen schon längst hinter den Büschen verschwunden ist.
„Das war bestimmt Anaëlle.“
„Wie bitte?“
„Ach, nichts“, sagt Peter Piechowiak. Aber auch er sieht immer noch in die Richtung, in der das Mädchen verschwunden ist. „Sie hat mich nur an jemanden erinnert, die ich noch gar nicht kenne.“
„Wie bitte?“ „Du wiederholst dich“, sagt Willi Be so, dass Peter Piechowiak es nicht versteht.
Alles Weitere haben wir nicht mehr aufgenommen. Es war wirklich zu belanglos. Kaum mediengerecht. Für eine Reportage völlig unbrauchbar, oder, was meinst du, Willi Be? Worauf haben wir uns da eingelassen! Demnächst suchen wir uns bessere Kandidaten. Wenn es noch mal dazu kommt. Vorläufig jedoch sind wir an Peter Piechowiak gebunden, und wer weiß, was da alles noch kommen kann.
Willi Be schaltet seine Kamera erst am Abend wieder ein – inzwischen haben wir beide uns in die Unsichtbarkeit zurückgezogen, sind wieder aus der Welt getreten, haben aufgehört, in dieser Welt zu existieren. Wir sind, anders als beim ersten Mal, tatsächlich einfach so wieder in diese Welt hineingetreten, allerdings an einem Ort und an einer Stelle, wo uns niemand dabei beobachten konnte. Immer noch wollen wir niemanden erschrecken.
Jetzt leuchtet uns die Galerie Apex undeutlich entgegen, erkennbar eigentlich nur an den vielen Fahrrädern, die davorstehen.
Wir betreten einen mager beleuchteten Korridor. Rechter Hand zunächst ein paar Briefkästen, dann eine Glastür, dann ein Bord, an dem etliche Plakate hängen, dann wiederum eine Tür, dahinter die Küche, die nächste Glastür, eine Stufe. Grüngealterte Klappstühle, weiße Kunststofftische rechts, Holztisch links, über uns grünendes Efeu, wie in meinem mittelmeerischen Dorf. Vor uns der Eingang, daneben eine Schiefertafel, auf der wir lesen können: „Walter Traunstein stellt vor: Leo Perutz.“ Daneben ein Fenster, durch das die Flaschen vor und hinter der Theke zu sehen sind. Die Kneipe jedoch interessiert uns nicht.
Wir donnern über eine Eisentreppe in einen Raum, an dessen weißgetünchten Wänden für kunstsachverständige Göttinger Bürger beeindruckende Gemälde hängen. Peter Piechowiak hingegen schaudert beim Anblick der wüsten Pinselstriche – wie mit einem Malerquast, den ein Lehrling – Willi Be: ein Azubi – am ersten Lehrtag in die Hand gedrückt bekommen hat, zusammen mit dem Auftrag, alle vorhandenen Farben gleichzeitig auszuprobieren. Er bevorzugt stille Heidelandschaften und Bilder von Mädchen mit langem blondem Haar. – Willi Be: David-Hamilton-Gedächtnis-Kitsch. Dass Peter Piechowiak ein solches Mädchen, springlebendig, einmal treffen würde, kann er gegenwärtig beim besten Willen noch nicht ahnen. Oder? –