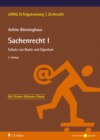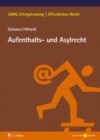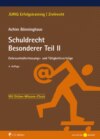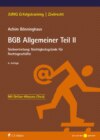Buch lesen: «BGB Allgemeiner Teil I»
BGB Allgemeiner Teil I
Willenserklärung, Vertragsabschluss, Geschäftsfähigkeit und Grundlagen der Fallbearbeitung
von
Achim Bönninghaus
4., neu bearbeitete Auflage

Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-7767-4
E-Mail: kundenservice@cfmueller.de
Telefon: +49 89 2183 7923
Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.de www.cfmueller-campus.de
© 2018 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM) Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert. Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
| • | ein nach didaktischen Gesichtspunkten ausgewähltes Farblayout |
| • | optische Verstärkung durch einprägsame Graphiken und |
| • | wiederkehrende Symbole am Rand  = Definition zum Auswendiglernen und Wiederholen = Definition zum Auswendiglernen und Wiederholen  = Problempunkt = Problempunkt  = Online-Wissens-Check = Online-Wissens-Check |
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre zivilrechtlichen Kenntnisse!

[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Dieses Skript ist der erste Teil von zwei Bänden, die dem Allgemeinen Teil des BGB gewidmet sind. Der Allgemeine Teil des BGB beschäftigt sich mit einer Fülle zivilrechtlicher Grundfragen, denen im Examen wie in der Praxis überragende Bedeutung zukommt. Allerdings hat der Gesetzgeber den Stoff nicht unter Examensgesichtspunkten geordnet, sondern andere Gliederungsprinzipien walten lassen. Aber welche Vorschrift des Allgemeinen Teils muss denn nun in einer Klausur wo angesprochen und geprüft werden? Es gehört zu meinen täglichen Beobachtungen als Repetitor im Zivilrecht, dass der Transfer der abstrakten Grundregeln des Allgemeinen Teils in die gutachterliche Fallbearbeitung erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Insbesondere Aufbaufragen bereiten nicht nur den Anfängern mit Recht großes Kopfzerbrechen. Das Anliegen dieser Skriptenreihe besteht deshalb darin, den Stoff möglichst so aufzubereiten, wie er in einer Klausur, deren Lösung sich an der Begutachtung von Anspruchsbeziehungen orientiert, gedanklich abzuarbeiten ist. Die Darstellung folgt daher den gedanklichen Schritten im Rahmen einer Klausurprüfung und nicht der Gliederung des Gesetzgebers. Das Skript will kein Lehrbuch sein: Die einzelnen Rechtsinstitute werden stets von den Tatbeständen aus behandelt, die in der Klausur den Einstieg bilden. Erläuternde Einführungen erleichtern naturgemäß das Verständnis, doch sind sie auf das notwendige Mindestmaß beschränkt. Zu diesem Ansatz gehört es auch, viele Regeln des Allgemeinen Teils anderen Sachzusammenhängen zuzuordnen, in denen sie sich besser erfassen lassen und in der Klausur behandelt werden. So werden zum Beispiel die Bestimmungen zu Verbrauchern und Unternehmern (§§ 13, 14) im Allgemeine Schuldrecht im Zusammenhang mit den Regelungen über Verbraucherverträge behandelt, die Regeln über Verein und Stiftung in den §§ 21 ff. BGB gehören in die Darstellung des Gesellschaftsrechts und die Regeln über Sachen und Tiere in den §§ 90–103 BGB in die Skripte zum Sachenrecht. Dieses Skript beschäftigt sich mit den Grundlagen der Rechtsgeschäftslehre und behandelt ausführlich die Willenserklärung und den Vertragsschluss. Hinzugekommen ist aus Platzgründen seit der 3. Auflage die Darstellung der Geschäftsfähigkeit, die vorher im zweiten Band BGB Allgemeiner Teil II integriert war. Außerdem erschien es mir sinnvoll, den ersten Band der Skripte zum Zivilrecht mit einer Einführung in die Grundlagen der Anspruchsprüfung und Grundfragen der zivilrechtlichen Fallbearbeitung zu beginnen.
Dieses Skript richtet sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Examenskandidaten. Dies liegt in der Natur des Themas, das vom ersten Semester an Bestandteil des zivilrechtlichen Lehrstoffs ist. Die Brisanz der „Allgemeinen Themen“ bleibt bis zum Examen erhalten und hat sich keineswegs in den unteren Semestern „erledigt“.
Zu den Fußnoten: Sie werden feststellen, dass Literaturverzeichnis und Fußnotenapparat „übersichtlich“ gehalten sind. Das Skript will gar nicht den Anspruch erheben, das Schrifttum auch nur annähernd vollständig zu belegen. Das kann ein Skript auch gar nicht leisten. Betrachten Sie die Fußnoten eher als persönliche Leseempfehlungen. Oft wird auf den „Palandt“ verwiesen, da er in Referendariat und Praxis eine überragende Bedeutung hat. Ich empfehle Ihnen daher, dieses Werk frühzeitig zu nutzen und sich an die abgekürzte Schreibweise zu gewöhnen. Das gilt übrigens auch für die zitierte BGH-Rechtsprechung. Ich würde mich freuen, wenn Sie einige der zitierten Entscheidungen durcharbeiten[1]. Urteile gehören in vielen Bereichen faktisch zu den Primärquellen unserer Rechtsordnung, so dass Sie sich möglichst frühzeitig an Stil und Aufbereitung des Stoffes im Urteil gewöhnen sollten. Außerdem sind die Begründungen meistens so gut formuliert, dass sie zugleich der Wiederholung von bestimmten Themen dienen können.
Bei der Neuauflage habe ich viele Zuschriften verarbeiten können, für die ich mich herzlich bei allen Leserinnen und Lesern bedanken möchte. Indem ich die Institute Geschäftsfähigkeit und Stellvertretung nicht nur im Zusammenhang mit der Willenserklärung und dem Vertragsschluss, sondern auch in einer geschlossenen Einheit dargestellt habe, mag es hier und da zu Wiederholungen kommen. Diese sind durchaus gewünscht und tragen hoffentlich zum besseren Verständnis und Behalten bei. Weitere Anregungen sind immer willkommen.
Auf gehtʼs – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: kundenservice@cfmueller.de. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen. Oder Sie wenden sich direkt an den Verfasser ra@boenninghaus.de.
Frankfurt am Main, im August 2018
Achim Bönninghaus
Anmerkungen
[1]
Die in diesem Skript in den Fußnoten mit Aktenzeichen zitierten Entscheidungen des BGH können Sie kostenlos auf der Homepage des BGH unter www.bundesgerichtshof.de (Rubrik: „Entscheidungen“) abrufen.
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müller
mit Online-Wissens-Check

Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
| • | Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts. |
| • | Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse. |
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?

Online-Wissens-Check
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Ihr persönlicher User-Code: 888554888
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: info@juriq.de.
zurück zu Rn. 55, 191, 286, 415
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. Teil „Ein Rundflug“
A.Sinn und Zweck eines juristischen Gutachtens
B.Wie geht das?
I.Erfassen des Sachverhalts
II.Gliederung
III.Auffinden der Anspruchsgrundlage
IV.Prüfungsreihenfolge der Anspruchsgrundlagen
1.Hauptgliederung
2.Untergliederungen
a)Primäransprüche vor Sekundäransprüchen
b)Unmittelbare Ansprüche vor abgeleiteten Ansprüchen
c)Unmittelbare Haftung vor abgeleiteter Haftung
d)Verschuldensunabhängigkeit vor Verschuldensabhängigkeit
e)Tatbestandliche Logik
V.Darstellung aller Anspruchsgrundlagen im Gutachten?
VI.Die Anspruchsprüfung
1.Anspruch entstanden?
a)Rechtsfähigkeit der Beteiligten
b)Die Anspruchsvoraussetzungen
c)Rechtshindernde Einwendungen
2.Anspruch erloschen?
3.Anspruch durchsetzbar?
a)Fälligkeit
b)Einreden
C.Wie schreibe ich es auf?
I.Gesetz ernst nehmen
II.System abbilden
III.Präzision im Ausdruck/Exakte Zitierweise
IV.Übersichtliche Struktur
V.Obersatz und Ergebnis
VI.Keine logischen Widersprüche
VII.Richtig wichtig
VIII.Keine „Wissensleier“
IX.„Nagelprobe“
X.Auswertung der „Musterlösung“
2. Teil Die Funktion und Struktur von Rechtsgeschäften
A.Rechtsgeschäft und Privatautonomie
B.Definition des Rechtsgeschäfts
I.Willenserklärung
II.Zusätzliche Elemente
1.Weitere Willenserklärung(en)
2.Sonstige Erfordernisse
III.Abgrenzungen
1.Geschäftsähnliche Handlung
2.Realakte
C.Einteilung von Rechtsgeschäften
I.Einseitige und mehrseitige Rechtsgeschäfte
II.Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte
1.Verpflichtungsgeschäfte
2.Verfügungsgeschäfte
3.Hintergrund: Trennungs- und Abstraktionsprinzip
III.Entgeltliche und unentgeltliche Rechtsgeschäfte
IV.Kausale und abstrakte Rechtsgeschäfte
D.Aufbau von Rechtsgeschäften
I.Zustandekommen von Rechtsgeschäften durch wirksame Willenserklärung(en)
1.Einseitige Rechtsgeschäfte
2.Verträge
II.Wirksamkeitserfordernisse von Rechtsgeschäften
III.Wirksamkeitshindernisse bei Rechtsgeschäften
3. Teil Die Willenserklärung
A.Überblick
I.Begriff
II.Elemente einer Willenserklärung
1.Subjektiver Tatbestand: der Wille
a)Handlungswille
b)Erklärungsbewusstsein, Rechtsbindungswille
c)Geschäftswille
2.Objektiver Tatbestand: Erklärung eines Geschäftswillens
III.Notwendigkeit der Auslegung
IV.Prüfungsreihenfolge
B.Die Abgabe einer Willenserklärung
I.Abgabetatbestand
1.Empfangsbedürftige und nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen
2.Abgabe einer nicht empfangsbedürftigen Willenserklärung
3.Abgabe einer empfangsbedürftigen Willenserklärung
II.Abgabe bei zufälliger Kenntnisnahme?
III.Auswirkungen fehlenden Handlungswillens
IV.Sonderfall: „Abhandengekommene“ Willenserklärung
C.Zugang (bei Empfangsbedürftigkeit)
I.Empfangsbedürftigkeit der Willenserklärung
II.Zugang bei Abgabe unter Abwesenden, § 130 Abs. 1 S. 1
1.Abgabe unter Abwesenden
2.Grundregeln für den Zugang
a)Zugang durch Kenntnisnahme
b)Zugang vor oder sogar ohne Kenntnisnahme
3.Zustellungshindernisse und Treuwidrigkeit des Erklärenden
4.Verständnisprobleme des Empfängers
5.Zugangsvereitelung durch den Empfänger
a)Grundsatz der Rechtzeitigkeitsfiktion
b)Zugangsfiktion bei vorsätzlicher oder grundloser Zugangsvereitelung
6.Übungsfall Nr. 1
III.Zugang bei Abgabe unter Anwesenden
1.Abgabe unter Anwesenden
2.Gespeicherte Willenserklärungen
3.Übungsfall Nr. 2
4.Nicht gespeicherte Willenserklärungen
IV.Hilfspersonen beim Zugang
1.Zugang bei Auftreten eines Empfangsvertreters
a)Der Empfangsvertreter
b)Zugangsregeln
c)Empfangsvertretung ohne Vertretungsmacht
2.Zugang bei Auftreten eines Empfangsbotens
a)Empfangsbote und Erklärungsbote
b)Zugangsregeln
3.Übungsfall Nr. 3
V.Zugang bei Geschäftsunfähigkeit des Adressaten, § 131 Abs. 1
1.Geschäftsunfähigkeit des Adressaten
2.Wirkung des § 131 Abs. 1
VI.Zugang bei beschränkter Geschäftsfähigkeit des Adressaten, § 131 Abs. 2
1.Beschränkte Geschäftsfähigkeit des Adressaten
2.Wirkung des § 131 Abs. 2
a)Grundregel
b)Ausnahmen nach § 131 Abs. 2 S. 2
3.Verhältnis von § 131 Abs. 2 zu § 108 Abs. 1
D.Die Auslegung
I.Der Ausgangspunkt im Gutachten
II.Die Auslegungsregeln
1.Auslegung empfangsbedürftiger Willenserklärungen, §§ 133, 157
a)Grundregel
b)Sonderfall: Falsa demonstratio
2.Auslegung nicht empfangsbedürftiger Willenserklärungen, § 133
III.Schweigen als Willenserklärung
1.Tatbestand des Schweigens
2.Ausnahme: Schweigen mit Erklärungswert
a)Erklärungswert kraft Gesetzes
b)Erklärungswert kraft vertraglicher Vereinbarung
c)Schweigen auf kaufmännisches Bestätigungsschreiben
E.Nichtigkeitsgründe in Bezug auf Willenserklärungen
I.Geschäftsunfähigkeit des Erklärenden, § 105 Abs. 1
1.Geschäftsunfähigkeit des Erklärenden
2.Wirkung des § 105 Abs. 1
II.Vorübergehende Störung der Geistestätigkeit, § 105 Abs. 2
1.Voraussetzungen
2.Wirkung des § 105 Abs. 2
III.Tatbestände der §§ 116–118
1.Willensvorbehalt, § 116
2.Scheingeschäft, § 117
3.Scherzerklärung, § 118
IV.(Schuldlos) Unerkannt fehlendes Erklärungsbewusstsein
1.Schritt: Auslegung
2.Schritt: „Lehre vom potentiellen Erklärungsbewusstsein“
3.Übungsfall Nr. 4
V.Widerruf, § 130 Abs. 1 S. 2
4. Teil Das Zustandekommen von Verträgen
A.Überblick
I.Vertrag als Anspruchsgrundlage
II.Verträge als Instrument der Verfügung über Rechte
III.Definition
B.Der Antrag (§ 145)
I.Abgabe und Zugang des Antrags
II.Auslegung
1.Abgrenzung zum einseitigen Rechtsgeschäft
2.Abgrenzung zur invitatio ad offerendum
3.Abgrenzung zum Gefälligkeitsverhältnis
III.Mindestinhalt: „essentialia negotii“
1.Beteiligte Personen
2.Vertragsgegenstand
a)Begründung eines Schuldverhältnisses
b)Verfügung über ein Recht
3.Genauigkeit
C.Die Annahme
I.Regelfall
II.Annahme nach § 151
III.Übungsfall Nr. 5
IV.Sonderfall: Zuschlag gem. § 156
D.Bestand des Angebots zum Zeitpunkt der Annahme
I.Erlöschen des Angebots nach § 146
1.Ablehnung
2.Fristablauf und ähnliche Erlöschensgründe
II.Fälle des §§ 153
III.Fälle des § 156 S. 2
E.Der Einigungsmangel (Dissens)
I.Der offene Einigungsmangel, § 154
II.Der versteckte Einigungsmangel, § 155
1.Formen des versteckten Einigungsmangels
2.Abgrenzungsfragen
a)Irrtum i.S.d. § 119 Abs. 1
b)Abgrenzung zur „falsa demonstratio“
3.Folgen des versteckten Einigungsmangels
5. Teil Geschäftsfähigkeit
A.Überblick
I.Funktion der Regeln zur Geschäftsfähigkeit
II.Geschäftsunfähigkeit und beschränkte Geschäftsfähigkeit
1.Geschäftsunfähigkeit
a)Altersabhängige Geschäftsunfähigkeit
b)Altersunabhängige Geschäftsunfähigkeit
2.Beschränkte Geschäftsfähigkeit
a)Minderjährige nach Vollendung des 7. Lebensjahres
b)Volljährige Personen unter Betreuungsvorbehalt, § 1903
III.Die gesetzlichen Vertreter
1.Vertretungsberechtigte Personen
a)Vertretung Minderjähriger
b)Vertretung volljähriger, nicht voll geschäftsfähiger Personen
2.Ausübung gemeinschaftlicher Vertretungsmacht der Eltern
3.Beschränkungen der Vertretungsmacht
a)Vertretungsverbote
b)Genehmigungsvorbehalte
B.Wirkungen der Geschäftsunfähigkeit
I.Geschäftsunfähigkeit des Erklärenden (§ 105 Abs. 1)
II.Geschäftsunfähigkeit des Erklärungsempfängers (§ 131 Abs. 1)
III.Sonderfall des § 105a
1.Tatbestandsvoraussetzungen
a)Vertragsschluss eines volljährigen Geschäftsunfähigen
b)Geschäft des täglichen Lebens
c)Geringwertige Mittel
d)Bewirken von Leistung und ggf. vereinbarter Gegenleistung
e)Ausnahmetatbestand (§ 105a S. 2)
2.Rechtsfolgen
a)Grundsatz
b)Sonderfall: Mangelhafte Leistung
C.Verträge mit beschränkt Geschäftsfähigen (§§ 107, 108)
I.Wirkung der §§ 107, 108
II.Einwilligungsvorbehalt, § 107 (§ 1903 Abs. 3)
1.Rechtlich vorteilhafte Geschäfte
2.Korrekturen
a)Wirtschaftlich generell „ungefährliche“ rechtliche Nachteile
b)Neutrale Geschäfte
3.Übungsfall Nr. 6
III.Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, §§ 107, 182, 183
1.Rechtsnatur
2.Umfang
3.Übungsfall Nr. 7
4.Sonderfall: § 110
a)Funktion des § 110
b)Tatbestand
5.Übungsfall Nr. 8
6.Sonderfälle der §§ 112, 113
a)Fall des § 112: Selbstständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts
b)Fall des § 113: Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses
IV.Genehmigung des gesetzlichen Vertreters, §§ 108, 182, 184
1.Genehmigungssystem des § 108
2.Übungsfall Nr. 9
D.Einseitige Rechtsgeschäfte mit beschränkt Geschäftsfähigen
I.Einseitiges Rechtsgeschäft durch beschränkt Geschäftsfähigen, § 111
1.Grundregel der §§ 107, 111
2.Fall des § 111 S. 2
II.Einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber beschränkt Geschäftsfähigen, § 131 Abs. 2
1.Allgemeine Regel des § 131 Abs. 2
2.Sondertatbestand des § 109 Abs. 1 S. 2
Sachverzeichnis