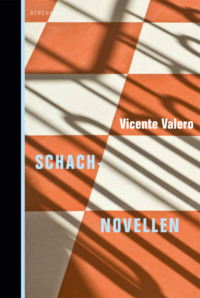Buch lesen: "Schachnovellen"

Vicente Valero
SCHACH-NOVELLEN
Aus dem Spanischen von Peter Kultzen

Inhalt
Inseln hinter den Inseln
Warum ich so gute Ziele wähle
Tropische Münchhausiade
Von Schloss zu Schloss
Bibliografie
Inseln hinter den Inseln
Am Tag nach meiner Ankunft in Helsingborg durchquerte der Orkan »Xaver« Nordeuropa und ließ seine Wut erbarmungslos an Wäldern und Stränden, Häfen und Straßen, Schiffen und Häusern, Dörfern und Städten aus, und der Öresund, der mir am Morgen davor auf den ersten Blick nur wie ein breiter sanfter Fluss erschienen war, der zwischen Dänemark und Schweden dahinfließt – zunächst, als ich ihn, nach der Landung auf dem Flughafen Kopenhagen, im Taxi auf der grandiosen neuen Brücke überquerte, die nach ihm benannt ist, später von dem Haus am schwedischen Ufer aus, wo ich bereits erwartet wurde, um die nächsten zwei Wochen dort zu verbringen –, verwandelte sich unversehens in einen tosenden Ozean, dessen Wellen – voller roter Algen – fast drei Tage lang unermüdlich gegen Türen, Fenster und Wände anbrandeten. Zu Beginn des gewaltigen Sturms wanderte mein Gastgeber, der Maler Jorge Castillo, offensichtlich beunruhigt im Haus herum – es handelte sich um ein hundert Jahre altes, modernisiertes Gebäude, das einst, nacheinander, wie ich vermute, der Wohnsitz eines Konsuls, ein Zollamt und ein berühmtes Bordell gewesen war –, stieg die Treppe hinauf und wieder hinab, versuchte vergeblich, mit diesem oder jenem per Handy zu telefonieren, bespannte Rahmen oder kochte Gemüse, während ich, bemüht, mich auf die Lektüre eines der Bücher zu konzentrieren, die ich mitgebracht hatte – Gracq, Sciascia, Tranströmer, Walser –, in einem eleganten, mit rotem Samt bezogenen Sessel saß – womöglich ein Überbleibsel aus der Zeit, als hier noch diplomatische oder Liebesdienste erwiesen wurden, sagte ich mir – und mich ab und zu erhob, um den Kaffee aufzuwärmen oder neuen zu kochen, obwohl der unerwartete Orkan mich, der ich derlei noch nie erlebt hatte, sicherlich stärker beeindruckte und beunruhigte als den vielgereisten Künstler Castillo, der mit seinen achtzig Jahren bereits alles Mögliche gesehen und sich in den unterschiedlichsten Gegenden der Welt aufgehalten hatte. Schon bald jedoch wurde mir klar, was der eigentliche Grund für seine Unruhe war: Wir befanden uns bereits in der ersten Dezemberwoche, aber es war noch nicht eine Schneeflocke gefallen. Jorge Castillo war nach Schweden gekommen, um verschneite Landschaften zu malen, und jetzt war auch noch ich da, um über diese Landschaften zu schreiben, anders gesagt über Bilder, die noch gar nicht existierten, mein Besuch musste aber nicht zwangsläufig ergebnislos bleiben, war doch zum einen bereits mindestens ein Dutzend Bilder aus dem vergangenen Winter vorhanden, als der Maler zum ersten Mal in Helsingborg gewesen war, und alle enthielten sie reichlich Schnee und Kälte; zum anderen hatten wir, seit wir uns im Sommer 2008 kennengelernt und Freundschaft geschlossen hatten, bei all unseren Begegnungen fruchtbare Gespräche über Kunst und Natur geführt, die auch jetzt, inmitten des nicht enden wollenden skandinavischen Unwetters, kraftvoll wieder auflebten, wie man so sagt, woraufhin sich, wie einer stillen Anrufung Folge leistend, die Namen Corot, van Gogh, Feuerbach, Corinth und so weiter einstellten, um uns Gesellschaft zu leisten und bei der Überbrückung der langen Wartezeit zu helfen. Selbstverständlich gab es ebenso um nichts weniger lange Momente des Schweigens, die wir damit zubrachten, melancholisch die riesigen Wellen zu betrachten und dem Toben des Windes zu lauschen. Am zweiten Nachmittag unserer erzwungenen Klausur fiel mir ein, dass ich mein kleines Klappschach in dem abgewetzten Lederfutteral dabei hatte – obwohl es meistens ungeöffnet bleibt, packe ich es, immer wenn ich verreise, für alle Fälle mit ein –, auch dies, wenn man so will, eine Form der Anrufung, hat es vor mir doch meinem Großvater väterlicherseits, den ich nie kennengelernt habe, meinem Onkel Alberto, der professioneller Schachspieler war, und meinem Vater gehört, und alle, vor allem der Zweite natürlich, benutzten sie es viel mehr als ich, ein sentimentales Erbstück also, dem ich stets größte Achtung zukommen lasse – die Achtung desjenigen, der zweifellos immer schon der schlechteste der vier Spieler war und das auch für alle Zeit bleiben würde. Ich stand auf, um es zu holen, zog es aus dem Futteral und stellte es auf den Tisch, steckte die weißen und roten Holzfiguren langsam und liebevoll in die ihnen jeweils zukommende Position und wollte mich, wie schon bei anderen Gelegenheiten, daranmachen, das eine oder andere Läufer- oder Springerproblem – die sind mir am liebsten – zu lösen, aber Castillo, der bereits seit einer ziemlichen Weile scheinbar schlafend auf einem Sofa lag, richtete sich plötzlich auf und fragte, ob ich Lust hätte, eine Partie mit ihm zu spielen. Aber natürlich! Bis morgens um drei spielten wir so Partie um Partie, und wie immer bei diesem Spiel – vielleicht ist es ja unter anderem zu diesem Zweck erfunden worden – vergaßen wir alles um uns herum, sogar den Orkan, der unverändert wütend gegen das Haus anstürmte. Innerhalb weniger Minuten versanken wir vollständig in jener seltsamen anderen Welt aus Winkelzügen und strategischen Überlegungen, Verlusten und Eroberungen. Wie immer, wenn ich Schach spiele, packte mich auch diesmal die Begeisterung – oder Besessenheit, schwer zu sagen –, die in jedem Fall der entscheidende Grund dafür war, warum ich dieses Spiel in meiner Jugend irgendwann ganz aufgeben musste. Angefangen hatte ich schon als Kind, aber erst mit fünfzehn wurde ich ein richtiger Schachspieler, nicht im professionellen Sinn, natürlich, obwohl mir so etwas damals zweifellos vorschwebte, vielmehr verwandelte ich mich mit fünfzehn in einen abweisenden und ganz in sich selbst versunkenen Jungen, der nur noch Schach spielte und nicht einsehen wollte, dass es darüber hinaus auch andere Dinge gab. Ich lebte geradezu in dem Schachclub Los Alfiles ganz in der Nähe unseres Hauses, und sämtliche Bücher, mit denen ich mich damals beschäftigte, hatten ausschließlich mit diesem Spiel zu tun, bis mein Vater beschloss, mich dort herauszuholen – obwohl er selbst weiterhin jeden Nachmittag zur gleichen Uhrzeit hinging –, wobei er mir unmissverständlich klarmachte, dass es auch noch eine andere Welt gab – die der Schule an erster Stelle –, eine durch und durch wirkliche, wenn auch »vielleicht nicht ganz so vollkommene« Welt, wie er sich, meiner Erinnerung nach, ausdrückte – vermutlich wusste er genau, wovon er sprach –, eine Welt, an die ich mich letztlich wohl nie so gut angepasst habe wie an jene andere Welt des Verstands und des Spielbretts. Vielleicht deshalb steigt auch, sobald ich wieder einmal Schach spiele, was bestenfalls zwei- oder dreimal im Jahr vorkommt, ein Teil jener versunkenen Gefühle wieder in mir auf, die ich empfand, wenn ich als Jugendlicher meine Aufmerksamkeit ausschließlich auf die leuchtende Klarheit des Schachspiels richtete, während die äußere Welt nicht mehr war als eine Aneinanderreihung lästiger Dinge, ein nicht enden wollendes düsteres Unwetter. Wenn ich so wieder einmal spiele, reichen mir ein oder zwei Partien selbstverständlich nicht, ob Castillo sich aber aus echter Begeisterung darauf einließ, sechs Stunden am Stück mit mir am Schachbrett zu sitzen, oder dies bloß als der vollendete Gastgeber tat, der er ist, weiß ich nicht. Erschöpft und mit Kopfschmerzen legten wir uns schließlich schlafen, während der Orkan sich weiter am Öresund ausließ, dessen Ufer wir offenbar schon seit einer ziemlichen Weile hinter uns gelassen hatten, genauer gesagt befanden wir uns inzwischen irgendwo zwischen Schweden und Dänemark, in einem Haus, das immer weiter abtrieb und stoßweise Kurs auf die norwegische Küste nahm. Kaum lag ich im Bett und schloss die Augen, schlief ich auch schon ein. Nur vier Stunden später schlug ich die Augen wieder auf, und es war nichts zu hören, ich stieg aus dem Bett, zog den Vorhang beiseite und sah hinaus: Der Orkan war endlich vorbei und hatte als Abschiedsgeschenk eine stille verschneite Landschaft hinterlassen, einen in tausend Stücken liegenden Wald, ein ruhiges und durch und durch graues Meer, einen müden Strand und einen kalten, aber friedlichen Himmel.
Während ich Kaffee kochte, stand Castillo auf, sah, was ich ein paar Minuten davor gesehen hatte, lächelte und ging daran, sich, fast ohne ein Wort zu sagen, »den Umständen entsprechend« anzuziehen, also dicke weite Kleidung, eine Mütze, Handschuhe und Wanderstiefel. Dann packte er sein Malgerät und verließ in aller Eile das Haus. So schnell, dass ich nicht gleich zusammen mit ihm aufbrechen konnte, dafür sah ich ihn wenige Minuten später durchs Fenster am schneebedeckten Strand stehen, wo er sich offensichtlich anschickte, zu malen, so dass ich erst einmal in Ruhe frühstückte, mich dann anzog und zu ihm hinausging. Davor blickte ich allerdings noch einmal durchs Fenster: Die wenige Kilometer entfernte dänische Küste war deutlich zu erkennen, ein langer Streifen Land mit niedrigen Gebäuden, an dessen einem Ende sich, scharf umrissen und wie in einem Traum, das berühmte »Hamlet-Schloss« Kronborg erhob. Auch Schiffe waren wieder zu sehen, beladen mit bunten Containern, und diese sich langsam durch die Meerenge bewegenden roten, blauen und gelben Flächen waren die einzigen Farben in der weiten grauen Landschaft, ein für mich, gerade durch seine starken Kontraste, schöner, nie gesehener Anblick. Als ich aus dem Haus trat, empfing mich heftige Kälte. Es gefiel mir, durch den Schnee auf Jorge Castillo zuzugehen, der bereits, nur wenige Meter vom Meer entfernt, mit seinen Pinseln beschäftigt war und leise brummte, als er sah, wie unzureichend bekleidet ich daherkam. Er hatte recht – keine Viertelstunde später kehrte ich auf der Flucht vor der Kälte eilig ins Haus zurück. Ich duschte, trank noch eine Tasse Kaffee, zog mich um und ging wieder hinaus. Castillo war mit seinem Bild schon ein gutes Stück vorangekommen, er malte mehrere fast vollständig mit roten Algen und Schnee bedeckte Felsen. Schlanke stille Schwäne näherten sich, mehrere Enten trieben sich ebenfalls in der Umgebung herum, wie auch zwei, drei ruhelose Hunde, Menschen jedoch waren nirgends zu sehen, als wären sämtliche Schweden im Orkan umgekommen und wir beiden die einzigen Überlebenden. Während ich dem Maler bei der Arbeit an seinem neuen Bild zusah, spürte ich bald wieder die beißende Kälte, eine Kälte, die nicht nur von dem Schnee, auf dem ich stand, auszugehen schien, sondern auch von dem grauen Himmel, dem grauen Meer, den grauen Steinen und Bäumen. Also kehrte ich ins Haus zurück, trank noch einen Kaffee und sammelte die Schachfiguren ein, die immer noch so dastanden, wie wir sie hinterlassen hatten, nur sehr wenige auf dem Brett, der Großteil dagegen – der während des letzten Spiels »geschlagen« oder ausgetauscht worden war – auf dem Tisch. Anschließend verstaute ich das Ganze in dem Lederfutteral, das ich, bereit für die nächste Partie, an Ort und Stelle liegen ließ. Und ich glaube, genau in dem Moment, als ich damit fertig war, stieg ein bekanntes Bild in mir auf: Walter Benjamin und Bertolt Brecht beim Schachspielen … in Dänemark! Wie nah oder weit von dort, wo ich mich in diesem Augenblick befand? Ich hatte keine Ahnung, dafür aber genügend Zeit, um es herauszufinden. Ich schaltete den Computer an und stellte erfreut fest, dass ich wieder Zugang zum Internet hatte, so dass ich mich mühelos auf die Suche machen konnte. Die Stadt, in der Brecht während seines ersten Exils, von 1933 bis 1939, mehrere Jahre zugebracht und wo Benjamin ihn von Paris aus dreimal – zum ersten Mal 1934 – besucht hatte, war das dänische Svendborg. Svendborg liegt, 264 Kilometer von Helsingborg entfernt, auf der Insel Fünen, und erfreulicherweise – werde ich doch leicht seekrank – brauchte ich kein Schiff zu besteigen, um dorthin zu gelangen, vielmehr ließ sich das Meer überall, wo es nötig war, auf Brücken überqueren. In wenigen Minuten legte ich mir also einen Plan für einen kleinen Abstecher innerhalb meiner Reise zurecht, einen Tagesausflug sozusagen, der vielleicht auch zwei Tage dauern mochte, und da Castillo, nachdem er drei Tage lang das Haus nicht verlassen und monatelang keinen Schnee gesehen hatte, vorläufig ganz in seiner Malerei aufging, schien es mir nicht unhöflich, ihn allein zu lassen, ja womöglich war es ihm nach dem plötzlich eingetretenen Wandel gar nicht unrecht, wenn ich verschwand. Also ging ich noch einmal hinaus und, um ihn nicht aus der konzentrierten Arbeit zu reißen, beschränkte mich auf die Mitteilung, ich würde kurz in die Stadt gehen und ihn später anrufen. Nachdem ich überprüft hatte, dass ich den Hausschlüssel eingesteckt hatte, brach ich zu Fuß ins Zentrum von Helsingborg auf. Ich brauchte mehr als eine halbe Stunde. Unterwegs konnte ich mir einen ersten Eindruck davon machen, welchen Schaden der Orkan angerichtet hatte – hier und dort lagen umgestürzte Bäume, Zäune waren niedergerissen und ganze Gärten verwüstet worden. Die Stadt stand in weiten Teilen unter Wasser, ausgerechnet die einzige Mietwagenagentur befand sich jedoch im trockenen Gebiet, so dass ich einen blauen Audi A3 mit Automatikschaltung und GPS ergattern konnte, der mich in nicht einmal drei Stunden bequem an mein Ziel brachte, zunächst über den Öresund nach Seeland, anschließend über den Großen Belt nach Fünen, mit dem Ergebnis, dass ich um halb zwei in einer schönen alten Gaststätte in Svendborg beim Mittagessen saß. Wie die Schachgroßmeister seit jeher sagen: Es ist und bleibt ein Geheimnis, wohin eine Partie einen führen kann.
Ehrlich gesagt hatte ich aber nicht nur das Schachspiel im Blick, als ich aufbrach, ebenso sehr Walter Benjamin, dessen ungewisse und ums Überleben kämpfende Fahrten durch das verrückt gewordene Europa der dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts sich erneut mit meinen kreuzten, die um einiges ruhiger und erholsamer verliefen. Nach seinem letzten Sommer auf Ibiza, 1933, ging Benjamin nach Paris, in die Stadt, die er für sein Exil gewählt hatte und in der er die letzten sieben Jahre seines Lebens zubringen sollte, mit Ausnahme mehrerer Aufenthalte in San Remo, wo seine Exfrau Dora Sophie eine Pension mit dem Namen »Villa Verde« aufgemacht hatte, und in Svendborg, wo Bertolt Brecht mit seiner Familie im Exil lebte. Die Fotos aus Dänemark von Sommer 1934 zeigen einen im Vergleich zu den Aufnahmen aus Ibiza vom Jahr davor stark gealterten und müden Benjamin, was auch für die Kleidung gilt, die er darauf trägt, kaum verwunderlich, wenn man an die unglücklichen Umstände denkt, die sein damaliges Leben bestimmten – große finanzielle Not, klares Bewusstsein seiner ungewissen Zukunft und so gut wie keine Anerkennung für seine großen intellektuellen Anstrengungen. Er war gerade zweiundvierzig geworden, sah aber aus wie sechzig. Auf mindestens drei Bildern ist er während ein und derselben Schachpartie mit Brecht im Garten von dessen Haus zu sehen, und stets liegen seine verschränkten Arme auf der Tischplatte, während sein Gegenspieler geradezu entspannt eine Zigarre raucht. Beide blicken nur einmal in die Kamera, allerdings auf verschiedenen Fotos. Offenbar spielten sie jeden Tag nach dem Mittagessen Schach, eine der meistgeschätzten Alltagsfreuden Benjamins, ja vielleicht die, welche er am dringendsten benötigte, da ihm andere wichtige Freuden damals verwehrt waren. Wie in seinen Briefen aus jener Zeit zu lesen ist, verzichtete er sogar aufs Baden im Meer – sicher war das Wasser der Ostsee zu kalt –, und auch die langen Wanderungen, die er so liebte, musste er sich sparen – die Brechts gingen nur ungern spazieren. Nachdem ich in dem Restaurant ein großartiges Elchfilet mit Kartoffeln und Gemüse und, zum Nachtisch, Apfelkuchen verzehrt hatte, ging ich zum Hafen, wo die vom Orkan hervorgerufenen Verwüstungen ebenfalls deutlich zu sehen waren, besonders an den Booten. Auch hier wurde es mir jedoch sehr bald zu kalt, weshalb ich meine Besichtigungstour abbrach und zum Auto zurückkehrte, um zu dem drei Kilometer entfernten einstigen Wohnhaus der Brechts in Skovsbostrand 8 zu fahren, das in den 1990er Jahren restauriert wurde und heute Künstlern und Wissenschaftlern die Möglichkeit zu Arbeitsaufenthalten bietet. Es handelt sich um ein typisches reetgedecktes Fachwerkhaus mit vielen Fenstern. Die dänische Schriftstellerin Karin Michaëlis, die lange in Deutschland gelebt und die Brechts dort kennengelernt hatte, ermunterte sie, sich in Dänemark niederzulassen, und beschaffte ihnen hier dieses Haus. Sie selbst wohnte auf der in der Nähe, südlich von Fünen, gelegenen Insel Thurø. Das Brecht-Haus steht in einem großen Garten, das Meer ist keine hundert Meter entfernt, der unmittelbare Zugang ist jedoch heute durch ein wenig ansprechendes modernes Gebäude versperrt. Benjamin aß hier zwar jeden Tag mit den Brechts zu Mittag und zu Abend, wohnte aber in einem Zimmer, das er in einem Haus in der Nähe gemietet hatte, von dem offenbar nichts erhalten ist. Eine ganze Weile saß ich bei laufender Heizung im Wagen und betrachtete das Haus, in dem sich niemand zu befinden schien. Es war fast vier Uhr am Nachmittag und wurde bereits dunkel. Jetzt schon nach Helsingborg zurückkehren wollte ich ebenso wenig wie bei Nacht Auto fahren, also rief ich Jorge Castillo an, um ihm zu sagen, dass er nicht auf mich warten solle, außerdem erklärte ich mit wenigen Worten, wie es zu diesem unvorhergesehenen Ausflug gekommen war, der ihn weniger zu überraschen schien, als ich vermutet hatte. Dann fuhr ich nach Svendborg zurück, um mir einen Ort zum Schlafen zu suchen. Die Nacht war eher grau als schwarz, eher trüb als dunkel, die Kälte unterschied sich dagegen nicht von der, die am Vormittag und am so kurzen Nachmittag geherrscht hatte. Ich betrat das Hotel Aero und ließ mir ein Zimmer geben, ging hinauf, um es anzusehen, und duschte. Gepäck hatte ich keins dabei. Nach dem Duschen legte ich mich aufs Bett und schaltete den Fernseher ein – wie immer, wenn ich im Hotel absteige – und klickte mich durch alle regionalen, nationalen und internationalen Programme. In den regionalen und nationalen waren Bilder der Schäden zu sehen, die der Orkan beim Durchzug durchs Land verursacht hatte, manche Gegenden waren schwer getroffen worden und mehrere Menschen ums Leben gekommen oder verschwunden. Die zwei großen Brücken, über die ich nach Svendborg gelangt war – die über den Öresund und die über den Großen Belt –, waren gesperrt gewesen und erst kurz bevor ich sie mit meinem blitzenden Automatikwagen überquert hatte, wieder freigegeben worden. Ich verließ das Hotel, um eine Runde zu drehen und irgendwo einen Kaffee zu trinken, die Straßen waren leer, still und feucht, einige Lokale waren jedoch geöffnet – durch ihre Fenster und Türen drang von den Ausdünstungen der vielen Gäste, die in ihrem Inneren alle möglichen Arten von Alkohol zu sich nahmen, gedämpftes Licht wie eine zähe Flüssigkeit. An den Eingängen vieler Geschäfte und anderer Gebäude befanden sich noch Reste von Weihnachtsdekoration. Irgendwann betrat ich eins der Lokale, bestellte statt einem Kaffee aber ein Glas Wein. Ich weiß noch, dass ich mir in diesem Augenblick sagte, im Sommer müsse Svendborg eine sehr hübsche Stadt sein, auf sanfte Weise langweilig, wie ich es mag, an einem Dezemberabend und zudem nach einem derartigen Sturm schien es dem Reisenden dagegen nichts zu bieten zu haben. Im Hotel war ich der einzige Gast und in dem Lokal, wo ich das Glas Wein trank, der einzige Ausländer. Benjamin beklagte im Sommer 1934, die einzige Unterhaltung, die Svendborg zu bieten habe, sei das Kino, aber auch das interessiere ihn inzwischen nicht mehr, weil die Filme von Jahr zu Jahr schlechter würden – schon damals vermisste er die Produktionen aus den zwanziger Jahren! –, weshalb er Skovsbostrand kaum je verließ, beziehungsweise sich dort vornehmlich in dem Zimmer aufhielt, das er im Haus einer Frau Raahange gemietet hatte, wo er an seinen Projekten arbeitete, oder aber bei Bertolt Brecht und Helene Weigel, wo er aß, Schach spielte, Radio hörte und sich ein wenig am Familienleben des Ehepaars und der beiden Kinder beteiligte. Hier war einige Monate zuvor, in der Hoffnung, sie könne neben der Brechts sicher untergebracht sein, auch ein Großteil von Benjamins Bibliothek aus Berlin eingetroffen, so dass er an diesem Ort außerdem seine eigenen Bücher zu Rate ziehen konnte. Weder Drogen noch alkoholische Ausschweifungen scheinen während seines Aufenthalts in Dänemark eine Rolle gespielt zu haben, anders als seinerzeit auf Ibiza, ebenso wenig irgendwelche Liebesabenteuer. Brecht besaß ein Auto, einen Ford, den er in seinen Briefen als den »Sohn des großen Henry« bezeichnete, allzu gut scheint er allerdings nicht funktioniert zu haben, weshalb er offenbar »nur im Notfall« benutzt wurde. Auch der ruhige Sommer des Jahres 1934 war jedoch, wie die zwei vorausgegangenen, in denen es lebhafter und lauter zugegangen war, geprägt von der üblichen Verbindung aus Licht und Schatten, wie Benjamin selbst sich wiederholt in seinen Briefen ausdrückte. Bekanntlich nimmt jeder Reisende sich auf seine Reisen mit, das lässt sich nicht vermeiden, und so hatte auch Benjamin, so oft er die Städte, Inseln oder Länder wechselte, sein Unbehagen und sein Unglück stets mit im Gepäck. In Dänemark fing es damit an, dass Brecht bei Benjamins Ankunft, am 13. oder 14. Juni, im Krankenhaus lag. Zudem war das Wetter ziemlich schlecht. Und Ende Juli ging ihm das Geld aus, weshalb er erneut seine Freundin Gretel Karplus bitten musste, ihm eiligst ein paar Scheine zu schicken, um wenigstens die dringendsten Ausgaben begleichen zu können – Brecht zu fragen wagte Benjamin nicht, keinesfalls wollte er dessen Gastfreundschaft überstrapazieren. Im September sorgte dann eine Kinderlähmungsepidemie dafür, dass Brecht, Weigel und die Kinder fluchtartig Svendborg verließen und ihre Zelte zuerst in Kopenhagen und danach in dem ganz in der Nähe der dänischen Hauptstadt gelegenen Städtchen Dragør aufschlugen. Benjamin blieb zunächst in Skovsbostrand, folgte der Familie Brecht aber wenige Tage später nach Kopenhagen und Dragør. Dort erlitt er eine schmerzhafte Nierenkolik, die ihn eine ganze Woche ans Bett fesselte. Und so weiter. Entschlossen, erst am nächsten Morgen wieder hinauszugehen, kehrte ich ins Hotel Aero zurück, es war allerdings erst halb sieben, und so schaltete ich, als ich wieder in meinem Zimmer war, den Fernseher ein und fing an, in meinem Reisetagebuch zu schreiben, später las ich eine Weile Tranströmer, ließ mir ein Sandwich bringen und legte mich hin. Als ich aufwachte, schien draußen die Sonne, und die Stadt war wie verwandelt unter dem makellos blauen Himmel, der sich über dem ebenso makellos blauen Meer ausdehnte. Ich frühstückte, gab meinen Zimmerschlüssel ab, trat auf die Straße hinaus und beschloss, zu Fuß nach Skovsbostrand zu gehen. Zügig wanderte ich auf dem Gehweg eine Straße mit Namen Kogtvedvej entlang in westlicher Richtung und konnte sehen, wie zu beiden Seiten die Leute aus den vielen kleinen Häusern in ihre Gärten traten und lächelnd in die Sonne blinzelten, die sie womöglich schon seit Wochen nicht mehr zu Gesicht bekommen hatten. Ab und zu kamen ein Auto, ein Fahrrad oder ein einsamer Jogger vorbei. Als ich schließlich wieder vor dem Brecht-Haus stand, schien es mir viel schöner als am Tag davor, und ich machte mich sogleich auf die Suche nach der genauen Stelle im Garten, wo die zwei Freunde Schach gespielt hatten – da ich die Fotografien davon kannte, war sie einfach zu finden.
Eine Schachpartie ist keine Metapher für die Welt, kann aber zu einer Metapher der Leidenschaften werden, die die Welt bewegen, der grenzenlosen Spannungen, die der Organisation der Gesellschaft innewohnen. Beim Schach laufen aber alle Bewegungen unter den Augen des anderen ab, weshalb alle Gedanken aufgedeckt werden können, es gibt hier keine Möglichkeit, zu betrügen oder geheime Absichten zu verbergen. Wer eine Partie verliert, sucht den Grund für seine Niederlage in sich selbst – seine gekränkte, vom anderen bezwungene Intelligenz versucht ein ums andere Mal, sich wieder aufzurichten, arbeitet unermüdlich an ihrer Verbesserung, um herauszufinden, welcher Zug ihr geschadet hat und welcher Zug ihr künftig nicht mehr schaden wird. Der Schachspieler weiß, dass es auf dem Spielbrett ehrlich zugeht, und wenn er verliert, muss er das mit sich selbst ausmachen, er kennt die Regeln und er erkennt sie an, seine Intelligenz hat sie ihm vorab ohne fremdes Zutun diktiert. Die bewegte Gesellschaft des Schachspiels lässt sich verstehen, sie ist gerecht und produktiv. Man verliert, kann aber auch gewinnen, man gewinnt, kann aber auch verlieren, Sieg und Niederlage sind jedoch keinem fremden Willen unterworfen, nicht einmal dem Zufall, nichts und niemand kann von außen deine Demütigung, deinen Ausschluss, dein Verschwinden verfügen. Millionen Menschen spielen Tag für Tag nach der Arbeit Schach, aber nicht nur, um die ungerechte und unverständliche Welt, die sie ablehnen, zu vergessen, sie haben es auch darauf abgesehen, eine Fiktion mit Leben zu erfüllen, die für sie an die Stelle der wirklichen Welt treten kann. Schach ist womöglich das ehrlichste aller Spiele, allerdings ist es, seiner Natur nach, auch eines der grausamsten – betrügen geht hier nicht, ein Eingreifen des Zufalls ist ausgeschlossen, das stimmt, die ungleiche Verteilung der Intelligenz spielt jedoch sehr wohl eine Rolle. Allerdings wird selbst diese Grausamkeit abgemildert, indem die Spieler sich für gewöhnlich ihrem Niveau anpassen und ihr langes Schachleben fast durchgängig unter ihresgleichen verbringen. Nur drei oder vier von Millionen Spielern auf der Welt sind unglücklich, weil sie es nicht schaffen, Weltmeister zu werden, und nie mehr als zwei oder drei von Dutzenden Spielern irgendwo, weil sie es nicht schaffen, die örtliche Meisterschaft zu gewinnen. Ein Schachspieler ist also sehr wohl bestrebt, besser zu werden und zu gewinnen, aber im gleichen Maße fügt er sich in die Beschränktheit seiner Fähigkeiten. Und auch wenn es unter Schachspielern mehr als reichlich schlechte Verlierer gibt, sollte man diese Tatsache nicht überbewerten – wer verliert schon gerne? Zudem verliert ein Schachspieler, egal, gegen wen er antritt, fast immer aufgrund irgendwelcher Irrtümer, soll heißen, weil seine Intelligenz ihn nicht rechtzeitig auf einen falschen Zug hingewiesen hat. Was im echten Leben natürlich ebenso vorkommt, kein Zweifel, aber in der menschlichen Gesellschaft kann man noch aus vielen anderen Gründen verlieren und tut dies auch häufig. Oft heißt es, Schach stehe stellvertretend für den Krieg, aber dass in dieser Welt ein Krieg mit einem Remis endet, ist ausgeschlossen.
Im Garten des Brecht-Hauses, genau an der Stelle, wo im Sommer 1934 die Schachpartien ausgetragen wurden, ließ ich meiner Fantasie freien Lauf. Die erhaltenen Fotos stammen alle von derselben Partie, und aus dem, was darauf zu sehen ist, kann man zunächst einmal schließen, dass die beiden sich, nach etwa einem Dutzend Zügen, bereits im Mittelspiel befinden, Benjamin zieht mit den schwarzen Figuren und hat sich offensichtlich für die französische Verteidigung entschieden, eine schöne Eröffnung, bei der die Bauern versuchen, rasch das Zentrum zu beherrschen und auf der Seite der Dame eine gewisse Überlegenheit zu ermöglichen. Obwohl Benjamin nur ein gewöhnlicher Amateurspieler war, verfügte er also, wie man ebenfalls folgern kann, über Grundkenntnisse, was die verschiedenen Eröffnungsvarianten angeht, und das scheint auch für Brecht zu gelten; dessen Antwort auf die von seinem Gegenspieler gewählte Verteidigung offenbart jedenfalls, obgleich es vielleicht bessere Lösungen gegeben hätte, dass er durchaus einer theoretischen Richtschnur folgte. Folgern kann man außerdem, was für eine Art Spieler der Erste war, wenigstens wenn er mit den schwarzen Figuren zog: eckig, kantig, spitz. Noch mehr dazu kann man dem letzten der vier Nachrufe in Gedichtform entnehmen, die Brecht Benjamin 1941 widmete, dort heißt es unter anderem: »Ermattungstaktik war’s, was dir behagte / Am Schachtisch sitzend in des Birnbaums Schatten.« Gershom Scholem wiederum schrieb, als er in den Jahren 1915 und 1916 mit Benjamin Schach gespielt habe, sei dieser »ungeheuer langsam und sichtlos« vorgegangen, und »da ich viel schneller spielte, war er sozusagen immer am Zug«. Die Stellung der Figuren auf dem Foto, auf dem Brecht in die Kamera blickt, zeigt, dass der Philosoph die Initiative ergriffen hat und dank seines taktischen Bauerneinsatzes das Spielzentrum beherrscht. In jedem Fall sind in dieser Partie bis dahin eindeutig die – weißen wie schwarzen – Bauern am meisten zum Einsatz gekommen. Was danach geschah, soll heißen: Wie das Spiel ausgegangen ist, werden wir nie erfahren, es sei denn, eines Tages tauchen weitere Fotos auf, die es uns verraten. Die Körperhaltung der beiden Spieler lässt womöglich noch eine Schlussfolgerung zu: Während der rauchende Brecht sich sehr entspannt, ja geradezu sorglos zeigt, wirkt Benjamin konzentrierter, die Arme liegen verschränkt auf dem Tisch, das Gesicht ist ernst. Brechts König hat noch nicht rochiert, Benjamin selbst dagegen scheint genau dies getan zu haben – hinter einer Mauer aus Bauern verschanzt, macht er sich vielleicht bereit zu einem beherzten Angriff auf seinen Gegenspieler. Benjamins Freunde hassten Brecht, und noch mehr hassten sie die Freundschaft der beiden, die sie nicht verstanden und vor der sie Benjamin immer wieder in Briefen warnten. Adorno, Scholem, Bloch und Kracauer warnten Benjamin aber nicht nur – häufig mit wenig freundlichen Worten – vor dem in ihren Augen schlechten Einfluss Brechts auf sein Denken, sie machten sich auch, wenn sie sich untereinander schrieben, über diese Beziehung lustig, Benjamins Haltung erschien ihnen unterwürfig, Kracauer bezeichnete sie einmal sogar als »sklavischmasochistisch«. Aber was das anging, wie auch in manch anderer Hinsicht, ließ Benjamin sich von seiner Intuition leiten, die allezeit sehr unterschiedliche, ja sogar einander widersprechende Interessen einschloss. Seine Bewunderung für Brecht war ehrlich und bestand schon seit langem – seit die beiden sich 1924 kennengelernt hatten –, Benjamins Freundin Gretel Karplus, die spätere Frau Adornos, deutet in einem Brief allerdings an, dass sie auch mit Benjamins aktueller persönlicher Lage zu tun haben könnte, die in der Tat verzweifelt war, weshalb man auch von Abhängigkeit sprechen könne. Benjamin war freilich von all seinen damaligen Freunden und Bekannten abhängig, ebenso von dem Geld, das Gretel Karplus ihm schickte, was ihn zu einem durchaus taktierenden, zugleich aber auch verletzlichen Gefährten machte, wie seine Briefe deutlich zeigen. Bei der auf den Fotos zu sehenden Schachpartie hat er kampflustig eine klar überlegene Stellung eingenommen, und es ist schwer vorstellbar, dass er sie in den folgenden Zügen wieder verloren haben könnte. Liest man jedoch sein Tagebuch, kann man auf den Gedanken kommen, in anderer Hinsicht habe Benjamin sich, wie seine Freunde vermuteten, Brecht gegenüber nicht so kämpferisch verhalten, zum Beispiel in Bezug auf die Literatur, was an der echten Bewunderung gelegen haben mag, die der Dichter für den Dramaturgen empfand, aber auch daran, dass er seinem eigenen literarischen Urteil misstraute, was wiederum nicht allzu sehr überraschen sollte, wenn man bedenkt, mit welcher Leidenschaft Benjamin damals so merkwürdige Lektüreempfehlungen abgab wie etwa Richard Hughes’ Orkan über Jamaika oder Henry de Montherlants Die Junggesellen.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.