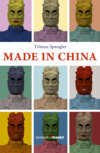Buch lesen: «Made in China»
Tilman Spengler
MADE IN CHINA

© 2021 by :TRANSIT Buchverlag
Postfach 120307 | 10593 Berlin
Umschlaggestaltung: Gudrun Fröba
eISBN 978-3-88747-403-4
INHALT
Ankunft
Besuch in Yan˚an
Große Erwartungen
Der falsche Mao
Korrekturmaßnahmen
Industrie ohne Rauch
Besucher aus der Fremde
Briefwechsel
Zeichen der Veränderung
Die neue Freiheit
ANKUNFT
1
Leo Zwirn ist übrigens nicht aus freien Stücken nach Xi’an unterwegs. Auch wäre ein einheimisches Flugzeug nie das Transportmittel seiner Wahl gewesen. Alle Maschinen des chinesischen Luftverkehrs unterstehen seit der Befreiung des Landes vor gut zehn Jahren dem Militär. Die Geräte sind darauf eingerichtet, eine größtmögliche Anzahl von Passagieren auf einem sehr begrenzten Raum zu befördern. In den Berechnungen der chinesischen Luftwaffe ist zudem die Gestalt eines mageren Rekruten aus dem Süden des Landes das Maß aller Dinge.
Diesem Modell entspricht Leo Zwirn allerdings nicht einmal in einer vagen Annäherung. Zwirn misst von den Stiefeln bis zum Schopf seiner dunkelblonden Haare fast zwei Meter, er ist zwar schlank, doch wenn er auch nur einigermaßen den Vorgaben von Rückenlehne und Sitzfläche entsprechen will, muss er die Schultern einziehen und die Beine zur Brust klemmen.
Zwirns Bestimmungsort ist das Museum der früheren Kaiserstadt Xi’an. Hier soll der junge russische Spezialist für Museumsangelegenheiten die chinesischen Genossen »beim technischen Aufbau« unterstützen, wie es recht unbestimmt in den Dokumenten steht, die seiner Ankunft vorausgeschickt wurden.
Auch das Museumsgebäude ist ein Geschenk der sowjetischen Freunde. Es wurde Anfang der Fünfzigerjahre, also vor nicht einmal einem Jahrzehnt, gebaut und ist ein fünfstöckiger Triumph des Blauen Betons und der kargen Linienführung.
Eine besondere Geschichte wird von seinem Dach erzählt. Ursprünglich hatten die Architekten das Gebäude mit einem Flachdach entworfen, sparsam, funktional, fortschrittlich, doch bald nach der Fertigstellung murrten viele Bewohner von Xi’an, weil das kantige Gebäude, das direkt an die alte Stadtmauer grenzt, ihre Vorstellung von architektonischer Harmonie verletzte.
Eine Zeit lang wurde dieser Protest von der Parteiführung als »Überrest des feudalen Denkens« kritisiert, doch schließlich erhielt die Zweite Brigade der Städtischen Holzarbeiter den Auftrag, dem sowjetischen Betonkörper ein traditionelles chinesisches Dach aufzusetzen. Als Beitrag zum kulturellen Miteinander. Ein schmuckes, von Hand geschnitztes Holzdach, getragen von roten und grünen Säulen. Bestückt mit den vertrauten speienden Drachen und anderen Fabelwesen, die böse Geister abschrecken. Bedeckt mit hell schimmernden gelben Ziegeln, deren Glitzern schon aus der Ferne wahrnehmbar ist.
Das gilt allerdings nicht für Tage im Frühling wie dem, an dem Leo Zwirn ankommt. Da »geben die Wolken ihre Geheimnisse nicht preis, dem Karren bricht hinter dem Ochsen die Deichsel«, wie es im chinesischen Bauernkalender vorausgesagt wird. Für die zweimotorige Maschine, die den russischen Gast nach Xi’an bringt, bedeutet die stürmische Wetterlage ein langes Umkreisen der Stadt und das plötzliche Absacken in immer tiefere Luftlöcher. Zucken Blitze? Selbstverständlich, doch erkennbar nur, wenn man sich noch traut, aus den beschlagenen kleinen Bullaugen zu blicken. Dafür flackert im Flugzeug ein unruhiges Licht. Die künstliche Belüftung ist ausgefallen, und ein scharf säuerlicher Geruch liegt wie eine Glocke über der engen Kabine der Passagiere.
Irgendwann setzt das Flugzeug dann doch holpernd und wild schwankend auf dem Flugfeld auf. Mit weichen Knien tappt Zwirn die Stufen der Gangway hinunter. Auf der Aussichtsterrasse des Flughafengebäudes, der Regen hat gerade ausgesetzt, sieht er ein Transparent, das von zwei Männern trotz des immer noch heftigen Windes hochgehalten wird, auf dem in kyrillischer Schrift hellrot die Worte stehen: »Das Provinzmuseum begrüßt aus glühendem Herzen unseren russischen Sputnik.«
Zwei Stunden später, das Wetter hat sich wieder verschlimmert, erreicht der Wagen, der ihn abgeholt hat, die Stadtgrenze von Xi’an. Dreimal musste der Fahrer aussteigen, um Schlamm zu entfernen, den die Scheibenwischer des Dienstwagens nicht beiseiteräumen konnten. Doch als viel ärgerlicher empfindet Leo Zwirn den Verlust von einem Koffer und einem Reisesack, die offenbar beim Umsteigen auf der Strecke geblieben sind. Zwirn verflucht zum wiederholten Mal den Tag, an dem er sich auf dieses Abenteuer eingelassen hat.
2
»Heute finden uns weder Bomber noch Engel,
nicht einmal eine Elster findet den Weg
unter unser Dach, schon gar nicht zwei,
nicht einmal Elstern…«
singt, wie häufig an solchen Tagen, Frau Wang, die Leiterin der Abteilung für Restaurierung und Konservierung. Manchmal summt sie auch nur die Melodie und klopft dabei mit einem Pinselstiel den Takt auf die bunt verschmierten Blechdosen und Porzellantiegel auf ihrer Werkbank. Das Reich der Frau Wang liegt im Untergeschoss des Museums, und die Restauratorin ist eine strenge Herrscherin. Nein, nicht direkt streng, doch schwer zugänglich, wie die Kollegen sagen: eine Thermoskanne, die nach außen nicht verrät, was in ihr vorgehen mag.
Recht besehen hätte Frau Wang zum Empfang des Gastes auf dem Flughafen erscheinen müssen, als dritte Figur rechts, neben dem Museumsleiter und dem Parteisekretär. Doch das böse Wetter hat gefügt, dass nur der kleine Dienstwagen zur Verfügung steht, da wäre für sie kein Platz gewesen, man will schließlich den Gast mit seinem Gepäck nicht einpferchen.
Frau Wang empfindet den heftigen Regen als einen seltenen Gunstbeweis des Schicksals. In ihrer Werkstatt fühlt sie sich beschützt von den Objekten, die auf ihre Aufmerksamkeit warten, und wenn ihre Nase gerade darauf achtet, genießt sie auch den anregenden Geruch von Lösemitteln, indischem Dammarharz und anderen Substanzen, die für ihre Arbeit wichtig sind.
Weit, weit weniger wichtig sind dagegen fremde Besucher, die unter irgendwelchen Vorwänden ihren Frieden stören. Besucher aus der Stadt etwa, die gegen Abend in ihr Reich eindringen und nur wissen wollen, was sie für eine blauweiße Vase aus dem Mittelalter verlangen dürfen, wenn sie dieses Kunstwerk pflichtgemäß der staatlichen Ankaufskommission anbieten sollten. Noch weniger Geduld bringt Frau Wang für die Abgesandten der lokalen Parteizentrale auf, die, einer Direktive der vorgesetzten Behörde nachgehend, herrisch fragen, welche »metallhaltigen« Objekte aus dem Bestand des Museums für die Einschmelzung und Umwandlung in »versorgungswichtige« Güter infrage kommen.
Am wenigsten mag Frau Wang Besucher aus den sozialistischen Bruderländern, die ihr Ratschläge über »fortschrittliche Techniken der Konservierung und Restaurierung« erteilen wollen. Sowjetische Berater pflegen bei solchen Begegnungen ihre Nase ganz besonders hoch zu tragen und auf die Schätze aus China zu verweisen, die in ihren eigenen Depots lagern: »Sie sollten einmal das Porzellan sehen, das der König von Sachsen damals nach Dresden bringen ließ.« – »Unsere Yuan-Vasen in der Sir Percival David-Sammlung im Britischen Museum…« – »Schade, dass wir sie nicht in den Vatikan einladen können…«
Fast ausnahmslos sind es männliche Experten, die zu ihr in den Keller geschickt werden, und es erstaunt Frau Wang schon lange nicht mehr, mit welch schlichten Gesten diese Besucher versuchen, die Beschreibung einer klassischen Vasenform in ein plumpes erotisches Verlangen umzudeuten. Gut, die Reisenden sind oft wochenlang allein mit ihresgleichen unterwegs, das sorgt für einen gewissen Stau und den entsprechenden Druck im Triebleben. Und es ist auch nicht zu leugnen, dass Frau Wang in vielerlei Hinsicht einem Bild der chinesischen Schönheit entspricht, das häufiger in der Malerei als auf offiziellen Delegationsbesuchen anzutreffen ist.
»Unser Land«, sagt die Restauratorin bei diesen Gelegenheiten, »steht wirtschaftlich vor großen Aufgaben. Wir verfügen jedoch im Bereich des Kunstgeschehens über eine sehr alte Tradition, über eine Handwerkerkunst, die über Generationen weitergereicht wurde, sowie den Zugang zu internationalen Publikationen.«
Immer wieder bereitet es ihr ein heimlich gurrendes Vergnügen, diese hölzernen zwei Sätze auszusprechen. Sie befördern Frau Wang gleichsam auf Stelzen aus jeder Unterhaltung, die ins Private abzuzweigen droht. Deswegen beherrscht sie diesen Zauberspruch auch auf Russisch. Dem neuen Gast aus der Sowjetunion, dessen Begrüßung auf dem Flughafen sie zu ihrem Glück verpasst hat, sieht sie daher mit heiterer Gelassenheit entgegen.
Im Museum gilt Frau Wang übrigens kaum als Sonderling. Klar, sie ist Anfang, vielleicht auch schon Mitte dreißig und hat noch keinen Mann. »So etwas ist einfach ungesund für eine Frau«, sagt die für das Museum zuständige Betriebsärztin, »die Eierstöcke werden starr, und von der Milz kommt keine Energie.« Die Betriebsärztin hat, das ist nicht ihre Schuld, nur eine sehr einfache Ausbildung erfahren, doch ihr Wort setzt ein Urteil, gegen das nur Schweigen als Widerspruch taugt.
Aber hat man denn Frau Wang im Museum je anders als in einer hochgeschlossenen schwarzblauen Uniform unter ihrem Kittel gesehen? Dunkel ist selbst die Baumwollunterwäsche, die im Winter kurz aus den Ärmel- und Hosenrändern dieser Uniform herausdrängt. Immerhin, auf niemanden ist mehr Verlass, wenn es um zwei ganz wichtige Dinge geht: Frau Wang hilft jederzeit, wenn es um das Abfassen eines Schreibens, insbesondere eines Schreibens an Behörden geht. Sie trifft Töne, deren Schall die dicksten Türen von Amtsstuben durchdringt. Und sie hat, zweitens, Verbindung mit Menschen, die über das ganze Land verteilt leben. Keine Spinne kann sich in einem so weiten Netz bewegen und ist dabei noch so hilfsbereit.
Was bedeutet dagegen schon, dass Frau Wang immer wieder dieses merkwürdige Lied aus den Vierzigerjahren singt, wenn sie allein vor ihrem Arbeitstisch sitzt? »Weder Bomber noch Engel, nicht einmal eine Elster findet den Weg« ist der Titel eines Gassenhauers, den der Onkel der Frau Wang seiner kleinen Nichte vorsang, als sie mit ihm und ihrem Vater die Nächte des japanischen Bombardements in einem Schutzkeller in Shanghai verbrachte. »Nicht einmal Elstern«, lautete der Refrain. Elstern sind bekanntlich Glücksbringer. Wenn sie nicht gerade stehlen.
Die Zerstörung von Shanghai ist jetzt fast zwanzig Jahre her. Frau Wang hat seither, soweit sie weiß, keine Angehörigen mehr. Alle persönlichen Dokumente sind mit dem Vater, dem Onkel und deren Aktentaschen in einer jener Nächte verbrannt. Allerdings ist der Nachname der Frau Wang hierzulande sehr weit verbreitet. Für eine ausgebildete Restauratorin liegt selbst in diesem unglücklichen Umstand noch eine Fingerspitze Hoffnung. Schon aus winzigen Fundstücken lässt sich mit etwas Geschick und Entschlossenheit lebendige Geschichte wiederherstellen.
3
Die vier alten Frauen treffen sich jeden Morgen im Park des Museums, selbst bei ganz schlimmem Wetter. Doch heute nieselt es nur leicht, und es liegt auch kaum ein Hauch von Schwefel in der Luft. Die Frauen schieben die Kinderwägen ihrer Schutzbefohlenen sauber ausgerichtet vor die zwei Holzbänke, links neben dem Marmorsockel, der bereits vor zwei Jahren für eine Statue des Parteivorsitzenden Mao angefertigt wurde. Das Denkmal ist allerdings noch nicht fertig, weil die Künstler und ihre Auftraggeber noch über dessen Höhe und den Gesichtsausdruck des Vorsitzenden streiten. Die einen wollen Mao groß und heroisch, die anderen fordern Realismus und Weisheit, wie es das Antlitz auf den Banknoten ausstrahlt.
Die Frauen rauchen dieselbe Marke wie der Vorsitzende ihrer Partei, mithin eine Luxusmarke, und bereden die Vorgänge, auf die es ankommt. Niemand in dieser Stadt, vermutlich nicht einmal der Chef des Amtes für Öffentliche Sicherheit, weiß mehr als diese Frauen von Gerüchten, geheimen Verabredungen, zusammenlaufenden Fäden oder den rätselhaft zutage tretenden Quellen des Schwarzmarktes.
Zunächst geht es um ein Flugzeug, das gestern vielleicht abgestürzt und in Flammen aufgegangen ist.
»Nicht abgestürzt, nur notgelandet.«
»Der Traktorfahrer sagt, er habe acht Fallschirme gesehen.«
»Acht ist eine Glückszahl.«
»Diese Schirme, habe ich gehört, sollen aus einer ganz besonderen Seide sein. Bin schon sehr gespannt. Feste Seide kriegt man heutzutage nur noch ganz selten. Reiner Luxus, wenn ihr mich fragt, aber nur, wenn diese Dinger wirklich echt sind.«
Der Nieselregen hat aufgehört, die Farben der Wolken über dem Park spielen von leichtem Sepia in goldgewirktes Rosa. Die vier Frauen wechseln das Thema.
»Melonen aus Hami, echte, himmlisch süße Melonen aus Hami. Morgen, ganz früh in der Kantine der Werktätigen in der Weststraße.«
»Und frischer Tintenfisch soll auch in dem Flugzeug gewesen sein. Wenn es nicht verbrannt ist. Tintenfisch haben wir hier schon lange nicht mehr gehabt. Nur früher aus Russland. Aber das waren Konserven.«
»Die hier in unserem Museum sollen einen ausländischen Experten aus Russland kriegen, einen Russen, der schon eine schwarze Geschichte mitbringt und den sie vergessen haben, als überall im Land die Russen verschwinden mussten. Er soll für unsere Führung etwas mit den Imperialisten regeln.«
Vor der Wand des Westflügels bewegt sich mit kleinen, ruckhaften Bewegungen ein großer Regenschirm ins Bild. Er könnte einmal ein gelbes Prachtstück mit strahlend rotem Rand gewesen sein, jetzt zeigt er die scheckige Farbe von abgeworfener Baumrinde.
Dieser Schirm gehört zur Ausstattung des alten Märchenerzählers, der seit fünfzehn Jahren davon lebt, mit seiner traurig fistelnden Stimme historische Geschichten vorzutragen, die er mit dramatischen, selbstgemalten Schaubildern illustriert. Die Gemälde bewahrt er im Anhänger seines Fahrrads, der auch die Bühne ist. Über einen Kettenzug, den er mit seinen Fahrradpedalen bewegt, kann der Märchenerzähler gleichzeitig seine Geschichten vortragen und die dazugehörigen Personen auftreten lassen. Früher waren das böse Fuchsgeister und unglückliche Feen, heute sind es die Helden des Sozialismus und deren Widersacher.
Naturgemäß wechseln die politischen Helden und die Schurken oft über Nacht. Der Märchenerzähler hat dafür ein Gespür, das ihm den geheimnisvollen Nimbus eines Wahrsagers verschafft hat. Das Wort Nimbus bedeutet auch im Chinesischen »dunkle Wolke«.
Die vier Frauen begrüßen ihn daher mit scheu kichernder Freundlichkeit: »Genosse Bao, kommen Sie zu uns, wir reden gerade über alte Konserven wie uns.«
Später wird es donnern, das gehört zum Frühling, der den Staub aus der Wüste in die Stadt treibt. Die alten Frauen drehen ihre Schutzbefohlenen auf den Bauch und stopfen ein paar Lagen alter Moskitonetze über deren Köpfe, bevor sie die Kinderwägen mit wiegenden kleinen Schritten aus dem Park schieben.
4
Von der Ankunft des Russen im Museum für Kunst und Geschichte existieren noch einige Rollen Schwarzweißfilm im 8mm-Format, aufgenommen wohl mit einer Ekran 8. So heißt jene Handkamera, die Anfang der Sechzigerjahre in Leningrad hergestellt wurde.
Das Gerät wird aufgezogen wie eine Spieluhr, bringt aber nach längerem, manchmal auch schon nach kürzerem Gebrauch nicht mehr die mechanische Spannung zustande, die für eine konstante Drehgeschwindigkeit nötig wäre. Beim Abspielen folgen die Bilder dann ihrem eigenen Rhythmus. Oft brechen sie zunächst in einen ansatzlosen Galopp aus, der alles Geschehen brüsk zusammenrafft. Darauf kann dann genauso übergangslos eine feierliche, bleierne Trägheit aller Bewegungen folgen. Der kurze Streifen bestimmt so nicht nur seine eigene Zeit, er versieht die Handlung auch mit ganz unterschiedlichen Deutungen.
Daher können wir heute die fast opernhaft ausladende Handbewegung, die der junge Russe in seinem Pelzrock mit dem ausgestreckten rechten Arm vollführt, als einen herzlichen Willkommensgruß sehen. Dann war der Filmstreifen bei der Aufnahme zu rasch durchgezogen worden, weil die Spieluhr plötzlich ein hektisches Tempo aufgenommen hatte. Auf einer anderen Filmrolle können wir dieselbe Geste als ein unwirsches Fortscheuchen des chinesischen Empfangskomitees wahrnehmen. Das wäre allerdings höchst ungewöhnlich für den Geist der Epoche, es sei denn, Leo Zwirn wäre seiner Zeit um ein paar Nasenlängen voraus gewesen. Oder Filmkader.
Die Gastgeber, also der Parteikommissar und der zivile Leiter des Museums, stehen streng militärisch ausgerichtet und mit geschlossenen Fäusten an den Hosennähten nebeneinander. Ihre Mienen entsprechen den einschlägigen Richtlinien der militärischen Dienstvorschrift 772. Dieses Handbuch der Armee regelt den korrekten Gesichtsausdruck bei offiziellen Festakten. »Ernst, fest und furchtlos« sollen die Mienen sein.
Zwei lange Spruchbänder, die vom Dach des Museums herabhängen, erläutern den wenigen Passanten im Park den Anlass der Zeremonie: »Die Archäologen der Provinz begrüßen warmherzig den aus der UdSSR entsandten Kunstexperten Leo Zwirn«, steht auf dem rechten Band, dem der böige Wind immer wieder die beiden Zeichen für »warmherzig« zu einem kleinen Ballon aufbläst.
Die Schriftzeichen auf dem linken Band sind deutlich kleiner ausgeführt, weil hier mehr an konkreter Botschaft zu verkünden ist. Zusammengefasst lautet die Nachricht, der sowjetische Genosse Leo Zwirn sei als ausländischer Experte nach Xi’an gekommen, um hier an der vordersten Front archäologischen Fortschritts seinen Beitrag dafür zu leisten, »dass das imperialistische England auch auf diesem Feld in weniger als fünfzehn Jahren übertroffen wird«.
»In fünfzehn Jahren haben wir die Engländer in allem übertroffen«, erläutert der Parteisekretär des Museums, der volksnahe Beispiele liebt und daher hinzufügt: »von der Archäologie bis zur Produktion von Bratschüsseln.«
Die Einbeziehung der Bratschüsseln in den Zusammenhang von Kunstgeschichte überfordert den russischen Gast zunächst, denn auch seine junge Übersetzerin scheint sich ihrer Sache nicht völlig sicher zu sein: »Museum wird hoffentlich bald besser sein als englische Bratpfannen«, sagt sie mit einem halbherzigen Lächeln, das ängstlich um keine Nachfrage fleht. »Sehr bald besser«, fügt sie noch hinzu, um ihren Worten eine neue Klarheit zu verschaffen.
»Der Genosse Parteisekretär benutzt hier das Bild vom Museum als einem Gastmahl«, versucht sie es noch einmal. Ihr Lächeln strahlt nun Zuversicht aus. Zwirn nickt wieder höflich, als habe er die Botschaft jetzt verstanden. Er hat während der Rede anderen Gedanken nachgehangen, der Frage etwa, in welcher Tasche er seine Kofferschlüssel aufbewahrt hat. Oder ob die Gunst der Dolmetscherin eher mit einem französischen Lippenstift oder mit der Einladung, sie als Sprachlehrerin in seine Dienste zu stellen, zu gewinnen wäre.
Die Worte »Museum als Gastmahl« setzen aber plötzlich ganz unerwartete Gedankenketten in ihm frei. Bisher hat er die Institution »Museum« ohne größeres Nachdenken immer als einen Ort der Bewahrung begriffen. Als einen Ort von Schätzen, den sich eine Stadt, ein Staat bewahrt, gleichsam eine Grablege mit öffentlichem Zugang. Aber wenn man »Museum als Gastmahl« einmal weitläufig auslegt, dann kommt man schnell zum Gedanken des »Museums als Laboratorium«. ›Wie in einer guten Küche‹, denkt Zwirn, ›liegen hier doch alle Rezepte und Zutaten bereit, um an diesem Ort Neues, bislang noch nie Erdachtes, nie Gewagtes zu schaffen.‹
Auch seine beiden Gastgeber denken gerade über die Zukunft des Museums nach, doch diese Gedanken sind düster. Vor drei Monaten haben sie erfahren, dass ihrem Haus die Schließung drohe, wenn es nicht innerhalb des nächsten Jahres »von einer Flutwelle der revolutionären Kunstbegeisterung erfasst würde«, wie es im Schreiben des vorgesetzten Parteikomitees formuliert wurde. Dabei ist das Museum bereits geschlossen, einmal, weil sich im Beton bedenkliche Risse aufgetan haben, zum anderen, weil der Direktor und die Parteiführung in heftigem Streit darüber liegen, ob Kunst aus der Feudalzeit wirklich Kunst genannt werden könne. Der Streit dauert an. Dabei wissen beide Seiten um die verheerenden Konsequenzen, sollte ihnen nicht bald ein Erfolg beschieden sein.
Vor dem Museum schmiegt jetzt der Wind die Bänder mit den Schriftzeichen zu einem ausgelassenen Schlangenpaar, dann trennt er sie wieder wie ein strenger Tanzmeister. In der Schlusssequenz des Films weist das Ende des zugespitzten rechten Bandes auf den breiten Schädel des rechten Flügelmanns aus dem Empfangskomitee. Nur wenige Handbreit über dessen einfacher Ballonmütze ist ein Datum zu lesen: Der Gast aus der Sowjetunion wird hier am 7. März 1960 willkommen geheißen.
Ob die festlichen Inschriften in nicht wasserfesten und überhaupt nur schwachen Farben gehalten waren, wie später von bösen Zungen behauptet wurde, lässt sich bei dem grobkörnigen Schwarzweißfilm naturgemäß nicht feststellen.
Wer immer die Kamera führte, hat jedenfalls die beiden Texte trotz der Windstöße in einem ruhigen, senkrechten Schwenk festgehalten und dann sein Objektiv vorsichtig weiter nach rechts gelenkt, um beim Ehrengast zu verweilen. Die Aufnahmen zeigen einen jungen Mann von vielleicht Anfang dreißig, dessen rechte Stirnhälfte von langen, dunkelblonden Locken bedeckt wird. Das Gesicht ist eher oval als rund, die Nase markant, doch makellos gewölbt. Die Lippen sind anmutig geschwungen, »sehr sinnlich«, wie es die Restauratorin Wang noch am Nachmittag in eine kleine Kladde notiert, die verschlüsselt und als Dienstakte getarnt ihre Erinnerungen bewahrt. Die Restauratorin ist sehr kritisch, wenn es um Nasen und Lippen geht. Am eindringlichsten aber beschäftigen Frau Wang die Augen des Russen, mehr noch: der Blick aus diesen dunkelbraunen Augen. Man erkenne Schwermut und Sehnsucht, hält sie fest, sie müsse an einen Dichter denken, vielleicht auch an den Schöpfer anderer genialer Kunstwerke, vielleicht einen Bildhauer. In jedem Fall etwas Großes.
»Seine Frisur«, sagt der politische Kommissar, nachdem sich das Komitee zur Besprechung des Empfangs zurückgezogen hat, »diese Frisur ist mir zu unordentlich.«
»Sie ist wild«, pflichtet ihm Frau Wang bei, die heute wegen der Erkrankung einer Kollegin das Protokoll zu führen hat, schreibt aber dort das Wort »wild« dem Kommissar zu.