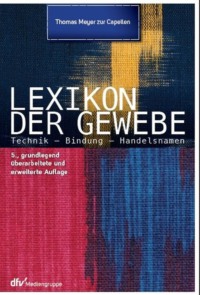Buch lesen: "Lexikon der Gewebe"
Thomas Meyer zur Capellen
Lexikon der Gewebe
Thomas Meyer zur Capellen
Lexikon
der Gewebe
Technik – Bindungen – Handelsnamen
5., grundlegend überarbeitete und erweiterte Auflage

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.ddb.de abrufbar.

ISBN 978-3-86641-258-3
© 2015 by Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
Umschlag: Ingo Götze, Frankfurt am Main
Titelfotos: Helmut Meyer zur Capellen, Fotograf
Lektorat: Sabine Rock, Frankfurt am Main, www.druckreif-rock.de
Satz: Publishing Services Werner GmbH, Rödermark
Vorwort zur 5. Auflage
Dank der regen Nachfrage unserer textil interessierten Leserinnen und Leser können wir Ihnen nun die fünfte, aktualisierte und erweiterte Auflage des Lexikons der Gewebe vorstellen. Neben grundlegenden Informationen über Bindungskonstruktionen und Gewebearten finden Sie darin ebenso Einträge zu den textilen Handels- und Qualitätsbezeichnungen sowie den für den Einkauf wichtigen fabric constructions (order sheets, Warenbeschreibungskarten). Thematisiert werden darüber hinaus zahlreiche Verarbeitungsstufen vom Rohstoff über das Garn bis zur anschließenden Veredlung. Grundlegende Stichworte der Färberei und Druckerei sind noch einmal erweitert worden. Um dem internationalen textilen Markt gerecht zu werden, sind fehlende, textile Rohstoffe hinzugekommen – insbesondere die Tierhaare (u. a. Kanin, Lama, Kamelhaar) –, außerdem eine aktualisierte Tabelle der Weltfaserproduktion. Erläutert werden auch die wichtigen Änderungen der Textilen Kennzeichnungsordnung.
Den bewährten und eingeführten Titel Lexikon der Gewebe haben wir beibehalten, obwohl der Inhalt ein weit größeres Spektrum der Textilwelt abbildet. Ausführlich behandelt werden u. a. das Thema Nachhaltigkeit (z. B. Brundtland-Bericht), neue Veredlungsformen (z. B. bionic finish) und die neuesten Druck- und Färbeverfahren (z. B. 3-D-Druck und wasserloses Färben). Zahlreiche neue, vierfarbige Abbildungen – sowohl Übersichts- als auch Detailbilder – illustrieren die Stichworteinträge sehr anschaulich.
Aktualisiert wurden neben einigen Tabellen auch teilweise vergessene Markenprodukte der ehemaligen DDR (z. B. Dederon, Wolpryla), die heute wieder vermehrt im Markt angeboten werden. Dem wachsenden Textilimport aus dem asiatischen und südamerikanischen Raum trägt das Lexikon zum einen mit der Übersetzung der Begriffe ins Englische, zum anderen mit dem erweiterten alphabetisch geordneten Verzeichnis englischdeutscher Fachbegriffe im Anhang, Rechnung.
Für folgende Zielgruppen ist dieses Buch eine wertvolle Informationsquelle und Hilfestellung:
Studierende der Fachrichtung Design-Management und Modedesign, Modejournalisten, Bekleidungstechniker, Gewandmeister, Schneiderhandwerk, Erziehungswissenschaftler und Direktricen. Das Lexikon richtet sich ebenso an den Textileinkäufer (Einzel- und Versandhandel im In- und Ausland) wie an Abteilungen der Qualitätsentwicklung und -sicherung und nicht zuletzt an den textilinteressierten Laien.
Mein großer Dank gilt der langjährigen Betreuung durch Frau Caroline Schauwienold und Frau Sylvia Frühauf, die mir bei dieser fünften Auflage Frau Sabine Rock als Lektorin zur Seite gestellt haben. Mit ihrer Erfahrung und dem hohen Einfühlungsvermögen in die Textilwelt hat sie zusammen mit Herrn Dr. Rüdiger Werner, der die sorgfältige Schlussredaktion vorgenommen hat, dieser neuen Auflage einen bemerkenswerten Feinschliff gegeben.
Bei den Stichworten, für die textilchemisches Wissen notwendig war, habe ich mich wieder vertrauensvoll an die Koryphäe der Textilchemie gewandt, meinen Kollegen und Freund Prof. Jochen Tensfeldt. Ihm gilt mein besonderer Dank.
Ein besonderer Dank geht auch an meinen Bruder Helmut, der mit seinem fotografischen Einfühlungsvermögen die farbigen Textilaufnahmen gemacht hat.
In diese Neuauflage sind auch viele Ratschläge meiner AMD-Kollegen und -StudentInnen eingeflossen, für die ich mich herzlich bedanken möchte – ebenso wie für die Unterstützung vieler Textilfirmen aus Industrie und Handel. Sie alle haben dazu beigetragen, das Lexikon zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk zu machen.
Ich wünsche Ihnen, den Leserinnen und Lesern, dass das Lexikon der Gewebe Sie weiterhin im täglichen Umgang mit textilen Produkten erfolgreich unterstützt.
Hamburg, im Januar 2015
Thomas Meyer zur Capellen
Inhaltsverzeichnis
Patronendarstellungen der Grundbindungsarten und Kettsowie Schussschnitte
Für jeden, der sich mit Geweben befasst, sind die Kenntnisse der Bindungstechnik unverzichtbar. Nachfolgend werden deshalb die am häufigsten verwendeten Konstruktionen dargestellt. So wird ein direkter Vergleich der unterschiedlichen Bindungen möglich. Die Kett- und Schussschnitte stellen anschaulich die jeweiligen Fadenverläufe dar. Der Bindungsrapport ist in Kette und Schuss mit einem Pfeil markiert: Die Bindungskurzzeichen sind nach DIN 61101-2 erstellt, die alte Form (DIN 61101) steht ebenfalls dabei.
















A
Aachener Filztest, dient zur Feststellung der Filzneigung bei verschiedenen Wollsorten. Lose Wollfasern werden zu einer Kugel geformt und in einer Schüttelmaschine mit Walkflüssigkeit dreidimensional bewegt. Die Fasern beginnen zu filzen, wobei der Kugelradius die Filzfähigkeit der Wollfaser bestimmt: kleine Kugel = starke Filzfähigkeit, große Kugel = geringe Filzfähigkeit.
Abacafaser (Manilafaser, Manilahanf, AB), engl. = abaca fiber; Fasern aus den Blättern der Bananenstaude; die Farbe ist gelblichweiß bis braun, ebenso wie → Sisal eine Hartfaser, die sowohl sehr reiß- und scheuerfest als auch widerstandsfähig ist gegen Meerwasser und sehr leicht. Daher wurde sie auch für Schiffstaue, Seilerwaren und als Isolierung für Kabel und Matten verwendet. Wenn die feinen Fasern im Mörser gestampft werden, lassen sie sich zu feinsten Geweben verarbeiten. Daraus gewebte Bekleidung ließe sich zu Faustgröße zusammenpressen. Anbaugebiete: Philippinen, Indien, Indonesien und Mittelamerika. Siehe Abb. S. 35.
Abfallseide, engl. = waste silk; → Bourette und → Schappeseide.
Abschirmgewebe (E-Blocker), engl. = e-shield fabric; vor elektromagnetischer Strahlung schützendes Spezialgewebe, das das elektromagnetische Feld in Innenräumen verringert. Für mehr Informationen → novonic® E-Blocker.
Abseitengewebe, engl. = doubleface, reversible; Handelsbezeichnung für Gewebe mit beidseitig verwendbaren Warenseiten. Sie werden aus Zwei- oder Mehrfadensystemen entwickelt, wobei mit Bindekette oder Bindeschuss gearbeitet wird. Der Begriff „Abseite“ wird auch für Jacken oder Mantelstoffe mit angewebtem Futter verwendet. Ein typischer „Reversible“ ist der → Crêpe-Satin oder der zweifarbige → Doubleface, ebenso der → Charmelaine.
Absorbieren, lat. absorbere = aufsaugen, in sich aufnehmen; Baumwolle ist bspw. → hygroskopisch, absorbiert also Wasser, wie auch Wolle, Seide, Viskose. → Adsorbieren.
Acala, amerik. Baumwollzüchtung, wird i. Allg. als Upland-Baumwolle gehandelt. → Baumwolle.
Acetat (AC), Edelzellstoff (hochwertige Alphacellulose) oder Baumwoll-Linters reagiert mit Essigsäure zu Celluloseacetat (Acetylcellulose) und wird dann in Aceton gelöst. Die zähflüssige Spinnlösung besteht zu einem Viertel aus Celluloseacetat und zu drei Vierteln aus Aceton. Die Essigsäure wird chemisch gebunden und im Trockenspinnverfahren hergestellt; das teure Aceton wird zurückgewonnen. Auf diese Art entstehen feste, seidig schimmernde Fäden. Sie können, im Gegensatz zu Viskose-Cupro, ohne chemische Nachbehandlung verarbeitet werden und sind günstiger als die meisten Chemiefasern. Acetat findet man unter den Markennamen Carolan, Chromspun, Estron, Lynda, Rhodia Filter Tow, Skylon und Teijin-Acetate. Man unterscheidet zwei verschiedene Acetattypen:
1. Zweieinhalbacetat (CA), auch Acetat genannt, bestehend aus 49–54 % Essigsäure und 51–46 % Cellulose. Eigenschaften: Der thermoplastische Bereich liegt bei 180–200 °C, der Schmelzpunkt bei ca. 250 °C. Es besteht eine sehr gute Texturierfähigkeit. Dieser Acetattyp zeichnet sich durch einen edlen Glanz aus; als Filament wirkt er naturseidenähnlich, als Fasergarn sehr wollähnlich. Das spezifische Gewicht beträgt 1,30 g/cm3, es ist damit leichter als Seide (1,37 g/cm3). Die Reißfestigkeit liegt im trockenen Zustand bei 1,3–1,5 cN/tex, nass bei 0,8–1,2 cN/tex. Die Ware hat einen weichen, geschmeidigen Griff, einen eleganten Fall und geringe Knitteranfälligkeit. Die Feuchtigkeitsaufnahme beträgt 6–6,5 %, daher ist die Trocknungszeit entsprechend gering (1/3 der Trocknungszeit von Viskose). Ferner hat dieses Acetat ein gutes antistatisches Verhalten. Waschen ist bei 30 °C in der Feinwäsche möglich, jedoch sollte das Textil weder gewrungen noch gerieben, sondern nur feucht aufgehängt werden. Die Bügeltemperatur beträgt 120 °C (etwas über Stufe 1). Acetat besitzt eine hohe Elastizität, daher eine gute Formbeständigkeit und geringe Einlaufwerte. Es ist acetonlöslich, daher ist keine Fleckenentfernung mit Aceton oder mit acetonhaltigem Nagellackentferner möglich.
2. Triacetat (CTA) wird im Trockenspinnverfahren gewonnen (60–62 % Essigsäure und 40–38 % Cellulose). Es ist thermoplastisch verformbar (Plissee, Bügelfalten, Crash-Effekte) und texturierfähig. Der Erweichungsbereich liegt bei 220–250 °C, der Schmelzpunkt bei 300 °C, die Feuchtigkeitsaufnahme beträgt 3–4 %. Die Textilien können bei 200 °C (Stufe 3) gebügelt werden. Die Nassfestigkeit beträgt 80 %. Die Ware ist leicht zu waschen bei bis zu 60 °C und kann geschleudert werden. Sie knittert kaum, trocknet schnell, ist schrumpffrei und somit maß- und dimensionsstabil. Die Triacetatfasern stehen den synthetischen Chemiefasern am nächsten. Sie können nicht mit den gleichen Farbstoffen gefärbt werden wie die cellulosischen Fasern.
Einsatz: DOB, Futterstoffe, Samte, Plüsche und Dekostoffe.
Literatur: P.-A. Koch; G. Satlow: Großes Textil-Lexikon, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1965.
Additive Fertigungsverfahren, engl. = additive manufacturing; → 3-D-Druck; dieser Begriff für den 3-D-Druck wurde 2010 vom US-amerikanischen Unternehmen ASTM (American Society for Testing and Materials) festgelegt und ist zutreffend für den Produktionsprozess dieser Technik. Die Gemeinsamkeit aller 3-D-Fertigungsverfahren ist das Addieren mehrerer Schichten, die das jeweilige Objekt aufbauen.
Quelle: Frizzi Neumann: Bachelorarbeit AMD, Hamburg, 2014.
Adire, Yoruba, westafrikanisches Volk, Nigeria; heißt so viel wie: alles, was gefärbt und abgebunden ist. Sehr oft mit Indigo. Die Herstellung gleicht dem → Plangi, → Shibori.
Adria, engl. = adria; Woll- oder Baumwollgewebe oder Mischungen mit Chemiefasern in abgeleiteten Ripstypen (Schrägripsbindungen) für Kleider- und Kostümstoffe. Aber auch verstärkte, abgeleitete Atlasbindungen können eingesetzt werden. Die Kleiderstoffe liegen im Gewicht bei ca. 140–180 g/m2, Kostümstoffe um ca. 30–50 g/m2 höher. Häufig werden Kammgarnzwirnkette bis Nm 80/2 und Kammgarnschuss Nm 40/1 eingesetzt. Die rechte Warenseite kennzeichnet eine leichte Schrägbetonung und ein schöner Glanz.

Abb. 1: Adria

Abb. 2: Adria
Adsorbieren, lat. ad = hinzu und lat. sorbere = schlucken; Gase oder gelöste Stoffe an der Oberfläche eines festen Stoffes anlagern, z. B. wenn Wasser sich an der Oberfläche von Polyester anlagert (adsorbiert). → Absorbieren.
Aeterna, → Äterna.
Affenhaut, engl. = velveton; Bildbezeichnung für duvetine- oder velvetonähnliche Gewebe mit längerem Flor, der eine Strichlegung möglich macht. → Duvetine, → Velveton.
Einsatz: Mantel- und Jackenstoffe für DOB und HAKA.
Affinität, engl. = affinity, substantivity; Fähigkeit eines Farbstoffs, aus einer Lösung auf die Faser aufzuziehen. Sie ist das Maß für die Energie, durch die der Farbstoff an die Faser gebunden ist. Eine hohe Affinität bedeutet, dass sich der Farbstoff mehr auf der Faser als im Bad befindet: Er zieht besser aus. Ein hochaffiner Farbstoff besitzt dementsprechend bessere Nassechtheiten als ein niedrigaffiner.
Afghalaine, engl. = afghalaine; ein fast schon historisches Gewebe, das ursprünglich aus afghanischer Wolle (Kammgarn/Streichgarn) gefertigt wurde und heute kaum mehr im Handel zu finden ist. Die Bindungen können variieren: Leinwand, Kreuzköper (K 2/2), Kreppbindungen. Der eigentliche Afghalaine ist in Leinwandbindung gewebt. Die Kettfolge besteht in der Regel aus 1Z-/1S- oder 2Z-/2S-gedrehten Voilegarnen. Im Schuss überwiegen 2Z/2S. Durch die unterschiedlichen Kett- und Schussdrehungen entsteht einstellungsbedingt eine feine Längsrippigkeit. Bei der Verwendung von Garnen ist diese Optik nicht so prägnant, aber dafür ist die Ware locker und leicht sandig im Griff. Verwendet man Zwirne, ist die Oberfläche klar und der Griff etwas kreppartig rau. Trotzdem hat der Afghalaine einen weichen, fließenden Fall, bedingt durch die relativ geringe Drehung der Garne/Zwirne und die etwas offene Einstellung. Die Ware kommt überwiegend stückgefärbt in den Handel. Durch die Ausrüstung, Waschen und Färben, sieht sie leicht meltoniert, d. h. leicht verfilzt, aus. Afghalaine war eine typische Herbstware für den DOB-Bereich. Bindungsbeispiel: → Aida.
Afrikadruck, engl. = african print; Drucktechnik auf Baumwollgewebe, die in west- und zentralafrikanischen Ländern (z. B. Nigeria, Elfenbeinküste, Senegal) angewendet wird. Typisch sind die wenigen, sich oft wiederholenden Farbkombinationen in naturalistischer Dessinierung. Vom Afrikadruck wird ein vollkommener Durchdruck verlangt. Für die Druckrealisation wird auf naphtholierter Ware mit Diazosalzen in Kombination mit Reaktivfarbstoffen gearbeitet. Ebenso sind Indigo- und Beizenfarbstoffe üblich. Afrikadrucke als Reservedruck ähneln in ihrer Herstellung der → Batik.
Quelle: H.-K. Rouette: Lexikon für Textilveredlung, Laumann-Verlag, Dülmen, 1995.
Ahimsa Seide, ahimsa bedeutet in der altindischen Literatur- und Gelehrtensprache Sanskrit „das Nicht-Verletzen“, im Sinne von Gewaltlosigkeit; im Buddhismus und Hinduismus ein wichtiges Gesetz. Ahimsa Seide wird daher auch als „non violent silk“ bezeichnet. Bei dieser Art der Seidengewinnung wird die Seidenpuppe des Maulbeerspinners (Zuchtseide) nicht getötet, sondern schlüpft als Schmetterling aus dem zerstörten Kokon. Dadurch hat sie, wie die Wildseide, Titerschwankungen (Unregelmäßigkeiten der Fadenstärke) und ist ihr optisch sehr ähnlich, aber feiner und weicher. Die „gewaltfrei“ gewonnene Seide wird zur Produktion von Seidengeweben und -gestricken eingesetzt. Eine chemische Behandlung der Textilien ist nicht erlaubt, die Produkte werden fair und sozial gehandelt. Ahimsa Seide wird z. B. von der Firma Lebenskleidung angeboten. Die Textilkollektion ist mit dem GOTS Label ausgezeichnet.
Quelle: www.lebenskleidung.com
Aida, engl. = ada canvas, coarse stiff fabric; Oberflächenstrukturen bei Webwaren mit Durchbruch- und Lochmusterungen. Aida, auch als → Natté bezeichnet, ist ein typisches Stickgrundgewebe und entsteht durch die Verwendung spezieller Scheindreherbindungen – bei echten Dreherbindungen umschlingen sich die Kettfäden gegenseitig. Das gitterähnliche Bild ergibt sich aus der Kombination engbindiger und langflottierender Kett- und Schussfäden der Rips- oder Panamabindung. Lange Zeit wurde dieses Gewebe mehr für den Stickereibereich als für den DOB- oder HAKA-Sektor verwendet. Mit einer Weichausrüstung ist das Aida eine schöne Sommerware, weil es dann porös, luftig und kühl ist; aus reiner Baumwolle aber ist es relativ schwer und schiebeanfällig. Das ursprünglich als Stickgrund verwendete Aidagewebe wird auch unter dem Oberbegriff „Ajour“ geführt.
Einsatz: Kleiderstoffe, Hemden, Wäschestoffe, Deko- und Tischwäschestoffe und mit Steifeappretur als Stickereigrund.

Abb.: Aida
Ailanthusspinner, Wildseidenspinner, der vom Tussahspinner (→ Seide) zu unterscheiden ist und dessen Seide unter dem Namen → Eri(a)seide geführt wird.
Aircoat, engl. air = Luft, coat = Mantel; frei übersetzt ein Wind- und Wettermantel und somit ein Funktionsgewebe für den Outdoor-Bereich. Es ist ein aus Belgien stammendes Baumwollgewebe mit lederähnlicher Optik, welches mit einer Kunstharzbeschichtung (z. B. PU) ausgerüstet ist. Es besitzt eine gute Luftdurchlässigkeit, ist sehr reißfest, abwaschbar und reinigungsbeständig. Das Gewebe büßt durch Kälte nicht an Weichheit ein, neigt also nicht zur „Verbrettung“.
Einsatz: Mäntel und Jacken.
Air-Supply, dtsch. = Luftversorgung; Polyurethan-Beschichtung, die 2007 von der Firma Wolfskin entwickelt wurde. Sie besitzt gegenüber vergleichbaren PU-Coatings eine erhöhte Dampfdurchlässigkeit und hat eine Wassersäule von 1500 mm (andere Beschichtungen teilweise 700–1000 mm). Diese Veredlung wird als wasserdicht bezeichnet. Der Einsatzbereich von Air-Supply liegt im Outdoorsektor, z. B. Jacken, Hosen, Mäntel.
Ajour, engl. = ajour fabric, open work fabric; Web- und Maschenwaren mit Durchbrucheffekt. Erreicht wird der Effekt bei Webwaren durch den Einsatz von Dreher- oder Scheindreherbindungen, bei Maschenwaren durch das Umhängen einzelner Maschen. Der Begriff wird im Weberei-, Stickerei- und Maschenwarenbereich verwendet, selbst Netzgewebe werden als Ajour bezeichnet. Sehr häufig wird die halbtransparente Optik oder Durchbruchoptik auch durch Ausbrennertechnik erreicht (→ Ausbrenner), → Aida.
Ajourbindung, engl. = open work weave; Sieb- oder Gitterbindung, eine Konstruktion für offene Gewebetypen mit stickereiähnlichem Charakter. Die Durchbrüche dienen der Dessinierung und werden nicht immer flächendeckend eingesetzt. Bei diesen Geweben kann man die Dreherbindung verwenden, bei der sich die Kettfäden gegenseitig umschlingen, und die eine besondere Schafteinrichtung erfordert, aber auch einfache Schaftmusterungen wie → Scheindreher. Der Durchbrucheffekt wird hier durch sehr eng kreuzende Bindungseinheiten erreicht, die sich mit längeren Flottierungen abwechseln (→ Aida). Bei Gestricken und Gewirken wird dieser Effekt durch das Umhängen einzelner Maschen erreicht. Ajourbilder können bis zur Netzoptik führen.
Einsatz: Sommerware für DOB und KIKO, im Heimtextiliensektor für Gardinen und Dekostoffe.

Abb.: Ajourbindung
A-Kohle, → Aktivkohleteilchen.
Aktivkohleteilchen, Aktivkohle, A-Kohle, engl. = active carbon; sehr feinkörnige Kohle mit großer innerer Oberfläche (200– 1200 m2/g). Sie wird u. a. pflanzlich aus Holz, Stroh, Lignin und Kokosschalen gewonnen. Man verwendet sie als Adsorptionsmittel (→ Adsorbieren). Aktivkohle besteht zu 90 % aus Kohlenstoff, sie wird in der Textilindustrie auch für antibakterielle Zwecke eingesetzt. → Cocona.
Alcantara®, Markenname von Toray International Europe GmbH für ein Lederimitat. Es ist ein → Mikrofaserwirbelvlies aus 70 % Polyester und 30 % Polyurethan, das aus einer Mikrofaser mit 0,16 dtexentstand, die im Laufe der technischen Entwicklung auf 0,044 dtex verfeinert wurde. (1 g mit einer Feinheit von 0,16 dtex ist ca. 62,5 km lang, bei einer Feinheit von 0,044 dtex sind es sogar 225 km.) Das Ausgangsmaterial ist Polyester und Polystyrol. Letzteres ist beim Ausspinnen der superfeinen PES-Fibrillen als Mantel- bzw. Stützmaterial notwendig. Das 2-Komponenten-Filamentbündel wird dann auf eine Länge von ca. 50 mm zugeschnitten und zu einem mehrmals übereinander gelegten Vlies gefertigt. Auf einer Nadelanlage entsteht in der gewünschten Stärke ein „Filz“ als Zwischenprodukt. Mit Spezialmaschinen trennt man nun das Polystyrol vom Polyester und ersetzt es durch Polyurethan. Das für diesen Prozess notwendige Lösungsmittel wird zu 100 % zurückgewonnen. Das entstandene „Sandwich“ wird in Querrichtung getrennt, sodass aus einer Produktion zwei Stücke entstehen. Der letzte Schritt ist die Bearbeitung durch spezielle Schleiffolien, die die PES-Fibrillen an die Oberfläche bringen und somit der Ware die typischen Eigenschaften verleihen, wie Weichheit, geschmeidiger Griff, Drapierfähigkeit und einen leicht seidigen Glanz. Wird eine Nubuk- oder Nappaoberfläche gewünscht, lässt man das PUR an der Oberfläche gerinnen und erhält so die Narbigkeit eines Glattleders. Alcantara ist qualitätsgeprüft (Certitex) und öko-zertifiziert (Oeko-Tex Standard 100), d. h., es wird uneingeschränkte Hautfreundlichkeit garantiert. Das Lederimitat wird in einer breiten Farbpalette angeboten.
Einsatz: Konfektion (DOB, HAKA), Accessoires, Möbelstoffe und hochwertige Fahrzeugausstattung.
Aloehanf, engl. = aloe hemp; Ausgangsmaterial ist ein Ananasgewächs, welches überwiegend in West- und Ostindien angebaut wird. Die Verarbeitung entspricht der von → Sisal und → Ananasfasern.
Alpaka, engl. = alpaca, paco; Neuweltkamel.
1. Garne und Zwirne aus den Haaren der südamerik. Lamaart. Man unterscheidet zwei verschiedene Arten von Pacos: das Suri und das Huacaya. Während das Haar des selteneren Suri-Alpaka glatt und glänzend ist, wächst das Haar des Huacaya-Alpaka gleichmäßig gekräuselt und ist daher auch sehr gut zum Filzen geeignet. Da die Huacayas weiter verbreitet sind, wird dieser Typus auch überwiegend im Textilbereich verarbeitet. Alpaka (WP) ist sehr weich, langstapelig, seidenartig glänzend. Auf den Hochebenen der südamerik. Anden in 4.000–5.000 m Höhe sind die Tiere eisiger Kälte und glühender Hitze ausgesetzt, wovor sie ihr extrem dichtes, widerstandsfähiges Haar schützt. Alpakas werden in der Regel nur alle zwei Jahre geschoren. Je Tier erhält man ein ca. 3,5 kg schweres Vlies. Pro Jahr steht der Welt nur eine Schiffsladung Alpaka zur Verfügung, was den hohen Preis verständlich macht. Der seidige Glanz, der angenehme Griff, die Leichtigkeit und die Wärme machen Gewebe, Gestricke und Gewirke aus Alpaka so komfortabel. Das Haar des Alpakas ist von winzig kleinen Schuppen umgeben, die besonders glatt anliegen und dadurch das Licht besser reflektieren, was den edlen Glanzeffekt erklärt. Langlebig, strapazierfähig, unempfindlich im Gebrauch wird dieses Material auch mit Kaschmir verglichen. Die Faserlänge beträgt 150– 300 mm, Flaumhaare sind ca. 100 mm lang, der Querschnitt ist rund bis oval, der Faserdurchmesser beträgt 30–50 µm, bei den Flaumhaaren 15–20 µm.
Man verwechsle diesen Begriff nicht mit → Alpakka.
Einsatz: Pullover, Jacken, Anzüge, Kostüme, Mäntel, Accessoires usw.
2. Als Handelsbezeichnung steht der Name auch für sog. Halbwollqualitäten (Kette Baumwolle, Schuss Alpaka) in Kamm- oder Streichgarntypen. Bindung: Tuch (Leinwand). Dieser Typ wird auch als → Lüster oder Orleans bezeichnet. Hieraus fertigt man leichte Sommerjacken, aber auch Schürzenstoffe. Der Lüster ist härter und spröder im Griff.
Alpakka, engl. = alpaca rayon; Alpakkagarn wird aus Reißwolle hergestellt und ist von minderer Qualität. Nicht verwechseln mit → Alpaka.
Altweltkamele, hier unterscheidet man das einhöckrige → Dromedar vom zweihöckrigen Kamel; ihre Heimat ist Asien und Afrika, während die → Neuweltkamele, wie → Lama, → Vikunja, → Alpaka und → Guanako, in Südamerika leben.
Amara, Markenname von Haru-Kuraray, wurde schon Anfang der 1980er Jahre in → Amaretta™ umbenannt.
Amaretta™, Markenname für ein 1984 entwickeltes Mikrofaserwirbelvlies von Haru-Kuraray.
Amaretta™, auch als Hightech-Material bezeichnet, ist ein Rau- und Glattlederimitat, das sich aus 60 % Polyamid-Mikrofaser (0,001–0,01 dtex) und 40 % atmungsaktivem Polyurethan-Harz zusammensetzt. Ausgangsmaterial sind Mikrofibrillen-Verbundfasern vom sog. „Spaghetti-Typ“. Zur Herstellung werden zunächst zwei Polymerverbindungen (Polyamid und Polystyrol) gemischt, geschmolzen und normal ausgesponnen (Schmelzspinnverfahren). Aus den Filamentbündeln werden ca. 10 cm lange Fasern geschnitten, die dann dreidimensional zu einer Matte verwirbelt werden, die anschließend mit einem porösen, luftdurchlässigen Polyurethan-Harz imprägniert wird. Hierdurch werden die mechanischen Eigenschaften, der Griff, die Elastizität, Scheuerfestigkeit und Reißfestigkeit verbessert. Anschließend wird aus den Fasern mit einem Lösungsmittel eine der beiden Polymere „herausgewaschen“ (Hüllenentfernung). So entsteht aus jeder Feinfaser ein Mikrofaserbündel und das Mikrofaserwirbelvlies. Es folgt ein Oberflächenschliff und anschließend der Färbeprozess. Abschließend wird die Ware gebürstet, um dem Raulederimitat Strich und Profil zu geben. Glatte Oberflächen entstehen, indem man das PUR an der Oberfläche gerinnen lässt, so z. B. bei Amaretta™-HiTech und Sofrina (Mikrofibrillen-Verbundfasern). Daneben gibt es den Artikel Nash, ein Materialtyp, der für den Schuhbereich verwendet wird. Bei Lauvest, Rubina und Toraylina entsteht ein Matrixfibrillensystem in einem Spinnprozess. Die Fibrillen bestehen aus dreieckigen Polyestersegmenten, die in eine Polyamidmatrix eingebettet sind. Die Matrix kann geschrumpft oder gelöst werden und es entsteht ein weiches, dichtes Raulederimitat.

Abb.: Vergleich der Querschnitte von Amaretta (links) und Haut (rechts)
| Amaretta™ | Typ KX 7600 225 g/m2Stärke: 0,6 mm |
| Amaretta™ | Typ KX 7500 180 g/m2Stärke: 0,5 mm |
| Amaretta™ | Typ KX 7400 135 g/m2Stärke: 0,35 mm |
Amaretta™ ist winddicht, wetterdicht und atmungsaktiv und lässt sich, ohne einzulaufen, problemlos bei 30 °C im Schonwaschgang behandeln. Weiterhin sind die Leichtigkeit und die Knitter- und Fleckenunempfindlichkeit (→ Scotchgard™) hervorzuheben. Das weiche, geschmeidige Amaretta™ kann gestanzt, bedruckt, geprägt, perforiert, laminiert und beliebig eingefärbt werden. Haru-Kuraray versichert eine ökologisch unbedenkliche Produktion, da Amaretta™ ohne FCKW hergestellt wird und keine Zusätze wie Formaldehyd, Cadmium, Dioxin, PCP oder Pestizide Verwendung finden.
Einsatz: DOB, HAKA, Autopolster, Schuhe, Taschen, Gürtel und Möbelstoffe (Schiffsausstattung der Queen Elizabeth).
Quelle: Informationsmaterial der Kuraray Europe GmbH.
Ambivalent, lat. ambo = beide (Seiten betreffend), valens = stark; doppelwertig und daher in sich oft widersprüchlich (z. B. ist Wolle gleichzeitig hydrophob und hygroskopisch).
Amicor™, Amicor™ Plus und Biokryl, Markennamen für die antibakterielle (AB) und fungizide (AP) Ausrüstung einer Polyacrylfaser (PAN) der Firma Thai Acrylic Fibre. Die unterschiedlichen Markennamen sollen unterschiedliche Abnehmer ansprechen. Biokryl wendet sich an einen Kundenkreis, der an hygienischer, antimikrobieller, sauberer Bekleidung interessiert ist. Amicor™ steht mehr für Ästhetik, Komfort und Frische. Abgesehen von den verwendeten Handelsnamen sind die Fasern chemisch und physikalisch identisch.
Bei der Veredlung werden antimikrobielle oder fungizide Substanzen (ein sog. chemisch-organisches Additiv, Triclosan) mit dem Spinnprozess in die Faserstruktur eingebracht, sodass sich diese Substanzen in Wasser nicht auflösen können. Diese Zusätze migrieren aber aufgrund der porösen Struktur einer nassgesponnenen Acrylfaser teilweise auf die Außenseite der Faser und nehmen so ihre antibakteriellen Aufgaben wahr. Tests haben gezeigt, dass die Hemmzone, der Abstand zwischen der Faser und dem Bakterium, teilweise über 15 mm groß ist (Abb.). Es entsteht eine sehr hautfreundliche und absolut wasch- und reinigungsbeständige Materialtype (200 Wäschen). Reiben sich durch hohe Beanspruchung Teilbereiche der Substanzen ab, werden diese durch die im Kern gespeicherten Zusätze immer wieder ergänzt. Amicor™ lässt sich sehr gut mit anderen Faserstoffen mischen, z. B. mit Baumwolle (CO), Viskose (CV), Wolle (WO), Seide (SE) und Polyester (PES).

Abb.: Amicor
Die antimikrobische Effizienz stellt sich schon bei einem Mischungsanteil von nur 20 % ein. Amicor™ hält die Kleidung länger frisch, steigert den Komfort und ist pflegeleicht. Die fungizide Amicor™ Plus-Type ist als Ergänzung und Komforterweiterung dieses Angebots zu sehen. Weitere Amicor-Produkte: http://www.amicorpure.co.uk.
Einsatz: Amicor™ (AB): Unterwäsche, Sportkleidung, T-Shirts, Sweatshirts, Schutzkleidung, Kinderkleidung, Handtücher, Kissen, Bettwäsche, Matratzenüber züge. Amicor™ Plus: Socken, Strümpfe, Hausund Straßenschuhe, Wärmeunterwäsche, Badematten, Decken, Kissen, Bettwäsche, Matratzenüberzüge.
Ammoniakausrüstung, engl. = ammonia finish; → FLA-Finish.
Amorphe Bereiche, engl. = amorphous parts, griech. ámorphos = gestaltlos; ungeordnete Molekülketten in einem Filament; Gegensatz: → Kristalline Bereiche. Die amorphen Faserbereiche sind verantwortlich für die Biegsamkeit, die Wasseraufnahmefähigkeit und die Färbbarkeit eines Filaments. → Verstrecken.
Amphoter, griech. amphóteros = der eine und der andere, zwitterhaft; die Wollfaser ist z. B. amphoter, d. h., sie ist zugleich wasserabweisend (→ hydrophob) und kann ca. 30 % ihres Eigengewichts an Wasserdampf aufnehmen (→ hygroskopisch).