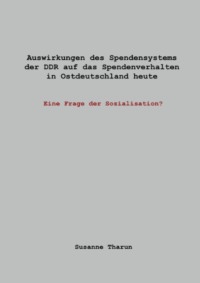Buch lesen: "Auswirkungen des Spendensystems der DDR auf das Spendenverhalten in Ostdeutschland heute -"
Masterarbeit
Auswirkungen des Spendensystems der DDR auf das Spendenverhalten in Ostdeutschland heute
Eine Frage der Sozialisation?
vorgelegt an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Master-Studiengang Fundraising-Management und Philanthropie (M.A.)
betreut durch Herrn Dr. Kai Fischer
vorgelegt am 14. August 2020
Susanne Tharun
Dresden
Inhalt
1 Einleitung
2 Methodik
3 Fazit
1 Einleitung
Eingangs zwei Hinweise: Für eine gute Lesbarkeit werden nur männliche Bezeichnungen verwendet, obgleich immer Frauen mitgemeint sind. Der Begriff „Ostdeutsche“ bezieht sich auf alle, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, auch nach der Wiedervereinigung, geboren sind.
Ist der Ostdeutsche ein Spendenmuffel? Statistiken belegen es mit Zahlen, der Ostdeutsche spendet weniger und seltener als der Westdeutsche. Die Presse versucht es mit Sozialisationseffekt, geringerer Religionszugehörigkeit und dem Wohlstands- und Einkommensgefälle zwischen Ost und West zu erklären. Fachliteratur beziehungsweise Forschungsergebnisse sind kaum zu finden.
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen des Spendensystems der DDR auf das Spenden- verhalten in Ostdeutschland heute. Da die Zahlen bekannt sind, wird hier der Weg über die Geschichte des Spendensystems der DDR, dessen mögliche Folgen bis heute und die Sozialisation der DDR-Geborenen untersucht, also die menschliche Komponente, die uns Fundraisern im Spendenalltag allzu bekannt ist. Wenn man zudem in der DDR geboren und Fundraiser ist, ist es ein Muss die Hintergründe zu erforschen, um die Fundraising-Praxis aktiv und für die ostdeutsche Zielgruppe maßgerecht gestalten zu können. Ziel der Arbeit ist es, die Forschungslücke mit den Ergebnissen zu schließen.
Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Auswirkungen des Spendenwesens der DDR zu analysieren, um neue Erkenntnisse über den Spender im Osten zu gewinnen, wie er tickt und wie er erreicht werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Forschungsfrage gestellt:
Welchen Einfluss hat das Spendenwesen der DDR auf das Spendenhandeln der Bevölkerung in den ostdeutschen Bundesländern heute? Unter Zuhilfenahme zweier Teilfragen wer- den Antworten gesucht. Welche Auswirkungen hat ein zentral gelenktes Spendenwesen auf die Spendenmotivation?
Motivation ist eine Grundvoraussetzung beim Spenden. Was aber passiert, wenn der Spender gar nicht intrinsisch spenden kann, weil er keine Wahl hat, keine freie Wahl bei der Organisation und keine freie Wahl des Spendenzwecks. Stumpft er ab? Kann er nach einem Systemwandel, quasi „ungelernt“ ein begeisterter Spender werden?
Und: Wie verändert sich die Spendenmotivation bei freier Wahl der NRO?
Die zu klärenden Hypothesen sollen konkrete Ergebnisse für die Beantwortung der Forschungsfrage liefern: Wenn das Spendenwesen in der DDR nicht zentralistisch organisiert gewesen wäre, dann würden die Ostdeutschen heute die Unterstützung von sozialen Be- langen nicht als Aufgabe des Staates sehen. Je unfreiwilliger und intransparenter Spenden in der DDR waren, desto schwieriger gestaltet sich heute der Beziehungsaufbau durch die NRO und die damit verbundene Spendenbereitschaft.
Für die empirische Forschung werden Experteninterviews mit offenen Fragen geführt. Interviews mit Menschen, die in der DDR geboren wurden und noch heute ihren Lebensmittel- punkt im Osten der Republik haben. Darüber hinaus ist bei der Wahl derer eine absolute Diversität beabsichtigt um möglichst viele Perspektiven zu ermitteln. Die Auswertung der Leitfaden geführten Interviews erfolgt mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse.
Die vorliegende Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Das erste Kapitel bildet den theoretischen Rahmen. Anhand einer Literaturanalyse wird die Ausgangssituation zu den Themen, Geschichte, Politik und Spendenaktivitäten in beiden deutschen Staaten erörtert. Das zweite Kapitel bespricht die Methodik, also das Forschungsdesign, das Sampling der Datenerhebung, die Auswertung der Ergebnisse, die Diskussion und die Beantwortung der Forschungsfrage. Das Fazit bildet als letztes Kapitel eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie einen Ausblick ab.
1.1 Deutschland zwischen Kapitulation und Staatengründung
Die Siegermächte, USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, teilten nach Kriegsende am 8. Mai 1945 das besetzte Gebiet in vier Zonen auf. USA, Großbritannien und Frankreich übernahmen den westlichen Teil, die spätere Bundesrepublik Deutschland. Der Ostteil, die künftige Deutsche Demokratische Republik, ging an die Sowjetunion. Auch Berlin als ehemalige Hauptstadt wurde in vier Sektoren, unter Herrschaft der Alliierten, aufgeteilt (vgl. Sontheimer/Bleek 1997: 17 ff). Folglich standen sich, abhängig von der Gesinnung der jeweilig besetzenden Siegermacht, Demokratie und Diktatur gegenüber. Ein wirtschaftlicher Strukturwandel nach 1945 war die Folge (vgl. Hüttmann 2012: 7 ff).
Auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 beschlossen die großen Siegermächte, außer Frankreich, die weiteren Geschicke Deutschlands. Man war sich einig, dass Deutschland an der Entfachung eines weiteren Krieges gehindert werden und die entstandenen Kriegsschäden wieder gut machen muss (vgl. Pötzsch 1998: 39 ff). Die durch den in Potsdam gebildet- en Kontrollrat vereinbarten Reparationen und Demontagen sollten die Wirtschaft derart schwächen, dass der Stand von 1932, also dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, wieder erreicht wird. Die westlichen Alliierten nahmen sich jedoch nur ein Drittel der vereinbarten Produktionsmittel. Anders sah es in der SBZ aus. Einige Industriezweige mussten Demontagen bis zu 80 Prozent hinnehmen. Hunderte Großbetriebe wurden in SAG umgewandelt und produzierten somit ausschließlich für die Sowjetunion. Pötzsch fasst die Situation zusammen: „Die Bevölkerung des sowjetisch besetzten Teils Deutschlands hat damit pro Kopf ein Vielfaches dessen aufbringen müssen, was die Bevölkerung der drei Westzonen an Reparationen geleistet hat.“ (1998: 40 f).
In den Westzonen wurden die Grundlagen für den deutschen Föderalismus geschaffen. Fortan wurde für die drei Westzonen der demokratische Aufbau vorangetrieben und eine Verfassung ausgearbeitet (vgl. Sontheimer/Bleek 1997: 24 ff).
Im Gegenteil zu der Schaffung einer bürgerlich-liberalen Demokratie im kapitalistischen Wirtschaftssystem des Westens, wurden grundlegende Änderungen in der SBZ angestrebt. Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung nach sowjetischen Vorstellungen, inklusive Enteignungen von Grund und Betrieben, ging einher mit der Erstarkung der Kommunisten. Im April 1946 wurde die sozialistische Einheitspartei SED, eine kommunistische Partei nach sowjetischem Muster, gegründet.
Die in Ost und West sichtbar grundlegend verschiedenen Interessen machten die Gründung zweier deutscher Staaten unabdingbar. Sontheimer und Bleek führen weiter aus, dass die deutsch-deutsche Teilung das Produkt des Kalten Krieges (1949 bis 1989/90), zwischen den Besatzungsmächten, war. (1997: 24)
Dieser kurze geschichtliche Überblick zeigt die Bedingtheit der unterschiedlichen Entwicklungen der Zonen nach der Kapitulation in direkter Abhängigkeit zu den Besatzern auf.
1.2 Die Bundesrepublik Deutschland bis zur Wiedervereinigung
1.2.1 Geschichte und Politisches System
Der hier beschriebene kurze Überblick dient zur Erläuterung möglicher Parallelen oder auch Gegensätze zur Geschichte der DDR. Im Zentrum der Ausführungen stehen Sozialisation und finanzielle Voraussetzungen der Bürger als Hinleitung zum Spendenverhalten heute.
Eine Kriegsfolge war die Inflation. Ihr begegnete man in der westlichen Besatzungszone mit der Währungsreform1 am 2. Juni 1948 (vgl. Pötzsch 1998: 63 ff). Mit Ludwig Erhard als Wirtschaftsminister entschied man sich für die Einführung der sozialen Marktwirtschaft. „Wohlstand für alle“, auf Basis von Steuergesetzen und Gesetzen gegen Wettbewerbsbeschränkung zur Unterbindung von Machtkonzentration, so Pötzsch weiter (1998: 91 ff), also basierend auf einem Ordnungssystem, was nicht auf staatlich geplante und gelenkte Zentralverwaltungswirtschaft, wie in den kommunistischen Staaten üblich, aufbaut (vgl. Sontheimer/Bleek 1997: 121).
Zeitgleich mit der Währungsreform verabschiedete der amerikanische Außenminister George C. Marshall ein internationales Hilfsprogramm, den Marshallplan. Um ein wirtschaftlich und politisch stabiles Europa zu sichern, musste die westdeutsche Wirtschaft florieren. Von 1948 bis 1952 erhielt Westdeutschland einen Kredit sowie Hilfslieferungen. Später einigte man sich auf eine teilweise Tilgung des Kredites. Der Marshallplan war nicht nur das Ticket zurück in die Staatengemeinschaft und auf den Weltmarkt, er war, wenn auch wissenschaftlich nicht belegt, eine Zutat für das „Wirtschaftswunder“ (Pötzsch 1998: 51 f).
Am 23. Mai 19492 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet (Pötzsch 1998: 80 ff). Mit Ende der 1950er Jahre wuchsen die Spannungen zwischen Ost und West. Infolgedessen begann am 13. August 1961 der Bau der Mauer sowie die Errichtung der Grenze. Die Auswirkungen waren weitreichend (Hüttmann 2012: 19 f).
Die Betrachtung der Einkommenssituation mit Gründung der BRD zeigt, dass der vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 1949 mit monatlich rund 237 Deutsche Mark anfangs weniger als sein „Kollege“ im Osten verdiente. Bis zur Wiedervereinigung stiegen die Durchschnittseinkommen im Westen auf 3.340 DM erheblich an (Statista GmbH 1990). In der DDR lag 1989 das Durchschnittseinkommen bei 1.300 Mark der DDR.
1.2.2 Entstehung des Spendenwesens der BRD als Grundlage des heutigen Fundraisings
Wichtige Voraussetzungen für das Spendenwesen schaffte die bundesdeutsche Sozialpolitik. Die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden3, die Wettbewerbsbeschränkung4 oder werbewirksame Beteiligung durch Politiker bei Spendenaufrufen waren nur einige staatlich gelenkte Einflüsse (Lingelbach 2009: 80). So förderten sie als Schirmherren5 das Spendenwesen und brachten damit bestimmten Organisationen einen Wettbewerbsvorteil. Beworbene Einrichtungen waren freie Wohlfahrtsverbände, der Deutsche Ausschuss für den Kampf gegen den Hunger oder das Müttergenesungswerk. Besonders ragte 1958 die politische Unterstützung für das Kuratorium Unteilbares Deutschland heraus.6 (ebd. 104 ff).
Mit den beginnenden 1950er Jahren wuchs das staatliche Interesse an nichtstaatlichen Spendenaktivitäten7. Staatliche Etats wurden entlastet, den Spitzenverbänden (AWO, Caritas, Parität DRK, Diakonie, ZWST.) wurde eine besondere Stellung zugebilligt und das sozialmoralische Milieu gestärkt. Die Beeinflussung des Spendenmarktes durch staatliche Instanzen bestand nicht zuletzt in der Sozialpolitik an sich und an Finanztransfers an bestimmte Wohltätigkeitsorganisationen (Lingelbach 2009: 79 f).
Mithilfe von Steuervergünstigungen förderte oder beeinflusste der Staat die Spendentätigkeit. Das Einkommens- und auch das Körperschaftssteuergesetz sahen für Spenden, Zuwendungen und Mitgliedsbeiträge Steuervergünstigungen bis zu einer Höchstgrenze von 5 Prozent des steuerpflichtigen Einkommens vor. Die steuerbegünstigten Sammler waren ab 1949 klar definiert. Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Fürsorge für Verfolgte, Flüchtlinge, Vertriebene und Kriegsopfer, Rettung aus Lebensgefahr, Förderung des Sports, der Kunst und der internationalen Verständigung waren die begünstigten Zwecke (Lingelbach 2009: 103).
Die Einführung sozialer Sicherungssysteme ließen bei der Bevölkerung den Schluss zu, dass es kaum noch Bedürftige gäbe und diese durch Steuer- und Versicherungszahlungen unterstützt würden. Die Spender wandten ihre Unterstützung folglich anderen Zwecken, wie Natur- und Umweltschutz und der Unterstützung ausländischer Bedürftiger, zu. Mit Verabschiedung des Bundessozialhilfe- und des Jugendwohlfahrtgesetzes 1961 erlangte das Subsidiaritätsprinzip in der sozialen Arbeit wieder (Wie in der Weimarer Republik (ebd.).) an Bedeutung. Der Staat überließ den freien Wohlfahrtsverbänden die Erledigung sozialer Dienste und unterstützte sie mit öffentlichen Mitteln. Die mittlerweile zu Dienstleistungsunternehmen herangewachsenen Verbände waren somit unabhängig von privaten Spendengeldern (Lingelbach 2009: 106 ff).
Brot für die Welt und Misereor hatten zur Aufgabe, notleidenden Menschen „Hilfe zur Selbst- hilfe“ zu ermöglichen. Darüber hinaus sollten die dekolonialisierten Länder damit von dem Weg in den Kommunismus abgehalten werden. Beide Kollekten-Aktionen waren ein Meilenstein im bundesdeutschen Spendenmarkt, da sie die Bevölkerung zu nennenswerten Spendensummen animierten, indem der Spendenzweck akzeptiert und die Träger als seriös anerkannt waren. Lingelbach stellt als bedeutende Wettbewerbsvorteile der Kirchen die Möglichkeit der Sammlung im Rahmen der Gottesdienste heraus. Zudem genießen die Kirchen ein Grundvertrauen was auch trotz Entkirchlichung ab den 1960er Jahren den Spendenzulauf anwachsen lies (Lingelbach 2009: 136 f).
Hilfen für Länder der Dritten Welt brachten Interessenskonflikte und Machtkämpfe innerhalb bestimmter Länder mit sich. Engagement für ethnisch und religiös geteilte Gebiete, Kriegsregionen, ehemalige Kolonialgebiete und Länder, jenseits des Eisernen Vorhangs, konnten einer Instrumentalisierung nicht entgehen9. Die Politisierung der bundesdeutschen Spendenaktionen wirkte sich Ende der 1960er Jahre auf das Spendenwesen aus und bewirkte in den 1970er Jahren einen Zuwachs an Parteimitgliedern und bei der Wahlbeteiligung (Vgl. hierzu: Knoch (2007: 9 ff).) Das politische Interesse der Bevölkerung wuchs. Auch kirchliche Organisationen agierten politischer und thematisierten Menschenrechte als „Gottesrechte“. (Lingelbach 2009: 304 f).
Die wachsende Politisierung brachte neue Organisationen hervor. In den späten 1960er und 1970er Jahren entstanden, oft lokalen Ursprungs, Organisationen mit politischen Spenden- zwecken. Diese Gruppen erhofften sich eine strikte Reform der Entwicklungshilfepolitik10. Brot für die Welt wurde vorgeworfen, nur die Symptome der Armut nicht die Ursachen zu bekämpfen und nur die revolutionären Kräfte zu unterstützen. Den konfessionellen Organisationen schlug Skepsis der Bevölkerung entgegen, da die Missionsarbeit als Politisierung im Sinne der westlichen Kapitalisierung gedeutet wurde (Lingelbach 2009: 306 f).
In den 1980er Jahren prägte die staatliche Entwicklungspolitik ein wirtschaftliches Interesse aus. Die staatliche Förderung der NRO wuchs schneller als die Spendeneinnahmen. Mit der Aufforderung an die NRO sich aktiv an der entwicklungspolitischen Arbeit zu beteiligen, war die Hoffnung an die Entwicklung des Dritten Sektor unübersehbar (Olejniczak 1999: 141).
1.2.2.1 Rolle der Medien
Die Medien spielen eine maßgebliche Rolle für das Spendenwesen. Aus Sicht der Organisationen fungieren sie nicht nur als Türöffner, sie können auch durch kritische Berichte das Gegenteil bewirken. Der potenzielle Spender kann sich wiederum über Notstände und die Seriosität von NRO informieren, um eine Entscheidung zu treffen (Lingelbach 2009: 22 f).
Kritische Berichte, etwa wegen Veruntreuung der Spendengelder und zu hohen Verwaltungskosten, warnten die Spender. Zahlenmäßig waren die Negativberichte überschaubar und kaum gegen die Wohlfahrtsverbände gerichtet. Dies stellte wiederum einen Wettbewerbsvorteil für die Wohlfahrtsverbände dar (Lingelbach 2009: 209 f).
Mit der Liberalisierung des Spendenmarktes und Aufhebung des bundesdeutschen Sammlungsgesetzes erstarkte der Einfluss der Medien. In den auslaufenden 1960er Jahren er- langten die Medien einen, den Spendenmarkt regulierenden Einfluss. Die Werbung in den Medien, wie Berichterstattungen oder Anzeigen, waren für den Bekanntheitsgrad aus- schlaggebend. Aus dem Schatten der Wohlfahrtsverbände traten in den Medien teils junge Organisationen11 mit Spendenaufforderungen hervor. Auch die Fernsehberichterstattung er- reichte immer mehr Menschen. Schockbilder aus Katastrophen- oder Krisengebieten in den Printmedien bewirkten einen intensiveren Hilfsimpuls. Direkte Nennung einer Organisation in Bezug auf Unglücke multiplizierte das Spendenaufkommen (Lingelbach 2009: 276 f).
Die Medien, zunehmend auch die sozialen Netzwerke, bringen die Katastrophen-Meldungen sehr nah an den Rezipienten und erzielen mit ihren Bildern Ohnmacht und Mitleid. Herausforderung für Berichterstatter und Redakteure ist der Brückenschlag zwischen Aufklärungspflicht12 und Wecken emotionaler Betroffenheit. Sie tragen die Verantwortung für die Auswahl der zu übermittelnden Informationen (Moke/Rüther 2013: 171 ff).
1.3 Die Deutsche Demokratische Republik
1.3.1 Geschichte und Politisches System
Die Betrachtung der Geschichte der DDR - samt Ideologie und Sozialisierung der Bürger - wird näher erläutert, da hier mögliche Ursachen und Auswirkungen der Weltanschauung eines Großteils der Ostdeutschen Anfang des 21. Jahrhunderts zu vermuten ist.
Vor der Gründung der DDR versuchte die SED vergeblich durch die Volkskongressbewegung13 die Gründung der BRD, zugunsten eines einheitlichen Staates, zu verhindern (Pötzsch 1998: 72 ff). Die aus Einheitslisten hervorgegangene „Provisorische Volkskammer“ gründete am 7. Oktober 1949 den ersten „Arbeiter- und Bauernstaat“14. Trotz, dass formal eine Mehrparteienlandschaft existierte, war unter dem Schutz der Sowjetunion, die SED die führende Kraft (Mählert 2017: 25 ff).
Politische und wirtschaftliche Herausforderungen und damit einhergehende Unzufriedenheit der Bevölkerung brachten die SED- und Staatsspitze dazu, gegen die eigene Bevölkerung den Kalten Krieg zu eröffnen. Die aufgebrachte Bevölkerung brach am 17. Juni 1953 in 700 Städten und Gemeinden zu Demonstrationen und Streiks auf. Zu den ökonomischen Forderungen wurden Rufe nach Demokratie, Einheit und freien Wahlen laut. Sie flankierten den
„Arbeiteraufstand“15, welcher durch russische Panzer gestoppt wurde. 10.000 Festnahmen und 55 Menschenleben waren die negative Bilanz - aus der „Faschistischen Provokation“ von außen - wie der SED-Apparat proklamierte (Mählert 2017: 29 ff).
Mit dem Jahresbeginn 1960 setzte die SED-Regierung, nach sowjetischem Vorbild, die Massenkollektivierung von Bauern durch. Sie wurden gezwungen, Ackerland, Betriebsteile und -vermögen in die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften einzubringen.16 Die Versorgungslage verschlimmerte sich und die Unzufriedenheit der Bevölkerung erreichte ein Niveau, das auch die Zahl der Republikflüchtlinge17 drastisch steigen ließ. Folglich begannen im August 1961 Volkspolizei, NVA und Betriebskampftruppen mit dem Bau der Berliner Mauer18 um ein „Ausbluten der DDR“ zu verhindern (Pötzsch 1998: 156 ff). Der nun erreichte Wendepunkt in der Geschichte der DDR nötigte die SED-Führung, die Wirtschaft voranzubringen, um die Bevölkerung milde zu stimmen. Die Loslösung von der starren, zentralen Planwirtschaft brachte einen nennenswerten Aufschwung mit sich. Der Lebensstandard verbesserte sich spürbar. Ende der 1960-er Jahre wurde das „Experiment“ abgebrochen und erneut der Weg in die zentrale Planwirtschaft eingeschlagen (ebd.).
Die marxistisch-leninistische Staats- und Rechtsauffassung schloss eine neutrale Rechtsordnung aus. Die in der DDR-Verfassung verankerten Grundrechte (Art. 27 – 29) wie Freiheit, Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit wurden durch die Strafgesetzgebung des SED-Regimes stark eingeschränkt (Mihr 2002: 33 f). Mit dem Beitritt in die UNO, 1973, erkannte die DDR die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte19 offiziell an, obwohl die SED ein anderes Menschenrechtsverständnis hatte. „Damit unterstrichen die Ideologen, dass es allein der politischen Elite der DDR oblag, festzulegen, welche Rechte dem einzelnen DDR-Bürger zustanden und wie flexibel sie je nach politischer Stimmung zu handhaben waren.“ (Mihr 2002: 37). Auch die KSZE-Schlussakte von Helsinki aus dem Jahr 1975 beinhaltete wesentliche politische Menschenrechte und hatte weitreichende Folgen für den Staat. Die Bevölkerung bestand auf Reisefreiheit, Informationsfreiheit und Familienzusammenführungen. In den darauffolgenden Jahren regierte die SED mit einer Strafrechtsreform20. Die Änderung von 1979 hatte eine Beschneidung der politischen Freiheits- und Menschenrechte zum Inhalt. Zuwiderhandlungen wurden vom MfS geahndet (ebd.).
Der „gemeinsame antiimperialistische Kampf" sowie die „solidarische Unterstützung" der nationalen Befreiungsbewegung gelten als immerwährende Grundprinzipien der Außenpolitik21,22 des zweiten deutschen Staates, die tatkräftige Solidarität23 mit der nationalen Befreiungsbewegung als „Herzenssache" eines jeden Bürgers in der DDR (vgl. Spanger/Brock 1987: 159).
In den 1970er Jahren nahmen die DDR-Bürger erst durch die westliche Medienberichterstattung Kenntnis von den auch in der DDR gültigen Menschenrechtsverträgen und -abkommen. Folglich forderten immer mehr Bürger ihre Rechte ein. Sie forderten nicht allein Demokratie, tausende stellten Anträge auf die „Entlassung aus der DDR-Staatsbürgerschaft“. Hinter dieser Welle der Ausreiseanträge vermutete die DDR-Regierung „kriminelle Menschenhändlerbanden“ und westliche Organisationen24 (Mihr 2002: 42 f). Aktuelle Forschungsergebnisse weisen für die 40 Jahre DDR Opferzahlen zwischen 175.000 und 231.000 „politischer Häftlinge“25 auf. In den Jahren von 1963 bis 1989 „verkaufte“ die DDR über 33.000 politische Gefangene an die BRD mit einem Erlös von 3,5 Milliarden DM Devisen bzw. Rohstoffen und Lebensmitteln (Mihr 2002: 40 f).26
1988/1989 musste auch die SED-Spitze erkennen, dass ohne Reform die Schwächen und Mängel27 in der DDR nicht zu beheben sind. 100.000 DDR-Bürger warteten auf die Genehmigung ihrer Ausreise. Die folgende Fluchtbewegung und die Reformunfähigkeit der SED- Regierung riefen die oppositionellen Bürgerbewegungen auf den Plan. Unruhen und Demonstrationen veranlassten einen Monat nach dem 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 die Regierung zum Rücktritt (Mählert 2017: 77 ff). Am 9. November wurde auf einer SED-Pressekonferenz eine neue Reiseregelung bekannt gegeben. Westreisen ohne Vorliegen von Voraussetzungen waren „ab sofort“ erlaubt. (ebd. 89).
Das am 28. November 1989 von Bundeskanzler Kohl vorgestellte „10-Punkte-Programm“ zur Wiederherstellung der deutschen Einheit sorgte nicht nur in Europa für Unruhe (Mählert 2017: 89). Neben der zerstörten Infrastruktur und der ungebrochenen Macht der SED wuchs bei den DDR-lern das Bedürfnis nach Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Freizügigkeit. Im März 199028 sprachen sich dann 75 Prozent der DDR-Bürger für eine rasche Einheit aus, wohl, weil eine Wiedervereinigung zügig eine Verbesserung der Lebenssituation versprach, nicht aber eine Reformierung der DDR (ebd. 298).
Am 3. Oktober 1990 trat die DDR, gemäß Artikel 23 der Verfassung der Bundesrepublik, der BRD bei (Mählert 2017: 96). „Denn das allgemeine Unvermögen in Ost und West, sich eine abrupte Überwindung der SED-Herrschaft und der deutschen Teilung überhaupt vorstellen zu können, war vielleicht die Voraussetzung für das Gelingen der Revolution schlechthin.“ (Hüttmann 2012: 75). Trotz Planwirtschaft war ein Lohnwachstum in den 40 Jahren des Bestehens der DDR erkennbar. 1949 lag das durchschnittliche, monatliche Bruttoeinkommen bei 290 Mark, bis 1989 vervierfachte sich das Durchschnittseinkommen auf 1.300 Mark (Statista GmbH 1990).
Abbildung 1: Einkommen und Wert der Ost-Mark

Quelle: Daberstiel 2015
Abbildung 2: Durchschnittliches monatliches Bruttoarbeitseinkommen der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) von 1949 bis 1989

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249254/umfrage/durchschnittseinkom- men-in-der-ddr/ (Stand 01.04.2020)
1.3.1.1 Rolle der Kirche
Religion und Glaube galten nach sozialistischem Verständnis als „unwissenschaftlich“. Trotz garantierter Glaubensfreiheit29 hatten die Kirchen nicht die Möglichkeit ihre Rechte einzuklagen. „Sie stellten für die SED die letzte Bastion eines zu überwindenden bürgerlichen Gesellschaftssystems dar und galten als Vorposten des kapitalistischen Feindes im eigenen Land.“ (KAS). Beginnend mit den 1950er Jahren begann ein Kirchenkampf. Mit Werbung für Kirchenaustritte, anti-kirchlichen Pressekampagnen, Durchsuchungen bis hin zu Verhaftungen tat der Staat alles, um den Einfluss der Kirche zurückzudrängen (ebd.). Die staatliche Repression hatte einen Rückgang der Kirchenmitgliedschaften zur Folge. 1958 setzte die erste große Austrittswelle30 ein, zeitgleich mit der Konfrontation zwischen Staat und Kirche zum Thema Jugendweihe. Zwischen 1965 und 1975 ereilte die Kirche eine neue große Aus- trittsflut31. Verantwortlich war eine Säkularisierungswelle, welche auch in der westlichen Welt spürbar war (Wohlrab-Sahr 2001: 325).
Bis zum Mauerbau 1961 waren West- und Ostkirche als Gesamtheit wahrnehmbar. In Folge der eigenständig werdenden Teilstaaten, beschritt die Institution in der DDR den Weg zur
„Kirche im Sozialismus“32. Was blieb war die finanzielle Abhängigkeit der Institution der West-Kirche. Diskret und großzügig erfüllte die Kirche im Westen die Wünsche im Osten (Maser 2013: 86 ff).
Die evangelische und die katholische Kirche waren schon entwicklungspolitisch tätig, bevor Solidaritätsgruppen in den 1960er Jahren entstanden. Über Sammlungen wie „Brot für die Welt“ machte sie die DDR-Bevölkerung auch auf Dritte-Welt-Themen aufmerksam. Im Gegensatz zu der Auffassung der SED-Regierung proklamierte die Kirche die Verantwortung der nördlichen Industrieländer - auch sozialistischer Staaten - für die Ausbeutung der Dritten Welt. Bis 1959 entsandte die evangelische Kirche im Kampf gegen Rassismus Vertreter ins südliche Afrika. Darüber hinaus erhielten die Staaten, wie: Vietnam, Afghanistan, Nicaragua, Mosambik (ebd.), die enge politische Verbundenheit zur DDR lebten, kirchliche Hilfeleistungen (Olejniczak 1999: 211).
Fortführende Gespräche zwischen den evangelischen Kirchenvertretern mit der Staatsführung brachten zunehmend mehr Freiräume für die Kirchenmitglieder. Dies wiederum war Ende der 1970er / Anfang der 1980er Jahre die Basis zur Entstehung und Förderung politischer Aktivitäten, wie Friedens-, Menschenrechts- und Ökologiebewegungen (Mihr 2002: 42).
Bis zur Wiedervereinigung 1989 blieb die Kirche ein Fremdkörper in der „sozialistischen Gesellschaft“. Christen mussten mit Benachteiligungen rechnen. So ist nicht verwunderlich, dass der Anteil der religiös gebundenen Bevölkerung bis 1989 auf 30 Prozent sank (KAS) (Vgl. hierzu: Großbölting/Goldbeck (2015: 178 f).
Dennoch galt die evangelische Kirche als einzige autonome Großorganisation im politisch- sozialen System der DDR. Sie war Schutzraum und Kristallisationskern gesellschaftlicher Stimmungen (Knabe 1988: 553).
Die katholische Kirche hatte mit Gründung der DDR große Hürden zu meistern. Die kaum institutionelle „Minderheiten“-Kirche verfügte ab Streichung der staatlich eingetriebenen Kir- chensteuer33 1949 anfänglich über vergleichsweise wenig finanzielle Mittel und Einrichtungen, wie Kinder- und Altenheime. Mit dem Jahr 1949 begannen katholische Spendensammlungen in der DDR. Kirchen-Vertreter sammelten mit Kollekten, ebenso wurde zu Naturaliensammlungen oder Nachlassspenden34 aufgerufen. Ob der steigenden Kosten konnte die Arbeit der Einrichtungen nicht mehr finanziert werden. So wurde Mitte der 1960er Jahre das
„Caritas-Notopfer“35 eingeführt. 1970 startete die katholische Kirche die Aktion „Not in der Welt“. Gesammelt wurde in der gesamten DDR am ersten Advent per Kollekte. Die Mittel36 wurden dann weltweit37 in katholischen Strukturen, auf staatlichem Transportweg, weitergegeben. In den Folgejahren steigerten sich die Spendeneinnahmen erheblich. 1980 kamen acht Millionen Mark der DDR38 zusammen. (Puschmann 2018: 75 ff) Hier muss darauf hingewiesen werden, dass die katholische Kirche eine viel größere Distanz zum SED-Staat lebte als die evangelische Kirche (Maser 2013: 89).
„Keine Institution im geteilten Deutschland hat so viel für das Zusammenbleiben der Deutschen über Grenzen hinweg getan, wie die Kirchen.“39 (Maser 2013: 88 f) In dem religions- feindlichen Staat führte auch die Einführung der Jugendweihe zu sinkenden kirchlichen Konfirmationen und Austritten. Diese „Kultur der Konfessionslosigkeit“ hielt bis zur Wiedervereinigung an (Großbölting/Goldbeck 2015: 179).
1.3.2 Spendenaktivitäten der DDR
Die theoretische Auseinandersetzung mit dem Spendenwesen in der DDR erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit, arbeitet jedoch zur Erläuterung mit detaillierten Beispielen.
Die Entwicklung des ostdeutschen Spendenwesens ist in Folge des zweiten Weltkrieges zu verstehen. Einerseits wollte man nie wieder Krieg, andererseits sollte der Wiederaufbau ohne kapitalistische Ausbeutung und Arbeitslosigkeit erfolgen. Hieraus ergaben sich solidarische, nationale Aktivitäten. Mit den bewaffneten Auseinandersetzungen im Fernen Osten, Anfang der 1950er Jahre, entwickelte sich die internationale Solidarität40. (Reichardt 2006: 33f). Das DDR-Verständnis von Solidarität - siehe hierzu Schleicher (1998: 5 f) - war auf die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Entwicklungsländer in Form von „antiimperialistischer Solidarität“41,42 fixiert. Das solidarische Selbstverständnis der Staats- und Parteiführung der DDR bestand in finanzieller, materieller und personeller Unterstützung der Entwicklungsländer (Verburg 2012: 21 ff). In der „zentralistisch-bürokratischen Solidaritätspolitik der SED“ bestand kein Bedarf an Nord-Süd-Politik, da die eigene sozialistische Gesellschaft keiner Veränderung bedurfte (Letz 1994: 51).