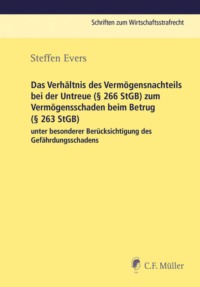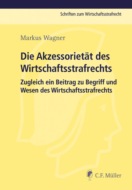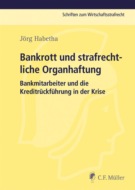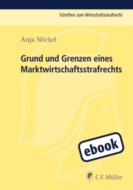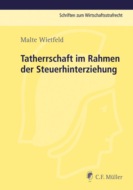Buch lesen: "Das Verhältnis des Vermögensnachteils bei der Untreue (§ 266 StGB) zum Vermögensschaden beim Betrug (§ 263 StGB) unter besonderer Berücksichtigung des Gefährdungsschadens"
Das Verhältnis des
Vermögensnachteils bei der
Untreue (§ 266 StGB) zum
Vermögensschaden beim
Betrug (§ 263 StGB)
unter besonderer Berücksichtigung des Gefährdungsschadens
von
Steffen Evers

Das Verhältnis des Vermögensnachteils bei der Untreue (§ 266 StGB) zum Vermögensschaden beim Betrug (§ 263 StGB) › Herausgeber
Schriften zum Wirtschaftsstrafrecht
Herausgegeben von
Prof. Dr. Mark Deiters, Münster
Prof. Dr. Thomas Rotsch, Gießen
Prof. Dr. Mark Zöller, Trier
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-4475-1
E-Mail: kundenservice@cfmueller.de
Telefon: +49 89 2183 7923
Telefax: +49 89 2183 7620
© 2018 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Zugl.: Justus-Liebig-Universität Gießen, Fachbereich Rechtswissenschaft Diss., 2017
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM) Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert. Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde von der rechtswissenschaftlichen Fakultät (Fachbereich I) der Justus-Liebig-Universität in Gießen im Wintersemester 2016/2017 als Dissertation angenommen. Literatur und Rechtsprechung wurden bis Dezember 2015 berücksichtigt.
Mein Dank gilt an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Thomas Rotsch für die Betreuung und die stets wertvolle Unterstützung im Verlauf meines Promotionsvorhabens. Herrn Prof. Dr. Bernhard Kretschmer danke ich für die Erstellung des Zweitgutachtens.
Für die Aufnahme in diese Schriftreihe danke ich Ihren Herausgebern Herrn Prof. Dr. Mark Deiters, Herrn Prof. Dr. Thomas Rotsch sowie Herrn Prof. Dr. Mark A. Zöller.
Danken möchte ich an dieser Stelle auch all den Menschen, die mich in der Zeit der Erstellung dieser Arbeit begleitet und mir zur Seite gestanden haben.
Mein ganz besonderer und tief empfundener Dank gilt meinen Eltern, ohne die – auch – die Erstellung dieser Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Meinem leider viel zu früh verstorbenen Vater ist diese Arbeit in tiefster Dankbarkeit gewidmet.
Danken möchte ich auch meinem guten Freund Herrn Dr. Clemens Demmer für die unzähligen Gespräche, wertvollen Anregungen und Diskussionen sowie die vielen Stunden der Unterstützung bei der Überarbeitung und Fertigstellung des Manuskripts.
Nicht zuletzt danke ich meiner lieben Ehefrau für Nachsicht und Geduld, für Rat und Tat, einfach für alles.
Die Arbeit wurde gefördert durch ein Promotionsstipendium der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
Augsburg im Juni 2017
Steffen Evers
Vorwort › Widmung
Meinem Vater in Gedenken
Inhaltsverzeichnis
Das Verhältnis des Vermögensnachteils bei der Untreue (§ 266 StGB) zum Vermögensschaden beim Betrug (§ 263 StGB)
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Teil 1 Einleitung
A.Allgemeine Veränderungstendenzen im Strafrecht
I.Rechtsgüterschutz vs. Verhaltenssteuerung der Gesellschaft
II.Rechtssicherheit vs. individuelle Gerechtigkeit
B.Das Wirtschaftsstrafrecht als Feld einer Richtungsentscheidung
I.Die Untreue als das klassische Wirtschaftsdelikt unserer Zeit
II.Das Verhältnis von Vermögensnachteil und Vermögensschaden als Ansatzpunkt einer Rekonturierung des Wirtschaftsstrafrechts
C.Ziel der Arbeit und Gang der Untersuchung
I.Ziel der Arbeit
II.Gang der Untersuchung
Teil 2 Das Verhältnis der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil – die 4 Möglichkeiten einer Verhältnisbildung
A.Heutiges Verständnis – Das „Dogma der Identität“ von Vermögensschaden und Vermögensnachteil (1. Möglichkeit)
I.Der Ausgangspunkt – Der Vermögensschaden beim Betrug (§ 263 StGB)
1.Das Rechtsgut des Betruges
2.Grundlagen der Schadensermittlung – Die Vermögens- und Schadenstheorien
a)Der Begriff des Vermögens als Grundlage des Vermögensschädigungsdelikts Betrug
aa)Juristischer Vermögensbegriff
bb)Wirtschaftlicher Vermögensbegriff
cc)Juristisch-ökonomischer Vermögensbegriff
dd)Personaler Vermögensbegriff
ee)Standpunkt der Rechtsprechung: Klare Linie oder „Zick-Zack Kurs“?
ff)Stellungnahme zum Vermögensbegriff
b)Der Begriff des Vermögensschadens
aa)Die grundsätzlichen Schadenstheorien in Korrelation zu den jeweils zugrunde liegenden Vermögensbegriffen
(1)Subjektiv-juristische Schadenstheorie
(2)Objektiv-wirtschaftliche Schadenstheorie
(3)Objektiv-individuelle Schadenstheorie
(4)Personale Schadenstheorie
(5)Standpunkt der Rechtsprechung
(6)Stellungnahme zum Schadensbegriff
bb)Grundvoraussetzungen des Vermögensschadens
(1)Die erste Vermögensminderung
(2)Die zweite Vermögensminderung als nicht kompensierte erste Vermögensminderung
c)Zusammenfassung: Die maßgebenden Begrifflichkeiten im Rahmen der Schadensermittlung beim Betrug
3.Durchbrechungen des Prinzips der objektiv-wirtschaftlichen Gesamtsaldierung durch die herrschende Schadenstheorie – Sonderformen der Schadensermittlung
a)Der individuelle Schadenseinschlag
b)Bewusste vs. unbewusste Selbstschädigung bzw. die Zweckverfehlungslehre
aa)Bewusste vs. unbewusste Selbstschädigung
bb)Die Zweckverfehlungslehre
c)Zusammenfassung: Unvereinbarkeit des individuellen Schadenseinschlags sowie der Zweckverfehlungslehre mit den Grundsätzen der herrschenden grundsätzlich wirtschaftlichen Schadensermittlung
4.Vermögensschaden durch Vermögensgefährdung als Konsequenz des wirtschaftlichen Vermögens- und Schadensbegriffs
a)Die Abgrenzung zwischen schadensrelevanten und -irrelevanten Vermögensgefährdungen in der Literatur
aa)Das Kriterium der Konkretheit der Vermögensgefährdung
bb)Die Ansicht von Lenckner – Das Attribut der „höchsten Wahrscheinlichkeit“
cc)Die Ansicht von Cramer – Das Kriterium der Zivilrechtsakzessorietät
dd)Die Ansicht von Tiedemann – Insbesondere das Kriterium der Bilanzrechtsorientierung
ee)Die Ansicht von Schröder – Das sog. Herrschaftsmodell
ff)Die Ansicht von Lackner – Das Erfordernis weiterer Akte des Täters bzw. Opfers und die Anerkennung von Ausnahmen
gg)Die Ansicht von Hefendehl und Schünemann – Das Kriterium der Vermeidemacht
hh)Die Ansicht von Kindhäuser – Die Kriterien einer funktionalen Schadensermittlung
ii)Die Ansicht von Riemann, Matt und Saliger – Das Kriterium der doppelten Unmittelbarkeit
jj)Zwischenergebnis
b)Die Rechtsprechung zur Schadensbegründung durch Vermögensgefährdung
aa)Von 1867 bis heute – die historische Entwicklung
bb)Die Fallgruppen des Betruges in der Rechtsprechung
(1)Eingehungsbetrug als klassischer Fall der Schadensbegründung durch Vermögensgefährdung
(2)Erfüllungsbetrug
(3)Kreditbetrug
(4)Scheckbetrug
(5)Submissionsbetrug
(6)Beweismittelbetrug
(7)Fälle des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten
(8)Sportwettenbetrug
(9)Versicherungsbetrug in der Konstellation des „Al-Qaida-Falles“
(10)Zwischenergebnis
c)Aktuelle Entwicklungen zur Schadensbegründung durch Vermögensgefährdung
aa)„Schadensgleiche Vermögensgefährdung“ oder „Gefährdungsschaden“ – Die Frage der Begrifflichkeit
bb)Aufgabe der Figur des Gefährdungsschadens durch die neuere Rechtsprechung?
d)Teilergebnis zur Schadensbegründung durch Vermögensgefährdung
5.Ergebnis zum Vermögensschaden
II.Das Gegenstück – Der Vermögensnachteil bei der Untreue (§ 266 StGB)
1.Das Rechtsgut der Untreue
2.Der Vermögensnachteil nach dem ursprünglichen „Dogma der Identität“
a)Übertragung der Grundsätze der Schadensbegründung auf die Untreue
b)Übertragung der Schadensbegründung durch Vermögensgefährdung auf die Untreue
aa)Dogmatische Gesichtspunkte der Übertragung der Grundsätze der Vermögensgefährdung
bb)Fallgruppen aus der Rechtsprechung
(1)Eingehungsuntreue
(2)Haushaltsuntreue
(3)Konzernuntreue
(4)Untreue durch unordentliche Buchführung
(5)Untreue durch Kick-Back-Zahlungen
(6)Untreue durch Kreditvergabe
(a)Kreditvergabe als Risikogeschäft
(b)Die Strafbarkeit der Kredituntreue
(7)Zwischenergebnis
c)Sonderkonstellationen der Nachteilsbegründung
3.Ergebnis zum Vermögensnachteil
III.Zusammenfassung zum „Dogma der Identität“ als status quo
B.Ausweitung des Begriffs des Vermögensnachteils durch die neuere Rechtsprechung (2. Möglichkeit)
I.Ausweitung des Vermögensnachteils – Strafbarkeit der Bildung von sog. schwarzen Kassen
1.Kanther – Schwarze Kassen im Rahmen einer politischen Partei
2.Siemens – Schwarze Kassen in der Privatwirtschaft: Konstellation 1
3.Schwarze Kassen in der Privatwirtschaft: Konstellation 2 – Erstreckung der Strafbarkeit auf den Alleingesellschafter
4.Ergebnis zur Ausweitung des Begriffs des Vermögensnachteils durch die Rechtsprechung – Die Erhebung der Dispositionsfreiheit zum Rechtsgut der Untreue
II.Ablehnung der Ausweitung des Nachteilsbegriffs aus dogmatischen, praktischen sowie systembezogenen Gründen
1.Dogmatische Gründe
a)Die Untreue als reines Vermögensdelikt
b)Die Aufgabe des einheitlichen strafrechtlichen Schadensbegriffs
c)Die Entwicklung der Untreue zu einem Korruptionsvorfelddelikt
d)Unterschiedliche Anwendungsbereiche des Regelbeispiels des § 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 Alt. 1 StGB beim Betrug und des § 266 Abs. 2 i.V.m. § 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 Alt. 1 StGB im Hinblick auf die Untreue
2.Praktische Gründe und der Einfluss der Rechtsprechung auf unternehmerisches Handeln
a)Inkompatibilität mit der Struktur unterschiedlicher Entscheidungsebenen in Wirtschaftsunternehmen
b)Die Mutation der Untreue zum strafprozessualen Mittel
3.Systembezogene Gründe – Rechtssicherheit vs. individuelle Gerechtigkeit
4.Schlussfolgerung – Die Ablehnung der Ausweitung des Nachteilsbegriffs
III.Zusammenfassung zur Ausweitung des Nachteilsbegriffs
C.Erfordernis restriktiver Anwendung der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil (3./4. Möglichkeit)
I.Das Erfordernis der Restriktion des Schadensbegriffs und des Nachteilsbegriffs (3. Möglichkeit)
1.Verfassungsrechtliche Gründe für eine Restriktion
a)Das Gesetzlichkeitsprinzip: Art. 103 Abs. 2 GG
aa)Die Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil vor dem Hintergrund des Analogieverbots
(1)Das Analogieverbot als Grenze der Auslegung von Straftatbeständen
(a)Der Wortlaut als einziges taugliches Abgrenzungskriterium
(b)Die Ermittlung der natürlichen Wortbedeutung
(c)Zwischenergebnis
(2)Der begriffliche Inhalt von Vermögensschaden und Vermögensnachteil
(a)Der Begriff des Schadens
(b)Der Begriff des Nachteils
(c)Identischer Bedeutungsgehalt trotz unterschiedlicher Begrifflichkeiten
(d)Das Erfordernis der Vermögensminderung und die Bedeutung des Rechtsgüterschutzes
(e)Zwischenergebnis – Die wortlautbezogene Definition der Begriffe Vermögensschaden (§ 263 StGB) und Vermögensnachteil (§ 266 StGB)
(3)Die Verfassungskonformität der Schadens- bzw. Nachteilsbegründung durch Vermögensgefährdung
(4)Das Verhältnis von Rechtsgutsverletzung, Gefährdungsschaden und endgültigem sowie echtem Schadenseintritt im Hinblick auf den Wortlaut des Gesetzes
(5)Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23.6.2010 (2 BvR 2559/08 u.a.) im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit des Gefährdungsschadens
(a)Die Verfassungsmäßigkeit des Gefährdungsschadens und das Verschleifungsverbot als abstrakte Anforderung
(b)Die (fehlende) konkrete Umsetzung der abstrakten Anforderung des Verschleifungsverbots im Rahmen des Urteils zur Siemens-Korruptionsaffäre
(6)Zwischenergebnis zur Vereinbarkeit der herrschenden Schadens- und Nachteilsdogmatik mit dem Analogieverbot
bb)Schlussfolgerung zu den Auswirkungen des Analogieverbots auf Vermögensschaden und Vermögensnachteil
b)Der Schuldgrundsatz (Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG)
aa)Die Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil unter Berücksichtigung des Schuldgrundsatzes
(1)Die Schuld als Grundlage der Strafzumessung
(2)Die Notwendigkeit der Bezifferung von Vermögensschaden und Vermögensnachteil
(3)Die Notwendigkeit der Bezifferung zumindest eines Mindestschadens bzw. -nachteils
(4)Methoden der Bezifferung
(a)Das Bilanzrecht
(b)Die Barwertmethode
(c)Weitere wirtschaftswissenschaftliche, insbesondere statistische und finanzwissenschaftliche Methoden
(d)Die Zulässigkeit der Schadensschätzung
(e)Die Berücksichtigung des Marktpreises als einzig verlässliche Methode zur Bezifferung unter der Herrschaft des wirtschaftlichen Vermögens- und Schadensbegriffs
(f)Zwischenergebnis
(5)Der Gefährdungsschaden und die Notwendigkeit seiner Bezifferung
(a)Schwierigkeiten bei der Bezifferung von Gefährdungsschäden
(b)Die Zulässigkeit einer Ausnahme vom Bezifferungserfordernis
(6)Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23.6.2010 (2 BvR 2559/08 u.a.) im Hinblick auf das Erfordernis der Bezifferung der Höhe von Vermögensschaden und Vermögensnachteil
(a)Die Notwendigkeit der Bezifferung des Erfolgsunrechts
(b)Die konkrete Umsetzung des Erfordernisses der Bezifferung im Urteil zum Berliner Bankenskandal
bb)Auswirkungen des Schuldgrundsatzes auf Vermögensschaden und Vermögensnachteil
c)Ergebnis zum Bedürfnis nach restriktiver Handhabung der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil aus verfassungsrechtlichen Gründen
2.Wirtschaftspolitische Gründe für eine Restriktion
a)Die besondere Bedeutung der Risikogeschäfte für ein marktwirtschaftliches Wirtschaftssystem und die Notwendigkeit einer klaren Grenzziehung
b)Die Arbeitsteiligkeit bei der Entscheidungsfindung
c)Zwischenergebnis – „Strafrecht als Linienrichter“
d)Exkurs: Der „Mannesmann-Prozess“ als Beispiel der Verquickung von Recht und Ökonomie
e)Ergebnis zum Bedürfnis nach restriktiver Handhabung der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil aus wirtschaftspolitischen Gründen
3.Strafrechtspolitische Gründe für eine Restriktion
a)Ultima-ratio-Funktion, Subsidiarität und fragmentarischer Charakter – Die Besonderheit des Strafrechts verglichen mit außerstrafrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten
aa)Die ultima-ratio-Funktion
bb)Die Subsidiarität als Ausfluss des verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
(1)Alternativen zum staatlichen Strafen
(2)Anwendbarkeit des Grundsatzes der Subsidiarität im Wirtschaftsstrafrecht
(3)Subsidiarität des Strafrechts in der Konstellation bloßer Vermögensgefährdungen
cc)Fragmentarischer Charakter – Lückenhaftigkeit des Strafrechts als Folgerung aus der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG)
b)Strafrecht als „Spielball“ der Kriminalpolitik
c)Ergebnis zu dem Bedürfnis nach restriktiver Handhabung der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil aus strafrechtspolitischen Gründen
4.Zusammenfassung zum Erfordernis der Restriktion des Schadens- und des Nachteilsbegriffs
II.Erfordernis einseitiger Restriktion des Nachteilsbegriffs wegen abweichender Tatbestandsstruktur von Betrug und Untreue (4. Möglichkeit)
1.Erfordernis einseitiger Restriktion des Nachteilsbegriffs aufgrund der tatbestandlichen Weite des Untreuetatbestandes im Vergleich zum Betrugstatbestand und die mögliche Verfassungswidrigkeit des Untreuetatbestandes
a)Der Untreuetatbestand vor dem Hintergrund des Erfordernisses hinreichender Bestimmtheit
aa)Die allgemeinen Anforderungen an die Bestimmtheit von Straftatbeständen
bb)Die Verfassungsmäßigkeit des Untreuetatbestandes im Konkreten
(1)Die Bestimmtheit des Merkmals der Vermögensbetreuungspflicht
(2)Die Bestimmtheit des Merkmals der Pflichtverletzung des Täters als normatives Tatbestandsmerkmal
(3)Die Bestimmtheit des Merkmals des Vermögensnachteils
cc)Zwischenergebnis
b)Die unterschiedliche Weite des Untreuetatbestandes im Vergleich zum Betrugstatbestand
c)Konsequenzen aus der unterschiedlichen Weite von Betrugs- und Untreuetatbestand für das Verhältnis der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil
d)Zwischenergebnis
2.Erfordernis einseitiger Restriktion des Nachteilsbegriffs aufgrund der sprachlichen Differenzierung zwischen „Schaden“ und „Nachteil“
3.Erfordernis einseitiger Restriktion des Nachteilsbegriffs aufgrund der Straflosigkeit des Untreueversuchs
4.Erfordernis einseitiger Restriktion des Nachteilsbegriffs aufgrund des Fehlens eines subjektiven Korrektivs im Untreuetatbestand
a)Kongruenz, überschießende Innentendenz und die Unschärfe des subjektiven Untreuetatbestandes
b)Strenge Vorsatzanforderungen bei der Untreue und das Erfordernis der Billigung der Gefahrrealisierung – eine Restriktion im subjektiven Untreuetatbestand?
c)Vorzug einer Restriktion im objektiven Tatbestand
5.Zusammenfassung: Kein Erfordernis einseitiger Restriktion des Nachteilsbegriffs wegen abweichender Tatbestandsstruktur von Betrug und Untreue
D.Gesamtergebnis: Neuinterpretation des Verhältnisses der Begriffe Vermögensschaden und Vermögensnachteil
Teil 3 Auswirkungen der Neuinterpretation des Verhältnisses auf Wissenschaft und Praxis
A.Auswirkungen auf das Strafrechtssystem: Systemgerechtigkeit statt Billigkeit
B.Auswirkungen im Wirtschaftsstrafrecht: Rekonturierung des Vermögensstrafrechts durch klare Grenzziehung
C.Auswirkungen in Bezug auf den Gefährdungsschaden: Die Aufgabe des Gefährdungsschadens und deren Folgen für die herrschende Schadensdogmatik – ein Bruch mit dem wirtschaftlichen Schadensbegriff oder ein Sonderweg innerhalb Europas?
I.Die Aufgabe der Figur des Gefährdungsschadens als Abkehr vom wirtschaftlichen Vermögens- und Schadensbegriff?
II.Exkurs: Die Aufgabe des Gefährdungsschadens als Sonderweg? – Ein Rechtsvergleich
1.Schweiz
2.Italien
3.Österreich
III.Zusammenfassung zu den Auswirkungen im Bezug auf den Gefährdungsschaden und deren Konsequenzen
D.Auswirkungen auf die Strafbarkeit der dargestellten Fallgruppen von Betrug und Untreue: Keine Entkriminalisierung strafwürdigen Verhaltens
I.Die Fallgruppen des Betruges
1.Eingehungsbetrug
2.Erfüllungsbetrug
3.Kreditbetrug
4.Scheckbetrug
5.Submissionsbetrug
6.Beweismittelbetrug
7.Fälle des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten
8.Sportwettenbetrug
9.Versicherungsbetrug in der Konstellation des „Al-Qaida-Falles“
II.Die Fallgruppen der Untreue
1.Eingehungsuntreue
2.Haushaltsuntreue
3.Konzernuntreue
4.Untreue durch unordentliche Buchführung
5.Untreue durch Kick-Back-Zahlungen
6.Untreue durch Kreditvergabe
7.Untreue durch Bildung von sog. schwarzen Kassen
III.Gesamtwürdigung der Auswirkungen auf die Strafbarkeit der behandelten Fallgruppen des Betruges und der Untreue
E.Auswirkungen in der Praxis: Die Gewährleistung von Handlungsspielraum bei wirtschaftlichen Entscheidungen
F.Gesamtergebnis zu den Auswirkungen der Neuinterpretation des Verhältnisses auf Wissenschaft und Praxis
G.Aktuelle Herausforderungen an die restriktive Begriffsdefinition von Vermögensschaden und Vermögensnachteil – Die Weltwirtschaftskrise des 21. Jahrhunderts
Teil 4 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis