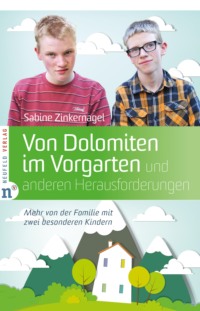Buch lesen: "Von Dolomiten im Vorgarten und anderen Herausforderungen"
Sabine Zinkernagel
Von Dolomiten im Vorgarten und anderen Herausforderungen
Mehr von der Familie mit zwei besonderen Kindern

Zu diesem Buch
Neues von den Zinkernagels: Auch in ihrem zweiten Buch erzählt die Autorin mit viel Witz und großer Ehrlichkeit von den immer wieder neuen Herausforderungen ihres turbulenten Familienalltags mit zwei behinderten Söhnen und einem quirligen Ehemann:
Wie kann man verhindern, dass sich die geplanten Blumenbeete im Vorgarten der Familie durch wahre Steinberge in die Dolomiten verwandeln? Wie geht man mit einem Teenager um, der seine Welt durch lautstarkes Wünschen verbessern möchte? Und warum fühlt man sich nach der Lektüre von Weihnachtsrundbriefen eigentlich immer so mies?
Zwischen diesen herrlich erfrischenden, nachdenklichen, schrägen und vor allem authentischen Episoden macht sich die Autorin so manche Gedanken über Gott und die Welt, über die Möglichkeit von Wundern und vor allem über die Frage: „Was passiert, wenn es ganz anders kommt?“
Über die Autorin
Sabine Zinkernagel, geb. 1965, hat Französisch, Soziologie und Öffentliches Recht studiert, einen Pfarrer geheiratet und ist Mutter von Jacob und Cornelius. Familie Zinkernagel lebt in Weißwasser in der Oberlausitz (Landkreis Görlitz).
Wer nur auf die Löcher starrt, verpasst den Käse hieß das erste Buch von Sabine Zinkernagel. Es machte uns mit dieser sehr besonderen und doch auch wieder ganz normalen Familie bekannt und erwarb der Autorin auf Anhieb eine ansehnliche Lesergemeinde.
Impressum
Dieses Buch als E-Book:
ISBN 978-3-86256-751-5, Bestell-Nummer 590 054E
Dieses Buch in gedruckter Form:
ISBN 978-3-86256-054-7, Bestell-Nummer 590 054
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar
Lektorat: Dr. Thomas Baumann Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf Johannson Umschlagbilder: © Dzm1try/Shutterstock.com; © privat Satz: Neufeld Media, Weißenburg in Bayern
© 2014 Neufeld Verlag Schwarzenfeld
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Verlages
www.neufeld-verlag.de / www.neufeld-verlag.ch
Bleiben Sie auf dem Laufenden: www.newsletter.neufeld-verlag.de www.facebook.com/NeufeldVerlag www.neufeld-verlag.de/blog
Mehr E-Books aus dem Neufeld Verlag finden Sie bei den gängigen Anbietern oder direkt unter https://neufeld-verlag.e-bookshelf.de/
Inhalt
Zu diesem Buch
Über die Autorin
Impressum
Statt eines Vorworts
Schlüssel-Erlebnisse
Beifahrer
Diagnose
Weiterleben
Briefe an Jacob
Danke, Jesus: Die Sache mit den Fürbitten
Gedankengänge um die Shampooflasche
Lebensläufe
Bobbykind
Wunder und Normalitäten
Bittere Wurzeln
„Muff ma“
Rundbriefe
Dolomiten im Vorgarten …
„Stock-Werke“
Frühstückstreffen
Gott lässt sich nicht lumpen …
Ja, damals
Ach, Jesus: Die Sache mit der Glaubensstärke
Noch mehr „Schlüsselerlebnisse“
Traumhafte Kinder
Anziehsache
Shopping-Freud und Shopping-Leid
Planwirtschaft
Die Segnungen eines Handys
Volltreffer?
Jacobs Tour-Tagebuch
SMS-Botschaften
Wunschgedanken
Den Glauben weitergeben
Nachwuchs-Talent
Über den Verlag
Da dieses Buch Episoden aus dem wahren Leben schildert, sind Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen unvermeidbar. Soweit es sich nicht um enge Familienmitglieder handelt, hat die Autorin Namen und Lebensumstände der Personen soweit verändert, dass sie für Dritte nicht oder nur schwer zu erkennen sind.
Statt eines Vorworts
Durchhaltevermögen
„Liebe besteht zu 95 Prozent aus Durchhaltevermögen“ – das sagte mein künftiger Schwiegervater meinem jetzigen Mann und mir kurz vor der Verlobung.
Gut, dass etwas Durchhaltevermögen dazugehört, um auf Dauer beisammen zu bleiben, das leuchtete uns ein. Aber 95 Prozent? Nie und nimmer! Wir waren schließlich verliebt und nicht „verdurchhaltevermögt“! Bei der Goldhochzeit wollten wir im Kreise von zahlreichen Kindern und Enkeln auf 50 wirklich glückliche Ehejahre zurückblicken und nicht nur pflichtbewusst sagen können, dass wir eben durchgehalten hätten.
Und wie der Name schon sagt, besteht „Liebe“ – nun, aus Liebe eben.
Die könnte natürlich wieder aus unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt sein, ähnlich wie ein Kuchen zwar hundertprozentig Kuchen ist, und dennoch zu messbaren Teilen aus Mehl, Eiern und weiteren Zutaten besteht. Martin und mir fielen natürlich sofort eine ganze Menge Zutaten für den Kuchen namens „Liebe“ ein.
Als erstes natürlich: Glücklich sein, wenn man beieinander ist. Den anderen glücklich machen wollen.
Geduld und Nachsicht würden später auch einen guten Anteil an der Liebe ausmachen, zusammen mit einer ordentlichen Prise Humor beim Umgang mit den Schwächen des anderen. Die Fähigkeit, eigene Fehler einzugestehen, und die Bereitschaft, dem anderen immer wieder zu vergeben. Das gegenseitige Tragen in hoffentlich seltenen schweren Situationen.
Die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren und eingeschliffene Verhaltensmuster zu hinterfragen. Zu überlegen, warum ein bestimmtes Verhalten des Partners mich derartig auf die Palme bringt. Oder, wenn der Partner gerade auf der Palme sitzt, eine Leiter holen, über die er wieder herunter steigen kann.
Gemeinsame Interessen und Ziele. Ähnliche Wertvorstellungen. Vertrauen und Treue. Und, und, und. Für das Durchhaltevermögen blieben am Ende höchstens fünf Prozent übrig.
Diese Überlegungen sind nun fast 25 Jahre, drei Examen, zwei Kinder, neun Umzüge, sieben Gemeinden mit fünfzehn Kirchen, acht Schulen und unzählige unerwartete Herausforderungen her. Die Schmetterlinge im Bauch leben immer noch; ihr leiser Flügelschlag wird allerdings oft übertönt von türenknallenden Söhnen und dauerklingelnden Mailboxen. Statt händchenhaltend Pläne für die nächsten zehn Jahre zu spinnen, entwerfen wir rasch beim Mittagessen den nächsten Festgottesdienst oder stellen zusammen, was am Nachmittag noch alles getan werden müsste, vorzugsweise vom Ehepartner.
Alltag eben.
Wie viel Durchhaltevermögen haben wir dabei gebraucht? In einigen wenigen Ausnahmefällen waren es sicher die von Schwiegerpapa angesetzten 95 Prozent. Da hat es sogar gut getan, sich bewusst zu machen, dass auch Durchhaltevermögen ab und zu ein Liebesbeweis sein kann.
In den letzten 25 Jahren wurde unsere Liebe auch vor eine ganze Menge Herausforderungen gestellt. Die größten davon sind wohl einige Großbuchstaben, die jeweils eine Krankheit bezeichnen: Ein M und ein S für mich, und das so genannte CRASH-Syndrom1 bei unseren Jungs, das verhindert, dass sie sich so entwickeln können wie die meisten anderen Kinder um uns herum.
Andere Herausforderungen haben wir selbst geschaffen, glücklicherweise waren das bisher wesentlich banalere. So seltsam es auf den ersten Blick klingen mag: Auch die Frage nach der Funktion eines Shampooflaschen-Verschlusses oder nach der Anzahl an Feldsteinen, die ein schmales Beet verträgt, können sich als Stolperfallen für ein harmonisches Familienleben erweisen.
Gott sei Dank im wahrsten Sinne des Wortes konnten wir bisher alle Herausforderungen einigermaßen meistern und die tückischsten Stolperfallen rechtzeitig erkennen und umgehen.
So hoffen wir weiterhin darauf, im Sommer 2041 bei unserer Goldhochzeit gemütlich im Kreise von zwei Söhnen und zahlreichen Freunden beisammen sitzen können. Dann werden wir viel Schönes noch einmal Revue passieren lassen, bei der Erinnerung an manche Begebenheiten herzhaft lachen, einige Schwierigkeiten im Nachhinein als nicht ganz so riesig einschätzen. Und im Rückblick dankbar sagen: Es war eine gute Zeit miteinander. Wir haben nicht nur durchgehalten, sondern unsere Liebe hat gehalten.
Und dann stimmen wir mit allen Gästen ein Loblied an für unseren wunderbaren Gott, der uns über sonnige Hügel begleitet und durch dunkle Täler getragen hat.
1 Die Ursache des CRASH-Syndroms ist eine Veränderung des L1-Gens (L1CAM). Jeder Buchstabe des Syndroms steht für ein Symptom des Gendefektes: Corpus-callosum-Agenesie, mentale Retardierung, adduzierte Daumen, spastische Paraplegie und Hydrozephalus. Hinter diesen Fachbegriffen verbergen sich eine ungenügende Verbindung zwischen beiden Hirnhälften, eine verzögerte geistige Entwicklung, eingeschlagene Daumen, eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Spastik und ein Wasserkopf.
Schlüssel-Erlebnisse
August 1992
Streng genommen ist die Mathematik keine Naturwissenschaft, sondern lediglich „Logik, bis zum Exzess getrieben“. Als Beispiel für diese These zitierte mein Mathematiklehrer gerne den von Aristoteles begründeten Syllogismus:
| 1. Prämisse: | Alle Menschen sind sterblich. |
| 2. Prämisse: | Sokrates ist ein Mensch. |
Schlussfolgerung: Sokrates ist sterblich.
Die Mathematik funktioniert nur mit Hilfe derartiger logischer Schlüsse. Man braucht sie schon für so simple Überlegungen wie:
| 1. Prämisse: | Alle durch 2 und 3 teilbaren Zahlen sind auch durch 6 teilbar. |
| 2. Prämisse: | 36 ist durch 2 und 3 teilbar. |
Schlussfolgerung: 36 ist durch 6 teilbar.
Soweit, so logisch.
Ich würde gerne ein weiteres Beispiel hinzufügen:
1. Unbelebte Gegenstände können sich nicht eigenständig fortbewegen.
2. Schlüssel sind unbelebte Gegenstände.
Fazit: Schlüssel können sich nicht eigenständig fortbewegen.
Doch hier irrt die Mathematik, hier irrt die Logik, hier irrt Aristoteles. Irgendwo in diesem scheinbar glasklaren, irrtumsfreien Prinzip des Syllogismus muss es einen Denkfehler geben.
Denn Schlüssel können sich eigenständig fortbewegen.
Zumindest, wenn es sich um meine Wohnungsschlüssel handelt.
Martins Schlüssel laufen jedenfalls nie. Wenn er nach Hause kommt, legt er sie in die hölzerne Schale auf dem Telefontischchen. Dort bleiben sie unbewegt und brav liegen, bis Martin sie am nächsten Tag einsteckt, wenn er zur Uni geht.
Ich finde, Wohnungsschlüssel gehören nicht in Holzschalen auf Telefontischchen. Sie gehören in die Hosentasche. Denn was nützt das Wissen, wo mein Schlüssel liegt, wenn ich draußen vor der ins Schloss gefallenen Haustür stehe?
Deshalb lege ich meine Schlüssel auch nur selten in die von Martin dafür bereitgestellte Schale. Ich stecke sie einfach wieder zurück in die Hosentasche. Oder in die Jackentasche. Oder in den Rucksack. Oder ich lege sie kurz auf den Esstisch, solange ich meine Einkäufe in den Kühlschrank räume.
Aber eigentlich ist es völlig egal, wohin ich meine Schlüssel stecke. An drei von vier Tagen befinden sie sich am Morgen sowieso nicht mehr dort, wo ich sie deponiert habe. Weil sie eben durch die Wohnung spazieren.
Anders kann ich mir wirklich nicht erklären, wieso mein Griff regelmäßig ins Leere geht, wenn ich meine Schlüssel einstecken möchte. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich sie zurück in die Hosentasche gesteckt habe. Aber dort sind sie nicht mehr.
Wo sind sie dann? Das ist die Frage, die sich mir fast jeden Morgen stellt, etwa zwei Minuten, nachdem ich das Haus hätte verlassen müssen, um gemütlichen Schrittes zur S-Bahn zu gehen. Ohne Schlüssel komme ich nachmittags nicht in die Wohnung, also muss ich sie finden. Und zwar sofort, besser noch in minus zwei Minuten.
Welche Hose hatte ich gestern eigentlich an? Laut Martin die helle Jeans, die habe ich in die Wäsche gesteckt. Also durchwühle ich den Schmutzwäschekorb – vergeblich, die Taschen der hellen Jeans sind leer.
Welche Jacke hatte ich gestern an? Keine Ahnung, meine Kleidung ist mir nicht so wichtig, dass ich noch wüsste, was ich vor vierzehn Stunden getragen habe. Also muss ich an allen drei in Frage kommenden Jacken alle Taschen durchsuchen. Ich finde mehrere gebrauchte Papiertaschentücher und meinen schon seit einigen Tagen vermissten Einkaufswagenchip, aber keine Schlüssel.
Der Rucksack? Ist zwar nicht leer, aber schlüssellos.
Was habe ich gestern gemacht, als ich nach Hause gekommen bin? Ich habe eine Freundin angerufen. Habe ich dabei meine Schlüssel abgelegt? Also suche ich rund um das Telefontischchen. Auf dem Tischchen steht eine hölzerne Schale. In dieser liegt ein Schlüsselbund. Der von Martin.
Mein Herzallerliebster murmelt irgendetwas etwas von „wozu“, „Schale“ und „steht da“. Ich überhöre die Frage geflissentlich; ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich muss meine Schlüssel finden. Jetzt sofort. Besser noch in minus dreieinhalb Minuten.
Ratlos sehe ich mich in der Wohnung um. Der Küchentisch? Fehlanzeige. Das Bücherregal? Ebenso. Mein Nachttischchen? Drauf liegt nichts, aber davor: ein Schlüsselbund. Meiner!
Ihn schnappen, den Rucksack überwerfen und zur Türe hinausstürmen ist eins. Mit einem Sprint über einen knappen Kilometer erreiche ich gerade noch meine S-Bahn.
Erst jetzt finde ich Zeit, um zu überlegen: Wie sind meine Schlüssel vor das Nachttischchen geraten? Ich habe sie garantiert nicht dort hingelegt. Martin auch nicht. Einbrecher kann ich ebenfalls ausschließen.
Es gibt nur eine logische Erklärung: Sie müssen in der Nacht dorthin gewandert sein. Aus der Hosentasche. Oder aus der Jackentasche. Oder vom Telefontischchen herunter.
Und zwar weder zum ersten noch zum letzten Mal.
Ich werde mich wohl daran gewöhnen müssen, dass meine Schlüssel laufen können.
Juli 1994
Es ist also empirisch erwiesen, dass Schlüssel sich selbstständig fortbewegen, sobald sie mir gehören. Ebenso erwiesen ist es, dass sie diese Fähigkeit nicht besitzen, solange es Martins Schlüssel sind. Daraus ergibt sich eine Folgefrage: Wie verhalten sich die Schlüssel einer dritten Person, die diese uns beiden gemeinsam anvertraut hat?
In der Theorie lässt sich diese Frage nicht klären. In der Praxis wollen wir sie eigentlich nicht klären müssen. Und tun es doch.
Anlass ist die Hochzeit meiner Cousine im Allgäu. Meine Schulfreundin Heike wohnt in der Nähe. Was liegt da näher, als neben der Hochzeit noch Heike zu besuchen, und gleich bei ihr zu übernachten?
Heike sagt zu, obwohl sie an diesem Wochenende unterwegs sein wird. Wir verbringen einen netten Abend bei ihr; am Samstag bricht sie in aller Frühe mit ihrer Gemeinde auf in Richtung Berlin. Zurückkommen wird sie erst knapp 24 Stunden später.
Martin und ich frühstücken gemütlich, dann brechen wir auf zur Trauung meiner Cousine. Natürlich schließen wir Wohnungs- und Haustüre hinter uns ab. Und verschwenden während der folgenden Stunden keinen Gedanken an Heikes Schlüssel. Wozu auch? Wir feiern Hochzeit! Ein festlicher Gottesdienst, das Wiedersehen mit vielen Verwandten, eine fröhliche Feier bis nach Mitternacht – wer denkt da an Hausschlüssel?
Wir jedenfalls denken erst wieder daran, als wir aufbrechen wollen.
„Hast du die Schlüssel von Heikes Wohnung?“ Martins arglose Frage hat gewaltige Folgen. Denn ich habe die Schlüssel nicht. Nicht in der Handtasche, nicht in der Manteltasche. Hosentaschen kommen nicht in Frage, mein Kleid hat keine.
In Martins Hosen- und Jackentaschen befinden sich die Schlüssel auch nicht. Eine Handtasche hat er nicht. Im Auto? Auf und unter den Sitzen, unter den Fußmatten, auf der Hutablage, in den Seitenfächern, auf der Mittelkonsole und im Handschuhfach fördern wir so manches zutage, aber keine Schlüssel.
Wer hat Heikes Schlüsselbund eigentlich zuletzt in der Hand gehabt? Sowohl Martin als auch ich sind uns sicher, dass wir die Haustür abgeschlossen haben. Aber weder er noch ich können uns daran erinnern, wer die Schlüssel dann an sich genommen hat. Keine Chance, diese Überlegungen führen uns nicht weiter.
Also alles noch einmal von vorne. Alle in Frage kommenden Hand-, Hosen- und Jackentaschen komplett ausleeren, die Jackensäume abtasten, falls der Schlüssel durch ein Loch in der Tasche ins Innenfutter gerutscht ist, das Auto noch einmal komplett durchsuchen.
Nichts.
Vollkommen ratlos hocken wir uns in eine Ecke und beten. Aber auch dadurch fällt kein Schlüssel von der Stuckdecke, kommt uns keine Erleuchtung, wo wir noch suchen könnten.
Als gegen ein Uhr morgens die meisten Hochzeitsgäste aufbrechen, treten auch wir die Rückfahrt an. Vor der Haustür werden wir ein paar Stunden im Auto ausharren müssen, um dann Heike unser Missgeschick zu beichten. Eine Aussicht, die uns nicht gerade fröhlich stimmt.
Erst, als wir direkt vor Heikes Haus unser Auto abstellen, wissen wir schlagartig wieder, was wir nach dem Abschließen der Tür mit den Schlüsseln gemacht haben: Nichts.
Denn im Türschloss blinkt etwas Silbernes. Heikes Schlüsselbund. Sechzehn Stunden lang hat er dort gehangen, direkt am Bürgersteig. Ein Satz Schlüssel, der jedem x-beliebigen Passanten Zugang verschaffen konnte zu Hausflur, Keller und Heikes Wohnung.
Die Wohnung sieht nicht nur völlig unberührt aus, sie ist es auch.
Nein, Heikes Schlüssel sind uns zwar abhanden gekommen; sich eigenständig fortbewegen können sie aber nicht. Sie haben sich ja nicht einmal von einem Passanten fortbewegen lassen!
Und nein, Gott hat uns vorhin beim Beten keinen Schlüssel vor die Füße fallen lassen. Aber er hat an einer Haustüre mitten in Kempten auf einen dort stecken gelassenen Schlüsselbund aufgepasst. Damit dieser niemanden in Versuchung führen konnte.
Erleichtert fallen wir auf unsere Luftmatratzen. Ebenso erleichtert beichten wir am Morgen Heike, was passiert ist. Und gemeinsam sagen wir Gott Danke für alles, was nicht passiert ist.
Beifahrer
September 1992
Wovon träumen Jungen kurz vor ihrem achtzehnten Geburtstag?
Von einem kräftigeren Bartwuchs. Von hübschen Mädchen. Davon, einmal richtig viel Geld zu verdienen. Und vom Autofahren.
Am besten so wie James Bond auf seinen Einsätzen zur Rettung der Menschheit: Im coolen Aston Martin mit Tempo 200 und quietschenden Reifen durch enge Serpentinen, immer haarscharf am neben der Straße gähnenden Abgrund entlang, je nach Situation auf der Jagd nach oder auf der Flucht vor einem halben Dutzend wild um sich feuernder Gangster. Kurz bevor der Zuschauer beim Blick auf die nächste Haarnadelkurve zu gähnen beginnt, steuern letztere regelmäßig ihr Gefährt über die Straße hinaus.
Natürlich darf bei diesen Verfolgungsjagden nie das vollbusige Bond-Girl fehlen. Es räkelt sich auf dem Beifahrersitz und zeigt auch in der brenzligsten Lage nicht den geringsten Anflug von Panik. Sie kreischt nicht erschrocken auf, wenn ihr Held den Straßenverlauf querfeldein abkürzt. Wozu auch, der Mann an ihrer Seite kann schließlich Auto fahren! Natürlich weiß sie, dass für einen James Bond weder Geschwindigkeitsbeschränkungen noch rote Ampeln existieren. Es wäre also völlig überflüssig, ihn auf solche Banalitäten hinzuweisen.
So komplizierte Dinge wie Fliehkräfte oder Bremswege interessieren die junge Dame nicht. Als das in der Schule auf dem Lehrplan stand, hat sie nicht zugehört. Wahrscheinlich war sie damals gar nicht im Physikraum. Sondern auf der Toilette, um neue Wimperntusche aufzulegen.
Wenn der Held und das Mädchen schließlich an ihr Ziel gelangt sind, strahlt sein Hemdkragen immer noch in makellosem Weiß und sitzt ihre Frisur immer noch perfekt. Somit steht einem romantischen Abend nichts mehr im Wege. Kein finsterer Mafiaboss, und erst Recht kein kleinliches Gezänk über den Fahrstil.
Ja, so läuft das bei James Bond. Und so sollte es auch bei jedem beliebigen Teenager laufen, sobald er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.
Aber die Welt ist gemein, besonders zu männlichen Fahranfängern.
Statt eines Aston Martin steht ihm nur Mutters Kleinwagen zur Verfügung. Geht er diesen Kompromiss mit seinen Träumen ein und steuert das „Immerhinein-Auto“ auf die Straße, muss er feststellen, dass der Otto-Meier-Weg in Kleinkleckerlesdorf weder besonders steil noch besonders kurvenreich ist. Das einzige Hindernis, das ihm den Weg versperren will, ist ein Müllauto. Um das kann er nicht einmal gekonnt herumkurven, weil Gegenverkehr kommt.
Fast das einzige, was noch an den Filmhelden erinnern könnte, ist ein weibliches Wesen auf dem Beifahrersitz. Dieses trägt allerdings statt eines knappen Tops mit offenherzigem Dekolleté eine hochgeschlossene Bluse. Kein verführerisches Lächeln spielt um erotisch volle Lippen, sondern ein angstvoll zusammengepresster Mund stößt ein „Brems doch endlich, oder siehst du den Radfahrer dort hinten nicht?“ heraus.
Spätestens jetzt muss auch der kühnste Träumer unter den Fahranfängern sich der Tatsache stellen, dass das Leben kein Film ist, und er nicht James Bond. Und dass neben ihm keine aufreizende junge Dame sitzt, die sich auf einen romantischen Abend mit ihrem Helden freut. Sondern seine Mutter, die ihren Sohn bei seinen ersten eigenen Fahrversuchen beschützen möchte.
Man kann die Befürchtungen der Mutter durchaus nachvollziehen. Für den Sohn stellen seine nunmehr 18 Jahre ein ganzes Menschenleben dar; der Mutter ist noch allzu gut in Erinnerung, wie sie vor gar nicht langer Zeit ein winziges, hilfloses Menschlein in den Armen hielt, das sie fortan vor allen Gefahren des Lebens beschützen würde.
Und eben dieser Sohn, den sie bislang so sorgfältig behütet hat, schickt sich nun an, auf vier Rädern die Welt zu erobern? Er will sich ernsthaft den Gefahren des Straßenverkehrs aussetzen? Er nimmt für ein wenig mehr Freiheit in Kauf, dass die Mutter Abend für Abend ängstlich auf seine Rückkehr wartet und sich bei jedem Klingeln des Telefons ausmalt, was ihrem Sohn jetzt zugestoßen sein könnte?
Es fällt schwer, diese Tatsache in ihrem ganzen Ausmaß zu erfassen und auch nur ansatzweise zu akzeptieren.
Dem Sohn wiederum fällt es schwer, die Befürchtungen seiner Mutter auch nur ansatzweise zu verstehen. Schließlich ist er nun endlich erwachsen, schließlich hat er die Fahrprüfung schon beim ersten Versuch bestanden, schließlich trägt er stolz den amtlichen Nachweis in der Hosentasche, dass er sehr wohl in der Lage ist, alleine ein Auto über Autobahnen oder durch dichten Feierabendverkehr zu steuern!
Immerhin hat die Mutter sich nach reichlich Fürsprache des Vaters dazu überreden lassen, das vor kurzem noch so hilfsbedürftige, unselbstständige Kind in ihrem Auto Fahrpraxis sammeln zu lassen. Aber muss sie nun ängstlich darüber wachen, dass er auch ja keinen kilometerweit entfernt auf dem Radweg fahrenden Radfahrer übersieht? Muss sie vor jeder Kurve hörbar den Atem anhalten und sich panikartig an den Türgriff klammern? Muss sie ihn vor jeder Fahrt zur Vorsicht und zur Rücksicht auf ihre angstgestressten Nerven mahnen?
Man kann sich leicht ausmalen, dass zwischen dem gerade fahrtüchtig gewordenen Sohn und seiner beschützerinstinkt-geleiteten Mutter nur selten traute Harmonie herrscht. Auch wenn der Sohn irgendwann weitere Schritte ins Leben unternimmt und zu Hause auszieht, wird dieser Konflikt beide Seiten noch lange verfolgen. Die Mutter, die nun keinerlei Möglichkeiten mehr hat, auf ihren Sohn aufzupassen, und deren Fantasie sich darum umso schlimmere Bilder ausmalt, was diesem auf seinen Fahrten so alles zustoßen könnte. Und den Sohn, der auch ohne die mahnende Anwesenheit der Mutter weiter gegen deren unterschwelligen Vorwurf ankämpft, er könne nicht richtig Autofahren.
Was wäre besser dazu geeignet, diesen Verdacht endgültig aus der Welt zu schaffen, als eine hübsche junge Dame, die ihrem Helden am Steuer bewundernde Blicke zuwirft, während dieser seinen Ford Fiesta in James-Bond-Manier mit Tempo 120 lässig über die Autobahn steuert?
Es soll Fälle geben, in denen dieses Szenario Wirklichkeit wird.
Bei Martin und mir stimmten dafür von Anfang an einige Voraussetzungen nicht: Erstens besaß Martin gar kein Auto, als wir uns ineinander verliebten. Der Fiesta war meiner. Zweitens bin ich kein Bond-Girl. Nicht nur, weil ich weder Model-Maße noch Wimperntusche besitze. Sondern auch, weil ich im Physikunterricht zumindest soweit aufgepasst habe, dass ich eine Ahnung von Fliehkräften und Bremswegen habe.
Ich halte mich trotzdem für eine gute Beifahrerin.
Immerhin habe ich meinen Liebsten ohne Zögern ans Steuer meines Wagens gelassen. Ich weise ihn nicht auf rote Ampeln hin und gebe keine Tipps zur Bedienung der Gangschaltung.
Aber ich halte in der Regel meine Augen offen. Folglich sehe ich, dass drei Autos vor uns ein Bremslicht aufleuchtet. Oder dass der LKW etwa einen Kilometer vor uns auf der Autobahn den Blinker zum Überholen gesetzt hat. Ich weiß, dass ein solches Ereignis die nachfolgenden Autos zum Bremsen veranlassen wird, und dass die kollektive Bremsaktion irgendwann auch uns erreichen muss.
Trotzdem macht der durchaus sichere Fahrer links neben mir keinerlei Anstalten, seinen Fuß vom Gas- auf das Bremspedal umzusetzen.
Was liegt da näher, als selbst auf die Bremse zu treten?
Wohlgemerkt, als Beifahrerin.
Wir haben keinen Fahrschulwagen, also kann ich so oft und so heftig in das Bodenblech treten, wie ich will, das Auto wird seine Geschwindigkeit auch nicht im Geringsten verringern.
Das einzige, das sich ändert, ist die Laune des Fahrers. Muss ich so mit den Füßen herum zucken? Ja doch, natürlich hat er den ausscherenden LKW gesehen. Aber noch ist ja gar nicht sicher, ob auch wir deswegen bremsen müssen, dafür ist der LKW viel zu weit vor uns. Ob ich ihm nicht zutraue, dass er alles im Griff hat? Ob ich tatsächlich denke, er könne nicht sicher Autofahren?
Noch bevor Martin mit seinen vorwurfsvollen Fragen fertig ist, hat meine Laune sich der seinen angepasst.
Natürlich traue ich ihm zu, dass er uns beide heil an unser Ziel bringt. Aber das Auto dort vorne hat doch wirklich gebremst! Ob er da nicht wenigstens den Fuß vom Gaspedal nehmen könnte? Und außerdem hat er ganz offensichtlich vorhin das Tempo-100-Schild übersehen, sonst würde er nicht immer noch auf der Überholspur zusammen mit allen anderen Autos 120 fahren. Ob er vielleicht irgendwann gedenkt, nach rechts zu wechseln, um uns einen Strafzettel zu ersparen?
Nein, daran denkt der Mann am Steuer nicht. Schließlich gibt es hier weder eine Radarfalle noch einen Grund für die Geschwindigkeitsbeschränkung. Und ein Spurwechsel verzögert den Verkehrsfluss.
Er könnte auch den Zeitpunkt unseres ersten Unfalls verzögern, denke ich. Diese Überlegung behalte ich aber lieber für mich.
Und so schweigen wir uns in der folgenden halben Stunde sehr beredt an.
So lange, bis ich mich in einer engen Kurve am Türgriff festhalte. Für mich eine instinktive Reaktion, für Martin ein Zeichen von vollkommen unnötiger Angst. Das Auto wird schon nicht aus der Kurve fliegen! Ob ich immer noch nicht weiß, dass er fahren kann?
Natürlich weiß ich, dass Martin völlig sicher Auto fährt! Aber gerade eben war da diese Kurve …
Und prompt geht die ganze Diskussion, nur mit leicht abgewandeltem Thema, von vorne los.
So haben wir auf längeren Fahrten immer wieder gestritten und uns letztendlich schmollend angeschwiegen. So lange, bis Martin den entscheidenden Satz gesagt hat, der uns auf den tiefen Grund unserer regelmäßigen Verstimmungen geführt hat: „Du benimmst dich wie meine Mutter!“
Doch, ich schätze meine Schwiegermutter durchaus. Nur ist sie eben eine reichlich besorgte Beifahrerin. Und ihr mütterlicher Beschützerinstinkt ist besonders stark ausgeprägt. Wie schon gesagt, bei einem Kleinkind ist letzterer wichtig und notwendig. Aber auf einen achtzehnjährigen Fahranfänger trug die Kombination aus mütterlicher Angst und Sorge nicht gerade zu einer Steigerung seines Autofahrer-Selbstbewusstseins bei.
Und nun sitzt neben dem Fahranfänger von einst die ersehnte junge Dame. Aber die denkt gar nicht daran, sich in Bond-Girl-Manier völlig cool darauf zu verlassen, dass er alle Eventualitäten des Straßenverkehrs mit links meistern wird. Stattdessen denkt die Blondine auf dem Beifahrersitz mit drei oder vier Autos vor sich mit. Und reagiert auf deren Fahrweise schneller, als ihr Liebster am Steuer das tut. So greift sie eben manchmal nach dem Türgriff, zuckt instinktiv zusammen oder tritt auf eine nicht vorhandene Bremse. Für sie ist das überhaupt keine Kritik an seinem Fahrstil. Aber bei ihm kommt es so an. Weil ich mit meinem Zucken die gleiche Kerbe in den Gefühlen meines Liebsten treffe wie vor Jahren seine Mutter.
Als Martin und ich endlich auf die Gründe für unsere ungewöhnlich häufigen und heftigen Diskussionen beim Autofahren gestoßen sind, haben wir uns erst einmal betreten angeschaut. Denn was konnten wir schon tun, um derartige Szenen künftig zu vermeiden? Das Mitdenken und Mit-Reagieren als Beifahrerin war mir doch schon längst in Fleisch und Blut übergegangen! Das würde ich so einfach nicht ändern können, auch wenn ich jetzt um Martins Empfindlichkeit an diesem Punkt wusste. Und wie sollte Martin die tiefe Kerbe in seinem Inneren ignorieren, die von jeder ängstlichen Reaktion meinerseits noch ein wenig tiefer eingeschlagen wurde?