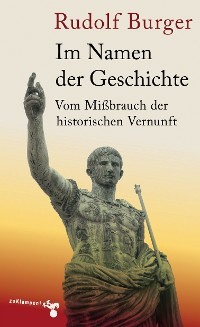Buch lesen: "Im Namen der Geschichte"
Rudolf Burger
Im Namen der Geschichte
Vom Mißbrauch
der historischen Vernunft

© 2007 zu Klampen Verlag · Röse 21 · D-31832 Springe
info@zuklampen.de · www.zuklampen.de
Umschlag: Matthias Vogel (paramikron), Hannover
Umschlagfoto: © ackab – Fotolia.com
Satz: thielenVERLAGSBÜRO, Hannover
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014
ISBN 978-3-86674-380-9
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über ‹http://dnb.ddb.de› abrufbar.
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Vorrede
I
Der neue Historismus
Das elfte Gebot
Lehren der Geschichte?
II
Konfundierungen
Der lange Schatten der Theologie
Sinngebungsversuche
Von der Strenge der Wissenschaft
Resumee
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
VORREDE
Nichts ist verständlicher als der Haß,
doch seien Sie nicht verlogen!
Jacques Vergès
Im Gespräch mit Euthyphron, einem frommen Mann und Priester, der Kraft seines Amtes zu wissen glaubt, was das Gute, das Edle und das Gerechte sei und deshalb auf dem Wege ist, seinen eigenen Vater zu denunzieren, durch dessen Mißgeschick ein Mensch zu Tode kam, läßt Platon den Sokrates sagen:
»Worüber also müßten wir uns wohl streiten und zu was für einer Entscheidung nicht kommen können, um uns zu erzürnen und einander feind zu werden? Vielleicht fällt es dir eben nicht bei: allein, laß es mich aussprechen und überlege, ob es wohl dieses ist, das Gerechte und Ungerechte, das Edle und Schlechte, das Gute und Böse. Sind nicht dies etwa die Gegenstände, worüber streitend und nicht zur völligen Entscheidung gelangend wir einander feind werden, sooft wir es werden, du und ich sowohl als auch alle übrigen Menschen?«1
Ich sehe nicht, wie das je anders werden könnte. Denn es erscheint mir gewiß: Solange Menschen existieren, die den Namen Menschen verdienen, werden sie darüber streiten, was in konkreten Lagen gut ist und was böse. Und sie werden für ihre Überzeugungen auch kämpfen, wenn es sein muß, auf Leben und Tod. Selbst wenn alle Menschen einmal Schwestern werden sollten und Brüder, würde sich daran nichts ändern: Die Atriden waren auch eine große Familie. Der Skeptiker ist vor dieser polemischen Verwicklung nicht gefeit, im Gegenteil, er ist in besonderer Weise in sie involviert. Aber indem er sie reflektiv zu seinem Thema macht, versucht er ihren Konsequenzen die Schärfe zu nehmen: Das Gute ist auch für den Skeptiker das Gute, aber der Glaube zu wissen, was es sei, ist ihm das Böse – weil dieses im Eifer der Realisierung des Guten selber liegt, worin immer es bestehen mag. Deshalb sucht er zu jeder These die Antithese, also die »Gewaltenteilung im Absoluten« (Odo Marquard).
Wir wissen heute, oder könnten es wissen: Alle großen Verbrechen entspringen großen Idealen, nicht dem bösen Willen, die Täter verfolgen aus ihrer Binnenperspektive immer »das Gute«, ihr Antrieb ist stets eine »Begierde des Rettens« (Hegel) und sie sind um Objektivierungen nie verlegen, hießen diese Rasse, Klasse, Volk oder Nation: Man kann dem Nationalsozialismus und dem Stalinismus vieles nachsagen, aber nicht, daß sie keine »Wertegemeinschaften« gewesen seien – der Kommunismus als Ideal war eine »Wertegemeinschaft« sogar im wörtlichen Sinne. Heute mobilisiert man im Namen der »Menschlichkeit«, was den Gegner implizit zum Unmenschen erklärt. Die fürchterlichsten Massaker wurden niemals von Skeptikern oder Nihilisten verübt, sondern von Gläubigen und Utopisten, im Namen von mächtigen Idealen. Deren Inhalte und Formen wechseln, sie hatten im 17. Jahrhundert die Gestalt von Religionen, im 20. Jahrhundert die politischer Ideologien; und wenn nicht alles täuscht, so schließt sich der Kreis und die Moderne kehrt zu ihren fideistischen Ursprüngen zurück. Das fällt umso leichter, als sie diese in einem zentralen Punkt nie verlassen hat: in ihrem Glauben an die Geschichte – an ihre Wahrheit, ihre Lehren, ihren moralisch verpflichtenden Sinn.
Die heiligen Bücher der Juden, der Christen und Muslime sind zunächst und vor allem historische Berichte, die wörtlich genommen sein wollen; erst die Theologie machte Metaphern daraus, und diese wurden zu Bausteinen der Geschichtsphilosophie, mit der empirischen Historiographie als Mörtel. Die prophetisch gewendete Geschichtsphilosophie ist heute politisch desavouiert, aber die Autorität der Geschichte ist ungebrochen als Stütze moralischer Legitimität. Es geht daher bei unseren skeptischen Überlegungen nicht nur um Geschichtsphilosophie in jenem Sinn, der seit dem 18. Jahrhundert in Geltung ist, es geht nicht nur um die holistischen Konstruktionen von »Weltgeschichte«, es geht auch um all die kleinen und großen, zeitlich und geographisch lokalen Partialgeschichten, Erzählungen von Begebenheiten, Ereignissen und Schicksalen von Gruppen und Individuen, die dadurch zu Gruppen und Individuen erst werden: Es ist verblüffend, wie sehr all die identitätsstiftenden Legenden, sie mögen noch so sehr empirisch »richtig« sein, strukturell jenen Märchen ähneln, mit denen man Kinder in den Schlaf wiegt: Sie haben einen Anfang, ein Ende und einen »Plot«, der den dramatischen Sinn des Geschehens ausmacht – aber wo ist in der Realgeschichte ein Anfang, wo ein Ende? Wann beginnt die Französische Revolution, wann endet sie? Beginnt sie mit der Einberufung der Generalstände oder mit dem Sturm auf die Bastille? Endet sie mit dem 9. Thermidor, dem 18. Brumaire oder erst mit Waterloo und dem Wiener Kongreß? Carlyle beginnt seine Geschichte der Französischen Revolution mit dem Tod Ludwig XV. und läßt sie enden mit der Niederschlagung der Vendémiare – Insurrektion des Jahres 4 durch den Bürger Bonaparte – es ist der 5. Oktober 1795 nach alter Zeitrechnung. Bernard Faÿ beginnt seine Geschichte der Großen Revolution nicht 1774, sondern 1715 mit dem Tod Ludwig XIV. und endet mit der Restauration Ludwig XVIII. Und wodurch ist die Revolution »erklärbar«? Durch die Finanzkrise, das Erstarken des Bürgertums, das Wühlen der Philosophen oder die Entmachtung des Adels seit dem Absolutismus des 17. Jahrhunderts? Und wie tief in die Zeit muß man zurückgehen, um den 1. September 1939 zu »erklären«? Bis zum 30. Jänner 1933, bis zum November 1918 oder bis zum Dreißigjährigen Krieg? Und warum erzählen wir uns diese Geschichten überhaupt – um etwas zu lernen, oder aus Pietät? Wir erzählen sie uns, weil wir gar nicht anders können, weil wir uns in der Welt zurechtfinden wollen, obwohl das, wie wir täglich von Neuem erfahren, ein vergebliches Bemühen ist. So betrügen wir uns selber, wie wir unsere Kinder betrügen, in durchaus guter Absicht. »Es war einmal … und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch«: Souverän verfügt der Erzähler über die Ereignisse, und indem er sie ausmalt in ihrer Pracht und ihrem Schrecken, distanziert er sie zugleich und macht ein Lehrstück daraus; beruhigt schlafen die Kinder ein und träumen von eigenen Heldentaten, auch wenn das, was sie hörten, voll Grauen war; es ist schließlich weit weg und lange her. Aber sie haben gelernt und werden es besser machen, das geht seit jeher so.
Die Funktion der Geschichten ist immer die gleiche, seien sie erfunden oder Berichte von Realem, weil sie so oder so Literatur sind. Sie geben einer sinnlosen Welt eine Sinnstruktur und ordnen sie moralisch: So machen sie sie scheinbar vertraut. Sie greifen über die eigene Existenz hinaus und machen die Monaden solidarisch: So stiften sie eine Gemeinschaft. Sie geben dem Zufall eine Bedeutung und dem Tod einen Sinn: So nehmen sie ein wenig die Angst vor dem Sterben.
All diese Funktionselemente, die, mehr oder minder verborgen oder verleugnet, auch in der modernen Geschichtsschreibung enthalten sind, liegen in den Mythen offen zutage. Jene frühen Erzählungen, die noch ohne Scham Literatur und Historie zugleich waren, begründeten Kulturen, verliehen ihnen Identität in Raum und Zeit, verknüpften sie mit einem Ursprung und tradierten einen Schuld/Opfer-Zusammenhang, der ein Kollektiv formierte, in dem das Individuum seinen moralischen Platz fand. Abgeschirmt und teilweise entlastet von fiktionaler Literatur, doch deshalb nicht weniger wirksam, hat heute die »Geschichte« diese Aufgaben übernommen: Sie ist der Mythos der Moderne.
Indem ich dieser »Geschichte« in skeptischem Geist einiges von ihrer epistemischen und moralischen Verbindlichkeit zu nehmen beabsichtige, werde ich mich auf ein vermintes Gebiet begeben – und Sie mit mir, wenn Sie meiner Einladung folgen und mich begleiten. Der Zorn der Gläubigen ist uns sicher. Die Geschichte, nicht diese oder jene Geschichte in ihrer empirischen Richtigkeit, sondern die Geschichte überhaupt in ihrer »ontologischen Würde« anzugreifen, die den Menschen Sinn, Halt und Stil gibt, heißt die Menschlichkeit selbst zu attackieren, heißt, sie in ihrem innersten Wesen in Frage zu stellen. Denn Menschen sind geschichtenerzählende Wesen, sie sind, wie Odo Marquard sagt, »mythenpflichtig«. Jedes Individuum, jede Gemeinschaft, jedes Kollektiv, jede kulturelle, jede politische Einheit, sei es eine Familie, ein Stamm, eine Ethnie, ein Volk, ein Staat, eine Staatengemeinschaft oder auch eine Klasse oder ein Stand, definiert sich über eine Geschichte, die er oder sie als die seine beansprucht, die ein Innen und ein Außen bestimmt und damit eine Identität schafft und die allein schon dadurch eine moralische Verpflichtung auferlegt. Glücklicher werden wir dadurch nicht, aber erst durch das historische Bewußtsein werden wir zu Menschen. Bis zu einem gewissen Grad, und auch das nur dann, wenn wir auch das historische Bewußtsein nur bis zu einem gewissen Grad entwickeln – das heißt, wenn wir es zwar einerseits in seiner Notwendigkeit und seiner Unausweichlichkeit zur Kenntnis nehmen, es aber andererseits reflexiv distanzieren, der Empfehlung Max Stirners folgend es nicht zu »unserer Sache« machen, es also so weit wie möglich entpathetisieren. Genau dies: die Entpathetisierung der Affekte, die Dämpfung der Leidenschaften, die »Metriopathie« durch Mobilisierung der inneren Widersprüche der Sache selber, ist die Pointe des Skeptizismus, in dessen Geist dieser Essay geschrieben ist. Er ist die überarbeitete und erweiterte Fassung einer »pyrrhonischen Skizze der historischen Vernunft«, die ich als Streitschrift zur Vergangenheitspolitik unter dem Titel »Kleine Geschichte der Vergangenheit« im Jahre 2004 bei Styria in die Debatte geworfen habe.
Rudolf Burger, Juni 2007
I
Kein Schmerz ist klein, wenn es wirklich
weh tut, aber jeder Schmerz ist ein Witz,
wenn er gehätschelt wird.
Edward St. Aubyn
DER NEUE HISTORISMUS
Als der noch nicht dreißigjährige Friedrich Nietzsche im Jahre 1874 seine »Zweite unzeitgemäße Betrachtung«: »Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben« veröffentlichte, da war der Historismus auf seinem Höhepunkt, in allen seinen Spielarten: künstlerisch, kulturell und politisch. Man baute gotischer als die Gotik, barocker als der Barock, die klassische Bildung stand in höchstem Ansehen, die historische Gelehrsamkeit erreichte eine zuvor nie gekannte Blüte und mit dem Darwinismus wurde sogar die Natur historisiert. Das sogenannte »Erwachen der Nationen« aus ihrem historischen Schlummer ermunterte den europäischen Imperialismus und verschaffte ihm ideologische Legitimation. Auch der »wissenschaftliche« Utopismus der revolutionären Linken bezog seine Begründung aus den angeblichen Gesetzen der Geschichte. Im Unterschied zu traditionalen Gesellschaften wurde Geschichte reflexiv und bewußt als Verpflichtungssystem etabliert, ästhetisch, moralisch und kulturell – in Reaktion auf die hereinbrechende künstlerische, technische und industrielle Moderne, die alle traditionellen Verbindlichkeiten zu sprengen drohte, als Ballast im Sturm der Veränderung. Gegen diesen Ballast protestiert Nietzsches Schrift, gegen den historischen Geist der Schwere, auch wenn er diesen selbst anthropologisch und nicht selbst wiederum historisch begreift. Doch so heftig Nietzsche gegen den Historismus polemisiert, er schreibt nicht gegen die Geschichtsphilosophie, er ignoriert sie einfach.
Hegel war für Nietzsche, wie schon für seine Lehrer Arthur Schopenhauer und Jacob Burckhardt, ein, wie Karl Marx es ausdrückte, »toter Hund«, und deshalb entging ihm jene geistige Strömung, welche sich damals im Untergrund schon deutlich abzeichnete und die als machtvolle Bewegung die großen intellektuellen Auseinandersetzungen und politmoralischen Frontlinien des 20. Jahrhunderts bis in dessen letztes Jahrzehnt bestimmen sollte: die in der marxistischen Revolutionstheorie materialistisch uminterpretierte und prognostisch gewendete Hegelsche Geschichtsphilosophie, die als solche immer auch Geschichtsschreibung blieb, freilich auf methodologisch höchst reflektiertem Niveau. Mit dem ihr eigenen prophetischen Gestus, der den Gang der Geschichte selbst dirigierte und den Weg zu weisen vorgab in eine klassenlose, befriedete Gesellschaft, setzte sie politische Energien ganz anderer Größenordnung frei als jene historischen Schulen, die Nietzsche seiner Kritik unterwarf. Auch moralisch war sie von viel strengerer Verbindlichkeit als die »monumentalische«, »antiquarische« und »kritische« Geschichtsschreibung, die Nietzsches Thema war und die den liberalen Historismus des 19. Jahrhunderts geprägt hatte. Das sollte sich bald dramatisch ändern. Das beste Zeugnis dafür hat der große Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty geliefert, der kein Hegelianer war und kein Marxist, als er noch 1947, fast ein halbes Jahrhundert nach Nietzsches Tod und dreißig Jahre nach der russischen Revolution, in Auseinandersetzung mit dem stalinistischen Terror, den Arthur Koestlers Roman »Sonnenfinsternis« auf die Tagesordnung westlicher Intellektuellendebatten gesetzt hatte, in seinem Traktat »Humanismus und Terror« die Sätze schrieb:
»[Die Diskussion] besteht nicht darin zu untersuchen, ob der Kommunismus die Spielregeln des liberalen Denkens einhält (zu offensichtlich ist, daß er das nicht tut), sondern ob die Gewalt, die er ausübt, revolutionär ist und fähig, zwischen den Menschen menschliche Beziehungen herzustellen. Die marxistische Kritik der liberalen Idee ist so stark, daß man, falls der Kommunismus im Begriff wäre, durch die Weltrevolution eine klassenlose Gesellschaft zu errichten, in der gleichzeitig mit der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen auch die Ursachen für Krieg und Dekadenz verschwunden wären, Kommunist sein müßte […]. Ist der Kommunismus seinen humanistischen Absichten gewachsen? Das ist die wirkliche Frage.«2
Kein Mensch würde heute mehr so schreiben oder reden. Eine abschlägige Antwort auf Merleau-Pontys Frage scheint uns heute so gewiß, daß schon das Stellen der Frage lächerlich wirkt; damit aber auch das instrumentelle Verhältnis zur Gewalt und die Auflösung der Moral in Politik fast obszön. 1947 aber, im Jahre der Truman-Doktrin und der Shdanov-Rede zu Beginn des Kalten Krieges, konnte Merleau-Ponty die Frage der Moral noch als eine offen politische stellen, d. h., er diskutierte sie im Rahmen eines geschichtsphilosophischen Entwurfs. Doch daß er sie überhaupt diskutierte, sie nicht einfach mit Marx den ideologischen Formen zuschlug, indiziert allein schon ein Brüchigwerden teleologischer Gewißheit, welche das Handeln Gletkins und Rubaschows in Koestlers Roman noch bestimmt hatte. Die Tragik des letzteren besteht ja darin, daß er sich selbst verurteilen muß nach seinen eigenen Prinzipien, weil er durch politischen Irrtum von der richtigen Linie abgewichen war. Moral kommt so nur ex negativo ins Spiel. Dem Funktionär und Militanten, der sich als Exekutor einer geschichtlichen Tendenz versteht, ist die Moral in die Transzendentale und in die historische Transzendenz zugleich gerutscht; als Regulativ empirischer Praxis wird sie tendenziell außer Kraft gesetzt: Diese bestimmt sich nach strategischen Kalkülen, so wie es immer schon die seines Gegners tat, der auch das moralische Gebot zum taktischen Einsatz brachte. Moral geht allerdings als Impuls seinem Handeln voraus, das seinerseits einen Zustand herstellen soll, der als in sich sittlicher des moralischen Regulativs nicht mehr bedarf – was allerdings den Bruch gegebener Strukturen impliziert und also die Anwendung von Gewalt nicht ausschließt.
»Wenn das Böse und das Gute wieder in die Zeit eingegliedert und mit den Ereignissen verschmolzen werden, dann ist nichts mehr gut oder böse, sondern nur verfrüht oder verspätet. Wer entscheidet über die Opportunität, wenn nicht der Opportunist? Später, sagen die Schüler, werdet ihr richten. Aber die Opfer sind nicht mehr da, um zu richten. Für das Opfer ist die Gegenwart der einzige Wert«, schreibt Albert Camus 1952 gegen Merleau-Pontys historische Relativierung der politischen Moral3. Die Figur des »Opportunisten« ist diskreditiert, und auch Camus verwendet die Bezeichnung »Opportunist« in einem pejorativen Sinn. Doch jeder Politiker ist ein Opportunist, wenn er nicht entweder dumm ist oder ein Phantast; aber dann ist er ja auch kein Politiker, sondern entweder ein ideologischer Missionar oder ein politischer Fanatiker. Für den rigorosen Moralisten ist pragmatische Politik immer unmoralisch, aber sie ist es auch für den, der unter Politik die Exekution eines historischen »Sinns« versteht. Jene, die, wie es so heißt, »Geschichte machen« wollten, negierten die konkrete Moral, doch im Namen einer desto strengeren abstrakten. Diese Dialektik hat Camus gemeint, als er im gleichen Text, in »L’Homme révolté«, die Sätze schrieb: »Das geschichtliche Denken sollte den Menschen von seiner Unterwürfigkeit unter Gott befreien, doch verlangt diese Befreiung von ihm die vollständige Unterwerfung unter das Werden. Dann rennt man zum Parteibüro, wie man sich vor dem Altar niederwarf. Aus diesem Grund bietet die Epoche, die sich als im schärfstem Aufstand zu bezeichnen wagt, nur die Wahl zwischen mehreren Konformismen. Die wahre Leidenschaft des 20. Jahrhunderts ist die Knechtschaft.«4
Und deshalb lautet der Originaltitel von Koestlers Roman auch nicht »Sonnenfinsternis«, sondern im verschollenen deutschen Original »Circulus vitiosus«– denn aus der Logik des geschichtlichen Urteils gibt es kein Entkommen, weil es das moralische, das man gegen es ausspielt, selber ist, in äußerst radikalisierter Gestalt!
Spätestens seit 1789 beruft der Revolutionär sich darauf, daß er wahre Rechtsverhältnisse erst herstellen will und daß er die Gewalt nicht erfunden, sondern vorgefunden hat und gegen ihre eigentlichen Urheber kehrt. Paradigmatisch steht dafür Saint-Just, der den Terror als Mittel zur Tugend empfahl (in der Rede zu den Ventôs-Dekreten z. B.), und natürlich vor allem Robespierre, der in seiner großen Rede »Über die Prinzipien der politischen Moral« (1794) den Schrecken geradezu zum Ausfluß der Tugend erklärte (»er fließt aus der Tugend«, wie er wörtlich sagt). Da diese Männer selbst aus Tugend heraus handelten, war dieser Schritt nur konsequent, denn der Tugend ist, wie Hegel schreibt, »das Gesetz das Wesentliche, und die Individualität das Aufzuhebende«. Ihre abstrakte Gewalt abstrakt zu verwerfen, wie es die konventionelle Moral verlangt, heißt mit ihrem Mittelcharakter das Ziel verurteilen, das in der Abschaffung gewaltförmiger Verhältnisse liegt. Mit anderen Worten, die Amoralität des politischen Militanten ist nur die zu Ende gedachte Moralität selbst.
Jedes politische Handeln ist unausweichlich praxis und poiesis zugleich, Umgang mit Menschen als Subjekten und deren Degradation zum Material. Wer es auf praxis reduzieren und moralisch »binden« will, ist entweder ein Heuchler oder er weiß nicht, was er sagt. Den anderen niemals nur als Mittel zu gebrauchen, wie es in einer seiner Fassungen der Kantische Imperativ verlangt, heißt zugegeben, daß er immer auch Mittel ist, und je weiter der angestrebte Zustand vom gegenwärtigen entfernt ist, desto stärker tritt dieses Moment hervor. In dem Maße, in dem das Handeln sich selbst als historisch versteht, hebt es das moralische Urteil im politischen auf.
Gegen die abstrakte Tugend der bürgerlichen Revolution hat sich die nachkantische Philosophie gewandt. Das revolutionäre Handeln sucht nun seine Rechtfertigung in der Geschichtsphilosophie, nicht in den zeitlosen Geboten der Moral, die es umgekehrt zum ideologischen System erklärt und seinerseits dem strategischen Kalkül unterwirft. Diese Idee von Geschichte als Befreiungsprozeß hat selbst über mehr als ein Jahrhundert die Geschichte bestimmt und die Welt bis vor kurzem in zwei Lager gespalten. Und das Engagement, oder zumindest die stille Parteinahme, für eines der beiden Lager gab den Individuen, und zwar gerade den aufgeklärtesten und bewußtesten unter ihnen, das, was sie in einer postreligiösen und postmetaphysischen Zeit am meisten brauchten: ein Lebensziel und so etwas wie einen »Sinn«, der ihr Dasein überwölbte und rechtfertigte. So wurde der Parteigänger zur herrschenden Sozialfigur eines ganzen Jahrhunderts.
Der große russisch-französische Hegelinterpret Alexander Kojève, durch dessen Seminare über die »Phänomenologie des Geistes« in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts fast alle späteren Größen der französischen Philosophie gegangen sind, hat die beiden Lager – das bürgerlich-kapitalistische auf der einen Seite, das proletarisch-kommunistische auf der anderen – als politisch-praktische Derivationen der Hegelschen Geschichtsphilosophie verstanden, deren Kampf, bewußt oder nicht, über die richtige Interpretation dieses Textes entscheiden sollte. Denn es gab, wie Kojève den Zustand des in sich zerrissenen absoluten Geistes nach 1831, also nach Hegels Tod, charakterisiert, zwar »von Anfang an eine Hegelsche Linke und eine Hegelsche Rechte, das war aber auch alles, was es seit Hegel gegeben hat«5 – wobei »Hegelsche Linke« nur eine kapriziöse Terminologie für den revolutionären Marxismus ist. Dieser war die einzig ernstzunehmende, weil historisch folgenreiche Philosophie, die in Konsequenz des Hegelianismus ein höheres Prinzip als Telos der Geschichte versprach als den liberalen, bürgerlich-kapitalistischen Verfassungsstaat:
»Sieht man von den Relikten der Vergangenheit ab, die Hegel gekannt und beschrieben hat (einschließlich des ›Liberalismus‹) und die ihm folglich nicht als historische oder ›dialektische‹ Widerlegungen entgegengehalten werden können, dann stellt man fest, daß es streng genommen nichts außerhalb des Hegelianismus gegeben hat (bewußt oder nicht), und zwar weder auf der Ebene der geschichtlichen Wirklichkeit selbst noch auf der Ebene des Denkens und der Rede, was eine historische Auswirkung gehabt hätte. Daher kann man […] nicht sagen, daß die Geschichte den Hegelianismus widerlegt habe. Man kann höchstens behaupten, daß sie sich noch nicht zwischen ihrer ›linken‹ und ihrer ›rechten‹ Interpretation der Hegelschen Philosophie entschieden habe. […] Nach Hegel kann nun eine Diskussion nur durch die Wirklichkeit entschieden werden, d. h., durch die Verwirklichung einer der beiden einander bekämpfenden Thesen. Die verbalen Polemiken oder ›Dialektiken‹ reflektieren nur die wirkliche Dialektik, die eine Dialektik des Handelns ist, das sich als Kampf und Arbeit manifestiert. Und in der Arbeit (›Wirtschaftssystem‹), in Revolutionen und Kriegen spielt sich seit fast 150 Jahren die Polemik zwischen ›Hegelianern‹ ab. […] Die Geschichte (wird) den Hegelianismus niemals widerlegen, sondern sich damit begnügen, zwischen ihren beiden entgegengesetzten Interpretationen zu wählen.«6
Das schrieb Kojève 1946, als die beiden Wirklichkeit gewordenen Interpretationen einander als »Blöcke« schroff gegenüberstanden. Auf der Ebene der Ideologie vertraten beide Blöcke eine universalistische Moral, doch keine von beiden war universal, sondern bloß regional auf ihre jeweilige Macht- und Einflußsphären beschränkt: Der menschenrechtliche Universalismus der »Freien Welt« stand dem proletarischen Internationalismus der kommunistischen gegenüber; regional beschränkt, negierten sie einander und beanspruchten je für sich globale Macht und Geltung. Manichäisch zugespitzt, war die Entscheidung noch offen, die Geschichte hatte noch nicht gewählt zwischen den konkurrierenden Lesarten ihres hegelschen Textes. Jetzt, würde Kojève sagen, wenn er noch lebte, jetzt, seit 1989, mit dem Zusammenbruch des Kommunismus, hat sie sich entschieden, und zwar für die rechte Variante ihrer Interpretation. Das liberal-kapitalistische Prinzip hat gewonnen und ist im Prinzip als höchstes Prinzip der gesellschaftlich-ökonomischen Organisation universal geworden. Der Rest ist Ausformulierung, Differenzierung und Verbreitung, wenn es sein muß, mit Gewalt, schlimmstenfalls partieller Rückfall auf frühere, primitivere Stufen des Sozialen, auf faschistische etwa oder auf religiös-fundamentalistische, also auch nichts Neues. Ein höheres Prinzip aber als der laizistische, bürgerlich-liberale Verfassungsstaat mit Massendemokratie und Gewaltenteilung auf Basis einer kapitalistischen Ökonomie, sozialstaatlich vielleicht ein bißchen aufgeweicht, ökologisch supplementiert und durch Kunst am Bau ein wenig verschönert, ist nicht in Sicht. Das ganze Arrangement nennt sich »Kulturgesellschaft«, und zwar mit Recht. Es ist das adäquate Gehäuse für jene Figur, die Nietzsche den »letzten Menschen« nennt, der bei sich selbst das Glück gefunden hat und dabei blinzelt: Denn die Kämpfe, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts, bewußt oder nicht, Kämpfe um die richtige Auslegung eines Textes waren, sind zu Ende. Und damit die Geschichte als Geschichte des Kampfs um ein Prinzip, das im 19. Jahrhundert als kommunistische Utopie begann …
Das, und nichts anderes, ist der richtige Kern der – im buchstäblichen Wortsinn – marktschreierischen These vom »End of History«, die im Anschluß an Kojève von Fukuyama just zum Fall der Berliner Mauer 1989 ebenso plakativ wie plagiativ lanciert worden ist. Natürlich geht die Geschichte als Ereignisgeschichte weiter, das wußte auch Kojève, das weiß auch Fukuyama, und das wußte natürlich auch Arnold Gehlen, der den Terminus »Posthistoire« schon in den fünfziger Jahren geprägt hatte; was die These behauptet, ist nicht das Ende der empirischen Geschichte, sondern ihr Ende als Begriff und als Projekt; sie behauptet das Ende der Epoche der Geschichtsphilosophie und ihrer postreligiösen Trost- und Sinnstiftungsfunktionen. Die politisch gewendete Geschichtsphilosophie war ja gerade der Versuch, die reale Geschichte zu bändigen und sie einem menschlichen Sinn zu unterwerfen. Daß die Geschichte nach 1989 allerorten, nicht nur in den postkommunistischen Ländern, in turbulenter Weise sich Bahn bricht, ist kein Argument gegen den Finalismus, sondern paradoxerweise eines für ihn: Das Posthistoire ist in Wahrheit die Befreiung der Geschichte – nämlich von dem Anspruch zu wissen, wie sie zu machen sei. Sie vollzieht sich noch immer, wie schon Marx diagnostizierte, als Naturprozeß – ohne daß wir freilich seine Hoffnung noch teilten, wir könnten diesen je beherrschen, denn diese Hoffnung hat sich als totalitäre Illusion erwiesen.
Daher ist heute – und dieses Heute datiert zurück auf eben jene Epochenschwelle 1989/91 – von einer »Wiederkehr der Geschichte« die Rede. Die Phrase hat aber einen ironischen Doppelsinn. Sie verweist nämlich nicht nur auf die Turbulenzen der Realgeschichte, die fast täglich überraschende Wendungen vollzieht und von der die Medien instantan berichten, sondern vor allem auch auf Geschichte als Erzählung – und in diesem narrativen Sinn hat Geschichte heute einen Rang, der jenen noch bei weitem übertrifft, den sie im Historismus zu Nietzsches Zeiten hatte. Jean-François Lyotards Diagnose vom »Ende der Großen Erzählungen«, die er Anfang der achtziger Jahre kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion stellte und damit die kurzlebige Ideologie der »Postmoderne« einleitete, erscheint somit aus heutiger Perspektive als geradezu groteske Fehldiagnose. Freilich: In dem, worauf Lyotard seine These selbst bezog, sollte er Recht behalten. Denn zu Ende ist tatsächlich die moralisch und politisch motivierende Kraft der hegelmarxistischen Sinnstiftungserzählung, und die hatte er ja gemeint, damit aber, und das hat er nicht gesehen, kehren die vielen großen Erzählungen gerade wieder, in ihrer primitivsten Form als Erbauungsliteratur: Als schlicht kollektivierende Erzählungen der nationalen, ethnischen, ja der rassischen Identitäten; angefangen hat es mit den kulturellen Identitäten. Sie waren der ideologische Treibstoff der Bürgerkriege im zerfallenden Jugoslawien, sie sind es im Baskenland, im Kaukasus und im gesamten Nahen und Mittleren Osten, um nur einige Beispiele zu nennen. Die literarischen Typen sind immer noch (oder wieder) die gleichen wie zu Nietzsche Zeiten – sie sind monumentalisch, antiquarisch oder kritisch, wobei diese Formen oft ineinanderfließen.
Aber sie haben eine entscheidende moralische Wendung genommen. Handelte es sich im Historismus des 19. Jahrhunderts vor allem um Heldengeschichten, um Berichte von großen, triumphalen Taten, die als Beispiel und Ansporn zur Nacheiferung empfohlen wurden, so sind es heute überwiegend Opfergeschichten, die als moralische Lehrstücke herhalten müssen; wobei das Wort »Opfer« im Sinne von »victim« zu verstehen ist, nicht im Sinne von »sacrifice«. Das aber ist selbst ein historisches Novum allerersten Ranges, ein Bruch mit allen moralischen Traditionen. Denn traditionellerweise wurden jene gefeiert, die aktiv ein Opfer brachten zum Wohle eines Kollektivs und es wurde jener gedacht, die sich selbst geopfert hatten im Kampf für eine Idee, nicht jener, die passive Opfer waren – diese hatten als solche keinen moralischen Status, während jene als Helden und Märtyrer verehrt worden sind. Noch zu Nietzsches Zeiten war dies der harte Kern der monumentalischen Geschichtsschreibung, die heute in einen negativen Monumentalismus gekippt ist: in eine als Mahnung fungierende Viktimisierungsgeschichte, deren Erinnerungsgebot moralisch noch wesentlich rigoroser ist als jenes zu Zeiten des Historismus, das immerhin noch konkurrierende Geschichtsbilder zuließ. Mit diesem Liberalismus ist es heute vorbei, heute kämpfen Erinnerungskartelle um das Opfermonopol. Die jeweiligen Opfergeschichten treten dabei auf mit der Autorität des historischen Faktums unmittelbar, das durch »Erinnerung« beglaubigt sein soll, ohne hermeneutische oder interpretative Vermittlung. Nicht verstehen oder begreifen, sondern »Niemals vergessen!« lautet das Gebot dieses moralisierenden Neohistorismus. Er hat das Denken durch das Gedenken ersetzt, und das Denkmal durch das Mahnmal.