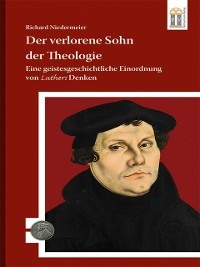Buch lesen: "Der verlorene Sohn der Theologie"
Lic. theol. Richard Niedermeier
Der verlorene Sohn
der Theologie
Eine geistesgeschichtliche Einordnung von Luthers Denken
500 Jahre Luther und Reformation, Band 3
Impressum
1. Auflage 2016
© Patrimonium-Verlag
In der Verlagsgruppe Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Erschienen in der Edition »Patrimonium Theologicum«
Patrimonium-Verlag
Abtei Mariawald
52396 Heimbach/Eifel
www.patrimonium-verlag.de
Gestaltung, Druck und Vertrieb:
Druck & Verlagshaus Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.verlag-mainz.de
Abbildungsnachweis: By Lucas Cranach the Elder -
gallerix.ru, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23260036
Print:
ISBN-10: 3-86417-061-3
ISBN-13: 978-3-86417-061-4
e-Book:
ISBN-10: 3-86417-162-8
ISBN-13: 978-3-86417-162-8
Einleitung: Luther und die
Metamorphose von Überlieferung
Luther war ein Ereignis; ein Ereignis, das allerdings nicht wie ein Feuerregen vom Himmel fiel, sondern aus einer von verschiedensten geistigen Strömungen getränkten Erde erwuchs. Diese noch zu verifizierende Feststellung könnte allerdings dazu verleiten, in Luthers Denken und Theologie eine ungebrochene Synthese dieser geistesgeschichtlichen Quellen zu vermuten, so als würden sie in ihm ihre reichste und reifste Frucht erhalten. Tatsächlich aber sehen wir ihn auch im Widerspruch zu den geistigen Erscheinungen seiner Zeit: zum Humanismus ebenso wie zum Ockhamismus, in dessen Schule er in Erfurt ging. Wir hören ihn gegen Aristoteles ebenso wie gegen die Platoniker wettern, die in der Renaissance eine neue Blüte erlebten; überhaupt fällt alles unter sein Verdikt, was den Namen Philosophie trägt. Er schreit ganz undifferenziert gegen die »Sautheologen«1 an und meint damit vorrangig Gabriel Biel, der entgegen der Missachtung, die ihm heute in Theologenkreisen entgegenschlägt, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Theologie und Spiritualität verbindend wie kein anderer Takt und Melodie des theologischen Denkens vorgab.
Luther scheint alle diese Vorgaben, alle Rahmen und wohl auch Schubladen zu sprengen, in die man ihn einordnen möchte. Woher kommt diese Sprengkraft, die ihn zu einem Anfang werden ließ, so dass sich noch heute ein nicht unerheblicher Teil des Protestantismus als »Lutheraner« bezeichnet?
Luthers Theologie war existentiell verwurzelt – eine sententia communis der heutigen Lutherforschung, auch wenn man darüber streiten mag, welche Ereignisse in seinem Leben, welche Erfahrungen dafür maßgeblich gewesen sind. So ordnet man heute Luthers Theologie einer sapientialen Gestalt des Denkens (»sapientia experimentalis«) zu und hebt sie damit von der Theologie als »scientia«, als Wissenschaft in Entsprechung zum aristotelischen Wissenschaftsbegriff ab2. Noch weiter geht der katholische Lutherforscher Th. Beer, der eine kleine Schrift »Luthers Theologie – eine Autobiographie«3 übertitelte.
In dieser autobiographischen Prägung lag eine enorme Gewalt sowohl des Ausscheidens wie des Verschmelzens und Umformens, einer Rezeption, die das Empfangene und Übernommene kühn neu zu gestalten und auf die eigenen Bedürfnisse und Absichten anzuwenden wusste. Luthers Lebenserfahrung ließ nicht zu, dass er zu einem bloßen Epigonen einer philosophischen oder theologischen Richtung wurde.
Je stärker man das Moment der Erfahrung, das Biographische betont, umso weniger scheint es auf die geistesgeschichtlichen Konnexe anzukommen, ist doch Erfahrung immer etwas Individuelles. Andererseits ist die Erfahrung bekanntlich nie nur ein bloßes Erlebnis, sondern immer schon Deutung und Interpretation, die unter leitenden Ideen steht. Erst zusammen entwickeln sie die Kraft zur Metamorphose von Überlieferung.
Wenn wir die Mechanismen der Metamorphose von Überlieferungen verstehen wollen, müssen wir kurz in das existentielle Herz von Luthers theologischem Denken vorstoßen. Dieses bildet zugleich – Luther war, wie immer man seine Theologie beurteilen mag, der Inbegriff eines homo religiosus – den Kern und Höhepunkt seines Glaubens.
D. Korsch sieht Luthers »religiöse Leitidee« in der »Herstellung der Unmittelbarkeit der Gottesbeziehung des Menschen durch Gott selbst«4. Es geht also um ein neues, Heil stiftendes Gottesverhältnis, das allein von Gott selbst gewirkt und getragen wird und keiner weiteren Vermittlung bedarf. Fassen wir Gott und Mensch als die Termini oder Glieder einer Relation, so bedeutet dies, dass das Relationsglied »Mensch« innerhalb dieses Verhältnisses in seinem Sein und Wirken permanent negiert wird. Ebenso wie nichts, was der Mensch tut, zu diesem Gottesverhältnis beitragen kann, erweist sich auch jede denkerische Interpretation dieses Verhältnisses als unzureichend. Jedes Bemühen des Menschen, Gott durch sein Denken zu erreichen, ist damit zum Scheitern verurteilt; aber auch die Theologie selbst kann sich des Wortes, das Gott an den Menschen richtet, nicht wie eines Besitzes sicher sein und darüber verfügen. Der Mensch ist, was sein neues Gottesverhältnis angeht, ein Nichts, besser: ein genichtetes Nichts, da er – sinnlos und vergeblich – immer wieder sich ins Spiel bringen will, dabei aber in seine Grenzen, und das heißt in seine grenzenlose Ohnmacht verwiesen wird. Mit Recht hat man Luthers Theologie als eine »theologia crucis«, eine Theologie des Kreuzes bezeichnet5; dies gilt nicht nur deshalb, weil der Kreuzestod Christi für Luther wie den Protestantismus überhaupt die entscheidende Heilstat Gottes ist, sondern auch, weil am Kreuz alle menschlichen Bemühungen zuschanden werden.
Wenn also alles Denken auf die Theologie, alle Theologie aber auf die Rechtfertigung (»unmittelbares Gottesverhältnis«) zielt, diese aber den Menschen seiner absoluten Ohnmacht, seiner Passivität überführt, dann verlieren alle philosophischen wie theologischen Konstrukte ihren Anspruch auf kohärente Gültigkeit. Theologische und philosophische Überlieferungen werden zu bloßen Fragmenten, die allein hinreichend sind, um die Weltwirklichkeit auszulegen. Damit ist ein Bruch mit der Theologie als Glaubenswissenschaft oder »intellectus fidei« vollzogen, der ein Weiterschreiten auf den Bahnen theologischer Überlieferung, wenn es um das Heil des Menschen geht, nicht mehr erlaubt, statt dessen den Glaubenden auf das sich selbst auslegende Wort Gottes in der Hl. Schrift (»scriptura sui interpres« und »sola scriptura«) verweist. Dennoch kann und muss man danach fragen, woher ein solcher Wechsel in der Grundkonzeption von Theologie kommt. Luther mag in seinem Leben und für sein Leben das, was ihm als theologische Existenzdeutung vorlag, als ungenügend, seine Daseinsnot gerade nicht wendend empfunden haben. Doch betrifft dies nur die materiale, inhaltliche Seite. Nicht ausgeschlossen ist damit, dass Luthers autobiographisch geprägte Theologie unter Denk-Formen steht, die historischen Modellen folgen6. Die Prägung durch Denkmodelle muss also nicht unbedingt auch eine Übernahme von bestimmten Inhalten nach sich ziehen.
Im Folgenden können wir nicht alle theologischen Themen Luthers auf ihr geistesgeschichtliches Herkommen untersuchen. Es genügt eine exemplarische Auswahl von Leitgedanken, die Luthers reformatorisches Denken prägen.
I. Luther und der Humanismus
1. Luther und das humanistische Netzwerk
Luthers Same der Reformation fiel auf den fruchtbaren Boden einer kirchlichen Reformgesinnung, die zwar nicht allein Deutschland beherrschte, dort aber weitaus stärker ausgeprägt war als in Ländern wie Frankreich und England, wo durch den Herrscherwillen die Abkehr von Rom und die Ausbildung einer Nationalkirche schon weit fortgeschritten war. Aus Italien und seinen selbstbewussten Bürgerstädten war ein neuer Geist über die Alpen gekommen, ein neues Bildungsideal, das weit über den universitären Bereich hinaus wirken sollte und das stark gewordene Bürgertum ebenso ansprach wie die nach Bildung und Schönheit hungernden Fürsten des Reichs.
Die Forderung nach Erneuerung erwuchs aus einer Rückbesinnung auf das Alte, auf die Antike. Die von dieser Bewegung – zuerst in Italien – ergriffenen Menschen wandten sich nicht nur den Kunstwerken der griechischen und römischen Epoche zu, sondern entdeckten vor allem sich selbst, den Menschen, dessen Größe, Würde und Schönheit bis ins Sinnenfällige hinein gefeiert wurde.
Was unter der milden Sonne Italiens hell und strahlend leuchtete, begegnete in den dunkleren Regionen nördlich der Alpen deutlich abgeschattet, ernster. Und doch war auch hier ein freieres Durchatmen zu spüren: Vom Südwesten ausgehend bildeten sich in den größeren Städten des ganzen Reiches Zirkel, in denen man teils neuentdeckte antike Texte begierig las und über eine Reform der Studien, eine Abkehr von der zunehmend als eng empfundenen »Scholastik« nachsann. Diese »Humanisten«, wie sie schon im 14. Jahrhundert in Italien genannt wurden, weil sie sich, angeleitet von antiken Vorbildern, bewusster und weit intensiver den »studia humaniora«, also den Disziplinen der Grammatik, der Rhetorik, der Poesie, der Moralphilosophie und selbst der Geschichte zuwandten, versuchten auszubrechen aus dem starren Korsett einer scholastischen Logik (»Dialektik«), die schon längst die genialen Entwürfe eines Thomas von Aquin weitgehend vergessen hatte. Die Sprache, die kritische Arbeit mit dem Text ebenso wie die Verfeinerung des Stils, sollte in den Mittelpunkt gestellt werden. Diese Aufwertung der Sprache verlangte zuerst nach Sprachkenntnissen: Man begann, Griechisch zu lernen, aber auch Hebräisch gewann an Bedeutung (z.B. bei Reuchlin). Das Lateinische, wie es unter den Gebildeten gesprochen und geschrieben wurde, wollte man entsprechend dem Vorbild Ciceros verbessern. Vor allem aber propagierte man eine Rückkehr zu den Texten selbst: Nicht mehr Kommentare, aus dem Zusammenhang gerissene Zitate, Auszüge und Florilegien sollten die Bildung bestimmen, sondern die zusammenhängende Lektüre textkritisch gesicherter Literaturen7, wobei man sich keineswegs nur mehr auf Philosophisches und Theologisches beschränken wollte. Texte, so war man überzeugt, durften nicht nur in ihrer logischen Struktur und als Mitteilung zeitloser Wahrheiten, sondern gerade im Gegenteil aus ihrer Entstehungszeit, aus ihren historischen Bedingtheiten heraus verstanden werden. Ein Verstehen aber setzte voraus, dass man sich von vorgefassten Meinungen bei der Interpretation löste und die »Autoritäten« auf einen viel bescheideneren Platz verwies.
Dieses Aufkommen der Philologie wie auch der Geschichtswissenschaft blieb nicht auf den universitären Bereich beschränkt8; diese Studien waren auch kein rein theoretisches Unternehmen. Man zielte nicht nur auf Wissen, sondern auf die Neugestaltung des Lebens9, weshalb man an moralphilosophischen Fragen sehr interessiert war und die neu gewonnenen Einsichten einem möglichst breiten Publikum zugute kommen lassen wollte. Die Elite suchte ihr Gegenüber im Volk, so dass man zum ersten Mal von einer Publizistik sprechen konnte. Dies hatte freilich zur Folge, dass ein vormals nur rein akademischer Streit nunmehr ein mächtiges Beben in der Gesellschaft auslösen konnte.
Der Renaissance-Humanismus war weit mehr eine Haltung als ein Inhalt. Deshalb finden wir ihn nicht nur in unterschiedlichsten Ausformungen, sondern auch als eine Kommunikationsgemeinschaft, die einen universalen Dialog anstrebt10. Es versteht sich, dass weder Luther noch die Humanisten aneinander vorbeigehen konnten.
Wer nach einer gedanklichen Verbindung zwischen beiden sucht, darf sich nicht von J. Burckhardts etwas einseitiger Fixierung der Renaissance auf das Menschenbild des »uomo universale« blenden lassen: Weder Luthers Lehre noch sein Charakter vermochten mit dem Ideal eines freien, autonomen, seines Glanzes und seiner Würde bewussten Menschen etwas anzufangen; mehr noch, ein solches Ideal steht konträr zu Luthers theologischer Anthropologie. Doch als Vertreter einer philologischen Methode wie auch als Kritiker ihrer Zeit (und damit auch der Kirche) gab es zwischen Luther und den Humanisten doch zahlreiche Berührungspunkte.
Zuerst aber haben wir zu notieren, dass Erfurt, wo Luther studierte, ein Zentrum des Humanismus in Mitteldeutschland war. Konrad Celtis, (1459–1508), der als erster Dichter von Kaiser Friedrich III. nach italienischer Manier als »poeta laureatus« gekrönt worden war, wirkte zeitweilig auch in Erfurt und gab dort dem Humanismus einen großen Auftrieb. Er hinterließ der Stadt nicht nur seine bis an die Grenzen schwärmerische Begeisterung für die Antike, sondern durch seine bohrende Kirchenkritik auch das Bild einer verkommenen Kirche.
Celtis legte in vielem den Samen, der in Nikolaus Marschalk reich aufging. Marschalk hatte in Löwen und Heidelberg studiert, dort den Humanismus gleichsam aufgesogen, um ihn nach einem juristischen und Artes-Studium ab 1491 in Erfurt, wo er Griechisch und die »Humaniora« lehrte, weiterzugeben. 1502 wechselt er nach Wittenberg, das er allerdings 1505 bereits wieder verließ, da dort sein humanistisches Bildungskonzept auf erhebliche Widerstände stieß. Marschalk zeigte sich als entschiedener Gegner scholastischer Lehrmethodik und ihrer Betonung der abstrakten Logik. Sein Reformplan entsprach durchaus dem der anderen Humanisten: Förderung des Studiums der alten Sprachen und ein Zurück zu den Quellen (»ad fontes«), zu denen nunmehr vor allem auch historische und poetische Werke gehören. Die Früchte seines Wirkens konnte Marschalk in Erfurt wie in Wittenberg noch nicht ernten; aber er hinterließ in beiden Städten eine Schülerschaft, die den Humanismus dort zur Dominanz führte und zu Luther in Beziehung stand:
Da waren der spätere evangelische Theologe und – ab 1514 – Lutherfreund Georg Spalatin (1484–1545), der später sich um den landesherrlichen Schutz für Luther bemühen wird; ferner Conradus Mutianus Rufus (1470/71–1526), der nach einem Studium in Erfurt und Aufenthalten in Italien als Privatgelehrter in Gotha wirkte. Mutianus Rufus war das, was man einen Schöngeist nennt, nicht ohne erheblichen Bildungsdünkel, der sich aber auch in eine beißende Kritik versteigen konnte. Über Mittelsmänner und durch seine Korrespondenz war er wohl lange Zeit auch mit Luther verbunden (ab 1515), wenngleich er sich später von ihm distanzierte. Zu den humanistischen Dichterfreunden Luthers zählte auch Helius Eobanus Hessus (1488–1540), der bis 1509 in Erfurt lebte und ab 1514 wiederum in Erfurt eine Professur für lateinische Sprache übernahm. Eobanus Hessus hatte den Ruf eines Dichterfürsten und stellte eine Art Bindeglied zwischen Luther und Erasmus von Rotterdam dar. Nicht minder bedeutsam für Luther waren Justus Jonas (1493–1555), der Luther nach Worms begleitete und für dessen Sache eintrat, Johannes Lang(e) und Crotus Rubeanus. Johannes Lang (1467–1548) stand ebenfalls unter dem Einfluss des Nikolaus Marschalk, wurde aber dann zum Parteigänger Luthers, den er auch zur Heidelberger Disputation begleitete. Er lernte Luther 1509 im Erfurter Augustinerkloster kennen und hielt der Reformation bis zu seinem Lebensende in Erfurt die Treue. Anders verhielt es sich mit Crotus Rubeanus, der mit Luther in Erfurt studiert hatte, in seinen jungen Jahren sich aggressiv gegen das scholastisch-klerikale Establishment wandte, Luther auf seiner Reise nach Worms empfing, sich jedoch 1531 wieder vom Luthertum abkehrte und sich in die Dienste Albrechts von Brandenburg begab. Crotus Rubeanus war 1515 der Verfasser des ersten Teils der »Dunkelmännerbriefe«, einer Schmähschrift, die sich gegen die Angreifer Reuchlins – dieser hatte sich gegen eine Verbrennung hebräischer Bücher eingesetzt – wandte und dabei das alte, kirchlich-scholastische Denken als dumm, ignorant und sprachlich primitiv persiflierte11. Von Crotus Rubeanus wissen wir auch, dass Luther während seiner Studienzeit in Erfurt als philosophischer Kopf der humanistisch orientierten Studentenschaft der Georgenburse angesehen wurde und – wie Luther auch selbst zugab – ein starkes Interesse an der Musik und der Poesie hatte.
Es gibt also keinen Zweifel, dass Luther zumindest bis zu seinem Klostereintritt Teil des Erfurter Humanistenkreises war. Dass sich diese Kontakte während des theologischen Studiums und auch im Kloster fortsetzten, ist wahrscheinlich; wollten doch die Erfurter Startheologen Truttfetter und Arnoldi von Usingen die alte Scholastik mit dem neuen humanistischen Denken verbinden. Auch ist erwiesen, dass das Augustinereremitenkloster Kontakt zu den Humanisten hielt.
Inwieweit hat dieser Humanismus Luther bereits in seinen frühen Jahren bleibend geprägt? Wir nannten das poetisch-musische Interesse; viel entscheidender aber war die radikale, auch emotional vorgetragene Kritik am »Alten«, an den überlieferten Lehr- und Denkformen, einschließlich der Kirche selbst. Die Humanisten waren nicht nur sachliche Kritiker des Bestehenden, sondern scharfe, oft gnadenlose Polemiker, die in ihrem Überlegenheitsgefühl ihre Gegner mit beißendem Spott – man vergleiche die »Dunkelmännerbriefe« – überzogen.
Auch das Programm des »Zurück zu den Quellen« hat zweifellos auf Luther gewirkt. Luther konnte und wollte sich nicht mehr mit den Sentenzen des Petrus Lombardus und ihren Kommentatoren zufrieden geben, wenn es um den Zugang zu den Kirchenvätern ging. Vor allem aber wollte er sich nicht damit begnügen, die Bibel nur in Auszügen und in der lateinischen Übersetzung der Vulgata zu lesen. Luther hatte stark von der humanistischen Bibelinterpretation und ihrer Arbeit am Text profitiert: Sie stellte altvertraute Begrifflichkeiten in Frage und ließ ihn die Kraft des biblischen Wortes neu entdecken12. Auch erhielt Luther in einer ganz entscheidenden Frage seiner Rechtfertigungstheologie durch die philologische Arbeit der Humanisten wesentliche Anstöße: Die Vulgata hatte das griechische Wort »dikaiosis« als »iustificare« im Sinne des Gerechtmachens übersetzt; die Humanisten sprachen indes von einem »als gerecht Anerkennen«. Luther wird dies aufgreifen und die Rechtfertigung nicht mehr als eine von Gott verfügte innere Veränderung des Sünders, sondern nur als dessen bloß äußere Lossprechung durch Gott interpretieren.
Mit den Humanisten kam er aber auch überein, dass die kirchliche Lehre ganz und ausschließlich von der Hl. Schrift her – »sola scriptura« – aufzubauen sei. Die formal – als Außerkraftsetzen der Tradition – wie inhaltlich als rein biblische Theologie im »sola scriptura« gegebene Rückbesinnung auf die Heilige Schrift musste auch das Verhältnis zur Kirche grundsätzlich ändern: Die Kirche und ihre Amtsträger büßten weitgehend ihre Funktion für die Heilsvermittlung ein.
Die philologische Arbeit der Humanisten schärfte aber auch Luthers historisches Bewusstsein: Dass die Konstantinische Schenkung, mit der die Päpste ihre weltliche Herrschaft über das Patrimonium Petri, also den Kirchenstaat, begründeten, eine Fälschung war, hatte der italienische Humanist Lorenzo Valla nachgewiesen. Luther sah darin ein Indiz für die Weltverfallenheit und innere Verderbtheit des Papsttums, das er deshalb umso leichter als Gegenwart des Antichristen diffamieren konnte.
Schließlich finden wir bei ihm wie im Humanismus auch einen pädagogischen Impetus, der das Volk, die Fürsten ebenso wie die einfachen Bürger, unterrichten will. Die Übersetzung der Heiligen Schrift in ein für alle verstehbares Deutsch ging daraus hervor.
Alles in allem waren, wie Hegel zurecht urteilen wird13, die Humanisten – nicht nur in Deutschland – mehrheitlich nicht unbedingt große philosophische Geister, deren Sache es gewesen wäre, etwas bis in seine letzten Konsequenzen hinein zu durchdenken oder geniale philosophische Systeme zu entwickeln. Sie waren eher Essayisten, die aus der Wiederentdeckung des Alten heraus Anstöße gaben.
Ihren im ursprünglichen Sinne »Horizont« bildete das eigene Leben, die eigene Erfahrung14. Vielleicht hat Luther diesbezüglich am meisten von den Humanisten gewonnen: Das Unsystematische15 seines Denkens konnte er hier gerechtfertigt finden; vor allem aber war es ihm möglich, auf diesem Hintergrund eine Theologie aus seiner ganz persönlichen Erfahrung, aus seiner Biographie heraus zu entwickeln, deren Unverbindlichkeit, ja selbst innere Widersprüchlichkeit unter seinem humanistischen Hörerkreis keinen Widerspruch erregte.
Zweifellos bestand also eine große sachliche wie persönliche Nähe zwischen Luther und den Humanisten in und um Erfurt; eine Nähe, die vor allem durch die Person Melanchthons bleibend gegeben war.
Die knappe Aufzählung des Erfurter Humanisten-Kreises hat auch deutlich gemacht, dass die Reformation aus dem personellen Reservoir des Humanismus geschöpft hat. Dennoch darf die Beziehung zwischen Humanisten und Reformatoren nicht über Gebühr harmonisiert werden:
Crotus Rubeanus steht nur für eine vorübergehende Annäherung von Humanismus und Reformation. Ulrich von Hutten, der humanistische Nationalist, der mit seiner maßlosen Polemik Luther in seiner antipäpstlichen Haltung beisprang, in den späteren Jahren aber die von Luther scharf missbilligte Bauernrevolte unterstützte, zeigt eine andere Richtung an, in die die divergierenden Kräfte gingen. Noch stärker ins Gewicht fielen grundlegende Unterschiede: Da war, wie schon angedeutet, vor allem der Individualismus, der zwar ganz im Sinne Luthers die Eigenständigkeit gegenüber der Kirche mitumfasste, jedoch auch das Vertrauen auf die menschliche Kraft, die Gewissheit der unvergleichlichen menschlichen Würde bei sich trug. Luther mochte weder dieser Selbstherrlichkeit noch der allgemeinen Schöngeisterei einen Platz einräumen. Auch teilte er nicht die Glorifizierung der antiken Philosophie, weder in ihrer platonisch-neuplatonischen noch in ihrer aristotelischen Ausprägung. Der Streit zwischen Platonikern und Aristotelikern innerhalb der Renaissance-Philosophen konnte Luther allerdings nur recht sein; lieferte er ihm doch gerade in der Anfangszeit der Reformation nützliche Munition für seine eigenen Angriffe auf die aristotelische Philosophie.
2. Luther und Erasmus von Rotterdam
Symptomatisch für diese sehr schwierige Beziehung Luthers zum Humanismus war sein Verhältnis zu Erasmus von Rotterdam. Es war eine nur durch Briefe und Mittelsmänner aufrecht erhaltene Fernbeziehung, die Luther und Erasmus vor allem ab dem Jahr 1518 verband. Im Netzwerk der Erfurter Humanisten mochte Luther aber bereits früher auf Erasmus, dessen Ruhm in ganz Deutschland strahlte, aufmerksam geworden sein16; besonders auf sein »Enchiridion militis Christiani« (1503), das den bloßen Vollzug von Riten, wie Erasmus ihn vor allem im Judentum gegeben sieht, von der wahren Religion abgrenzt, die in seinen Augen wesentlich in einer innerlichen Frömmigkeit besteht. Erasmus lehnte darum auch die Reliquienverehrung, das Fasten, überbordende liturgische Zeremonien oder das Pilgerwesen ebenso ab wie alles, was in die Richtung von abergläubischen Praktiken ging. Auch die Wirksamkeit der Sakramente macht Erasmus ganz von der inneren Gläubigkeit abhängig. Schon das »Enchiridion« zeigt die Frontlinie zur Scholastik: Wenngleich es ausdrücklich die Scotisten nennt, die – so wird es dargestellt – nie die Bibel selbst, sondern immer nur Kommentare dazu lesen würden, so trifft dieser Vorwurf die Scholastik doch im Ganzen.
Eine »philosophia Christi« soll nach Erasmus die Scholastik ersetzen. Diese neue Philosophie dürfe nicht mehr mit »verworrenen Worten« über »Instanzen«, »Relationen«, »Quidditäten« und »Formalitäten« disputieren, sondern habe sich an das zu halten, was Christus selbst gelehrt und gezeigt habe17. Dazu, so Erasmus weiter, sei es notwendig, die Hl. Schrift selbst zu studieren, ein Studium, für das er keineswegs nur eine intellektuelle Anstrengung einfordert, sondern auch einen betenden Umgang mit dem Text – eine, wie wir im Anschluss an ein Wort von Hans Urs von Balthasar sagen würden, »knieende Theologie«. Das bedeutete nichts anderes als die Aufhebung der Philosophie selbst, deren Grenze zur Theologie nicht mehr auszumachen ist. Auch für Erasmus ist unzweifelhaft, dass eine solche Philosophie/Theologie ganz dem menschlichen Leben und seinem Glück zu diesen habe. Auch hier also die Ausrichtung auf das eigene Leben in seiner Ganzheit, auf die eigene Erfahrung.
Auch bei Luther können wir nicht mehr von einer klar identifizierbaren philosophischen Basis sprechen, sondern bestenfalls von philosophischen Fragmenten. Damit entzog auch Luther seine Theologie einer philosophischen Verantwortung und gab sie trotz ihrer christologischen Ausrichtung einer Instrumentalisierung durch das menschliche Glücksverlangen preis.
Es ist durchaus ein sehr frommes Programm, das Erasmus hier vorlegt18. Diese im Sinne einer sapientialen Theologie ausgeformte Christozentrik war verbunden mit einem enormen Freiheitspathos, das sich in Luthers Frühschrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen« – allerdings, wie wir noch sehen werden, in einer grundsätzlich veränderten Weise – wiederfinden wird.
Freiheit war für Erasmus aber nicht nur Gegenstand bloßer Theorie; er nahm sie sich auch: Erasmus war selbst zum Maßstab geworden; er war Sonne und nicht Planet. Er hatte sich zwar nie von der Kirche getrennt, so manches seiner Werke auch brav dem Papst gewidmet, doch war er in seinem Verhältnis zu kirchlichen Autoritäten von einer nahezu provozierenden Unbekümmertheit, die nur so verstanden werden konnte, dass Erasmus – wie später auch Luther – eine Laienkirche favorisierte19. Die ersten Anfänge einer solchen Laienkirche liegen also, wie bei Erasmus und Luther zu erkennen ist, gar nicht einmal in einer tiefen Reflexion über den Status des Laien in der Kirche und über sein Verhältnis zum geistlichen Amtsträger, sondern in einem übersteigerten Selbstbewusstsein, das gleichsam die Bahn bricht für ein Denken, welches nicht mehr an den Charismen der Ämter orientiert ist20.
Selbst in der Frage des Ablasses stehen sich Erasmus und Luther nahe; sandte Erasmus doch am 5.3.1518 seine eigenen gegen den Ablass gerichteten Thesen an Thomas More.
So verwundert es auch nicht, dass bereits in der Reformationszeit Erasmus für den Vorläufer Luthers gehalten wurde21. In einem Brief vom 30.5.1519 teilt Erasmus Luther mit, er werde gar für einen Parteigänger Luthers gehalten. Auch Luther selbst hatte versucht, eine besondere Nähe zu Erasmus herzustellen: In einem Schreiben vom 28.3.1519 an Erasmus nennt er sich mit gesuchter Bescheidenheit einen »fraterculus in Christo«, also einen kleinen Bruder. Und er weiß auch, wie er das Interesse des Humanistenfürsten gewinnen kann: Er spricht dessen Lieblingsthema Bildung an und stellt sich als deren Vorkämpfer vor, dessen eigenes Konzept in allem mit Erasmus‘ Enchiridion übereinstimme22.
Am meisten profitierte Luther wohl von der »Novum Instrumentum« genannten griechisch-lateinischen Ausgabe des Neuen Testamentes, die Erasmus im Februar 1516 fertiggestellt hatte23. Luther benutzte die zweite Auflage ab dem Jahre 1519, um daraus eine deutsche Übersetzung zu erstellen. Nicht minder wichtig waren für ihn die erläuternden Kommentare (»Annotationes«), die Erasmus den biblischen Texten beigegeben hatte. Diese »Annotationes« trugen einer doppelten Tatsache Rechnung: Zum einen war nach Ansicht des Erasmus die Bibel grundsätzlich verstehbar und in sich klar – Luther wird ihm hierin folgen und von der Hl. Schrift sagen, sie sei »sui ipsius interpres«, sie lege sich also selbst aus24 und bedürfe daher nicht der Interpretation durch das kirchliche Amt – ; zum anderen aber ist Erasmus davon überzeugt, dass nicht jede Stelle der Bibel die gleiche Durchsichtigkeit besitzt, so dass es der exegetischen Arbeit bedarf, um den rechten Sinn zu finden. Erasmus hat also, anders als Luther, sich eine Bibelgelehrsamkeit vorgestellt, die im übrigen auch die exegetische Tradition als nützliche Hilfe und zur Abkürzung umfangreicher Studien zu ihrem Recht kommen lässt.
Damit betreten wir aber schon das Feld der Differenzen, die zwischen Erasmus und Luther bereits von einem sehr frühen Zeitpunkt an bestanden. Erste Spuren finden wir wiederum in den Briefen. Am 17.10.1518 gibt Erasmus gegenüber dem Luther-Freund Johann Lang zwar zu, dass die Ansichten Luthers in seinem Humanisten-Zirkel ein allgemeines Gefallen gefunden hätten, nimmt davon aber Aussagen Luthers über das Fegefeuer aus. Vor allem aber mahnt er, Luther solle direkte Angriffe gegen das Papsttum den Fürsten überlassen. Offensichtlich passte Luther nicht so ganz in das Idealbild, das sich Erasmus von der jungen Elite Deutschlands machte, die er noch im selben Monat in einem Schreiben an die Erfurter Humanisten als eine Hoffnung für ein Aufblühen der Wissenschaften so gelobt hatte. Vor allem die in Deutschland eskalierenden Auseinandersetzungen um Luther wurden Erasmus zunehmend unangenehmer, wobei es zwar auch, aber nicht ausschließlich die Angst war, in diesen Streit miteinbezogen zu werden und als vermeintlicher »Lutheraner« einer ungewissen Zukunft entgegenzugehen. Der schon erwähnte Brief vom 30.5.1519 rät Luther bescheidenen Anstand, statt ein »stürmerisches« Auftreten; er solle nicht das Papsttum angreifen, sondern den Missbrauch päpstlicher Gewalt anprangern. Vor allem, dass er in diesem Brief den wahren Geist Christi beschwört, der nicht parteiisch oder anmaßend zu reden und zu handeln erlaube, macht doch deutlich, dass es nicht bloße Angst ist, die Erasmus zu diesem versteckten Tadel greifen lässt. Er scheint wohl sich der ganz unterschiedlichen Persönlichkeit Luthers bewusst geworden zu sein. Das trieb ihn zu einer Distanzierung bereits zu einer Zeit, wo er Luther noch gegen seine Widersacher verteidigte. Bezeichnend ist ein Brief des Humanisten an Albrecht von Brandenburg vom 19.10.1519. Hierin erklärt Erasmus. er habe Luthers Werke noch gar nicht gelesen und kenne auch seinen Verfasser nicht (»er ist mir vollkommen unbekannt«)25. Als Luther die Bannandrohungsbulle verbrennt (Dezember 1520), erkennt Erasmus, der bis zuletzt den Kirchenbann gegen Luther verhindern wollte, dass das Band mit Rom endgültig zerschnitten ist; er musste einsehen, dass ein Spagat zwischen Luther und der Kirche auch für ihn persönlich nicht mehr möglich war. Zur gleichen Zeit wuchs aber auch die Einsicht des Humanisten, dass Luther ganz andere Ziele verfolge als er selbst. Heute wird oft suggeriert, die Spaltung der Kirche durch Luther sei ein historischer Unfall gewesen und von Luther gar nicht beabsichtigt. Eine solche These stellt dann auch, wenn sie überhaupt noch von Schuld spricht, eine Mitschuld der Kirche fest26. Erasmus hat zweifellos die Missstände in der Kirche gesehen und sie heftig kritisiert; aber er wäre wohl nie so weit gegangen, deshalb schon der Kirche eine Mitschuld an der Spaltung zuzuschreiben. Sein Brief vom Februar 1521 an Nikolaas Everaerts, der das Amt des Präsidenten des Rats von Holland bekleidete, beklagt, dass Luther jeden Tag »etwas Schrecklicheres« hervorbringe und sich möglicherweise den Hussiten annähere27. Dieses »Schrecklichere« war die gezielte Spaltung der Kirche, die Erasmus besonders auch in der Sakramentenlehre Luthers am Werk sah.