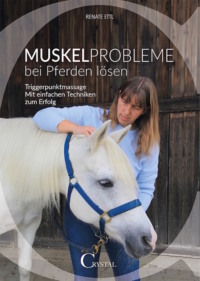Buch lesen: "Muskelprobleme bei Pferden lösen"
ÜBER DIE AUTORIN

Renate Ettl ist ausgebildete Pferdeosteopathin, Pferdephysiotherapeutin, Pferdesporttherapeutin und verbandsgeprüfte Tierheilpraktikerin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Tieren auf dem Reiterhof Silver Horse Ranch in Bayern. Die begeisterte Buchautorin- und Pferdefotografin betreibt eine Schule mit den Ausbildungsschwerpunkten Manuelle Pferdetherapie (Osteopathie), Pferdeheilpraktiker und Pferdegesundheitstrainer.
Haftungsausschluss
Autorin und Verlag haben den Inhalt dieses Buches mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Für eventuelle Schäden an Mensch und Tier, die als Folge von Handlungen und/oder gefassten Beschlüssen aufgrund der gegebenen Informationen entstehen, kann dennoch keine Haftung übernommen werden.
Copyright © 2016 by Crystal Verlag, Wentorf
Gestaltung und Satz: Crystal Verlag, Wentorf
Titelfoto: Peter Ettl
Lektorat: Martina Kiss
Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Abdruck oder Speicherung in elektronischen Medien nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Verlag.
ISBN: 978-3-95847-008-8
RENATE ETTL
MUSKELPROBLEME
bei Pferden lösen
Triggerpunktmassage
Mit einfachen Techniken
zum Erfolg
INHALT
VORWORT

Gesunde, athletische und leistungsfähige Pferde – welcher Pferdebesitzer wünscht sich das nicht? Die Realität jedoch sieht oft anders aus: Obwohl die meisten Pferde regelmäßig unter dem Sattel trainiert werden, sehen sie nicht wie Athleten aus. Die Muskulatur ist zu schwach oder unregelmäßig ausgeprägt, die Bewegungen unkoordiniert und der Arbeitswille des Vierbeiners lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Mit Sporen und Gerte wird schließlich versucht, das Pferd zu mehr Leistungsbereitschaft zu motivieren. Oft genug bleibt es bei diesem Versuch.
Die Ursachenfindung erstickt im Keim, die Begründung der Misere lautet schließlich: „Der ist halt ein wenig faul.“ Im Prinzip gibt es jedoch keine faulen Pferde, dies würde dem Naturell der Fluchttiere widersprechen. Wollen sich die Vierbeiner nicht gern bewegen, steckt meist weder Unwille noch Faulheit dahinter. Vielmehr können die Pferde die geforderte Leistung nicht abrufen. Die Ursachen sind vielfältig, dennoch ist es offenkundig, dass muskuläre und artikuläre Einschränkungen häufig der Grund für vermindertes Bewegungsverhalten sind. Hier hilft zunächst ein guter Osteopath oder Physiotherapeut weiter.

Die Behandlung der Muskulatur ist bei seriösen Pferdetherapeuten ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit, da mehr als 80 Prozent der Probleme im Bewegungsapparat einen muskulären Hintergrund haben.
Seriöse Pferdetherapeuten untersuchen und behandeln sowohl die Weichgewebe als auch die Gelenke des Pferdes. Dabei haben erfahrungsgemäß mehr als 80 Prozent der gefundenen Blockierungen einen muskulären Hintergrund. Die Behandlung der Muskulatur des Pferdes hat deshalb oberste Priorität.
Der Therapeut kennt verschiedene Wege, eine verspannte Muskulatur zu behandeln. Neben der klassischen Massage gibt es ein spezielles System, das einfach, aber höchst effizient ist, sodass auch jeder Pferdebesitzer es anwenden kann. In der Humanmedizin ist es als Triggerpunkttherapie bekannt und mit weiteren Synonymen belegt wie Stresspunktmassage oder Osteopraktik. Die Triggerpunkttherapie lässt sich auch auf Pferde übertragen. Im Laufe meiner langjährigen Tätigkeit als Pferdeosteopathin und -chiropraktikerin habe ich ein spezielles Triggerpunkt-Behandlungssystem für Pferde entwickelt, das auf die Anwendung durch den Pferdebesitzer zugeschnitten ist. Mit etwas Einfühlungsvermögen bedarf es somit keinen großen Aufwand, die Methode zu erlernen und richtig anzuwenden.
Das Triggerpunkt-Behandlungssystem beinhaltet mehrere Behandlungsstufen, die für eine umfassende und vor allem nachhaltige Therapie von entscheidender Bedeutung sind. Diese Behandlungsstufen sind so aufbereitet, dass sie von jedem Pferdebesitzer, der in der Regel keine medizinische Vorbildung hat, angewendet werden können, ohne seinem Pferd zu schaden, wenn er die angegebenen Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen beachtet. Damit wird das System für jeden nachvollziehbar und der Pferdebesitzer kann seinem Pferd ohne großen Aufwand helfen, Muskelverspannungen loszuwerden, Schmerzen zu lindern und den Bewegungsumfang zu verbessern.
Renate Ettl
1
ANATOMISCHES BASISWISSEN

1.1 Die Muskulatur des Pferdes
Bevor man die Muskeln des Pferdes behandeln kann, ist ein gewisses Grundwissen hierüber notwendig. Das theoretische Wissen um die Muskeln und Muskelfunktionen des Pferdes erleichtert dem Pferdebesitzer, sich in das Pferd und speziell in die muskulären Strukturen hineinzufühlen. Die Entwicklung des Gefühls ist die wichtigste Voraussetzung, um mit lebendem Gewebe arbeiten zu können. Die Muskulatur des Pferdes ist nicht direkt zu ertasten, immer liegen verschiedene andere Schichten zwischen der menschlichen Hand und dem Muskel des Pferdes. Der Pferdebesitzer muss deshalb lernen, durch diese Strukturen wie Fell, Haut, Unterhautfettgewebe, Faszien und Blutgefäße hindurchzufühlen. Dies erfordert zunächst einen „Imageplan“, eine Vorstellung von den jeweiligen Strukturen, die ihm auf dem Weg zum Muskel begegnen. Ein Blick in den einen oder anderen Anatomieatlas über Pferde kann daher nicht schaden. Eine bildliche Vorstellung der einzelnen Strukturen und ganz besonders der Muskulatur selbst erleichtert die Arbeit mit dem Gewebe – sie macht sie erst wirklich möglich.
MERKE
Die Entwicklung des Gefühls und die mentale Vorstellung der Strukturen sind die wichtigsten Voraussetzungen, um mit dem Gewebe arbeiten zu können.
Wie bereits eingangs erwähnt, ist eine Bewegungseinschränkung zu mindestens 80 Prozent muskulär bedingt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Behandlung der Muskulatur die meisten körperlichen Probleme des Pferdes lösen kann.
Bei vielen Erkrankungen reagiert die Muskulatur mit. Sie erhöht den Tonus, um mithilfe einer Schonhaltung Schmerzen oder Unwohlsein zu minimieren. Verletzungen und körperliche Gebrechen hängen in der Regel mit Schmerzen zusammen. In der Folge davon spannt sich die Muskulatur an. Der Körper versucht mithilfe der dadurch eingenommenen Schonhaltung, die Schmerzen zu kompensieren.
Selbst nach längst überstandener Verletzung oder Erkrankung bleibt in vielen Fällen der erhöhte Muskeltonus weiter bestehen. Die Ursachen von muskulären Verspannungen und Bewegungseinschränkungen können deshalb nicht immer ergründet werden. Es kommt sogar vor, dass der Grund in einer psychischen Komponente zu suchen ist. In der Regel sind Stressfaktoren der Auslöser für Muskelverspannungen. Nicht selten gründet die Ursache in einer ungünstigen Haltungsform.

Die Ursachen für Muskelprobleme sind vielfältig und liegen nicht selten auch in einer ungünstigen Haltungsform.

Trainingsstress ist ein häufiger Faktor, der muskuläre Probleme auslöst. Der Stress kann dabei sowohl körperlicher als auch mentaler Natur sein.
So ist die dauerhafte Boxenhaltung ein typischer Stressfaktor, da sie keinen ausreichenden Sozialkontakt zu Artgenossen gewährt, die Bewegungsmöglichkeiten zu sehr einschränkt und Langeweile hervorruft. Aber auch die Auslauf-/Offenstallhaltung kann ein nicht unerheblicher Stressfaktor sein, wenn die Herdenzusammenstellung unpassend ist und damit ein Pferd ständig verbissen oder vertrieben wird. Das rang-niedrige Tier kommt nicht zur Ruhe, fühlt sich allein und damit unsicher, weil ihm der Schutz der Herde fehlt.
Es gibt aber noch unzählige weitere Stressfaktoren, die dazu führen, dass Pferde einen erhöhten Muskeltonus haben, so beispielsweise der Fütterungs- und Trainingsstress. Dabei muss das Pferd beim Reiten nicht zwingend geschunden werden, um einen Trainingsstress zu verursachen, es reichen allein Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Reiter und Pferd oder ein unpassender Sattel, der auf die Muskulatur drückt.
Man kann davon ausgehen, dass jegliches Unwohlsein – physisch oder psychisch – eine negative Auswirkung auf die Muskulatur des Pferdes hat. Somit sind die meisten Muskelprobleme beim Pferd stets sekundärer Natur. Nur selten sind primäre Ursachen der Auslöser von Muskelschmerzen und -verspannungen. Darunter fallen beispielsweise Verletzungen wie Muskelrisse, -zerrungen oder Hämatome.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Muskulatur mitbetroffen ist, wenn das Pferd gesundheitliche Probleme plagen. Schließlich nimmt die Muskulatur mehr als 40 Prozent der Körpermasse des Pferdes ein. Sie bildet die äußere Form des Pferdes und stellt damit ein wichtiges Beurteilungskriterium des Exterieurs dar. Das Pferd besitzt in etwa 250 paarig angelegte und einige unpaarige Muskeln. Es versteht sich von selbst, dass die Muskeln auf der rechten Seite auch auf der linken Körperhälfte des Pferdes vorhanden sind. Die unpaarigen Muskeln sind somit logischerweise in der Körpermitte, im Bereich der sogenannten Medianlinie, die das Pferd längs durchschnitten in zwei Hälften teilt, angeordnet.
Bemerkenswert ist, dass das Pferd unter allen Haustieren die sehnigste Muskulatur aufweist. Unterhalb des Vorderfußwurzel- beziehungsweise Sprunggelenks besitzt das Pferd keine Muskeln, sondern nur noch Sehnen. Die Muskeln des Pferdes gehen sehr früh in sehnige Strukturen über, so ist das Pferd mit teils sehr langen Sehnensträngen ausgestattet. Die tiefe Beugesehne ist beispielsweise eine sehr lange Sehne, die an der Vorhand von der Karpalgelenksbeuge bis zum Hufbein zieht.
Aufgrund der stark sehnigen Struktur ist das Pferd sehr leistungsfähig, da Sehnen – im Gegensatz zur Muskulatur – nicht ermüden können. Dennoch hat diese Konstruktion der Natur auch Nachteile. Verletzungen von wenig durchbluteten Sehnen benötigen eine deutlich längere Heilungszeit als Muskeln. Während man bei den Muskeln einen Mittelwert von etwa sechs Wochen annimmt, sind Sehnen erst nach sechs bis zwölf Monaten ausgeheilt. Die Verletzungsdauer richtet sich selbstverständlich nicht nur nach der Struktur, sondern insbesondere auch nach der Art und Schwere der Verletzung.
1.1.1 Aufbau des Muskels
Je nach Gewebeart zeigt die Muskulatur eine unterschiedliche Struktur. Im Körper des Pferdes befinden sich drei verschiedene Muskelgewebearten. Grundsätzlich unterscheidet man quer gestreiftes und glattes Muskelgewebe. Die dritte Variante ist eine Mischung aus beiden Formen.
Die glatte Muskulatur findet man als Ummantelung von Hohlorganen wie Magen, Darm, Blase oder Blutgefäße. Sie ist nicht willkürlich steuerbar, sondern unterliegt einem autonomen, langsamen Rhythmus, der vom vegetativen Nervensystem gesteuert wird. Die glatte Muskulatur weist eine gewisse Plastizität auf, das bedeutet, dass sich diese Form des Muskelgewebes auf eine bestimmte Dehnung über einen längeren Zeitraum einstellen kann, ohne zu erschlaffen. Die glatte Muskelzelle hat eine Länge von etwa 0,1 mm. Unter dem Mikroskop findet man weniger Aktin- und Myosinfilamente als in der quer gestreiften Muskulatur, wodurch eine Querstreifung nicht ersichtlich wird.

Jede Muskelfaser, aber auch der gesamte Muskel ist mit einer Bindegewebshülle, der sogenannten Faszie, umgeben. Die Faszien können bei Verspannungen der Muskulatur verkleben, was Schmerzen und Bewegungseinschränkungen zur Folge hat.
Quer gestreifte Muskelfasern findet man hingegen in der Skelettmuskulatur. Sie sind das Muskelgewebe, mit dem man bei der Triggerpunkttherapie arbeitet. Dieses Muskelgewebe ist über das Nervensystem willkürlich steuerbar, der Impuls für die Kontraktion einer Muskelfaser geht somit vom Gehirn (Großhirnrinde) aus.
Der Muskel an sich ist mit einer Bindegewebsschicht, der sogenannten Faszie, umgeben und besteht aus mehreren Muskelfaserbündeln. Die Muskelfaserbündel werden ebenfalls von einer faszialen Haut umschlossen. Weiter unterteilen sich die Faserbündel in einzelne Muskelzellen. Die Muskelzellen der quer gestreiften Muskulatur werden auch Muskelfasern genannt und können mehrere Zentimeter lang sein. Die Skelettmuskelzellen sind von einem Sarkolemm (Membran der Muskelzelle) umgeben und beinhalten feine Eiweißfasern, die man Myofibrillen nennt. Diese sind für die Kontraktion des Muskels zuständig, wobei sich diese Eiweißmoleküle, die auch die Bezeichnung Aktin- und Myosinfilamente führen, ineinanderschieben. Die Anordnung der Aktin- und Myosinfilamente zeigt unter dem Mikroskop betrachtet eine Querstreifung auf, weshalb die Skelettmuskulatur auch quer gestreifte Muskulatur genannt wird.
In jedem Muskelbauch befinden sich außerdem spezielle Muskelfasern, die nur wenige Millimeter lang sind. Man bezeichnet sie als Muskelspindeln. Sie dienen in erster Linie als Dehnungsrezeptoren und stellen den Muskeltonus ein. Sie haben zudem die Aufgabe, die Länge und somit den Dehnungszustand der jeweiligen Muskelfaser zu registrieren und diese an das Gehirn zu übermitteln. Muskelspindeln sind nur in der Skelettmuskulatur vorhanden.
Am Übergang zwischen Muskel und Sehne befindet sich das Golgi-Sehnenorgan, das den Spannungszustand eines Muskels misst und über Nervenfasern an das Gehirn weiterleitet.
Die dritte Muskelgewebeart ist eine Mischung aus der quer gestreiften Muskulatur und der glatten Gewebeform. Es handelt sich um die Herzmuskulatur, die einerseits wie die Skelettmuskulatur eine Querstreifung aufweist, andererseits aber – wie die glatte Muskulatur – nicht willkürlich steuerbar ist. Die Herzmuskulatur nimmt somit eine Sonderstellung ein.
MERKE
Es gibt drei verschiedene Varianten von Muskelgeweben:
• Glatte Muskulatur (Hohlorgane, unwillkürlich steuerbar)
• Quer gestreifte Muskulatur (Skelettmuskulatur, willkürlich steuerbar)
• Herzmuskulatur (quer gestreift, aber unwillkürlich steuerbar)
Da für die Triggerpunkttherapie nur die Skelettmuskulatur von Belang ist, ist auch immer diese gemeint, wenn nachfolgend von der Muskulatur oder dem Muskel die Rede ist.
Der Muskel geht stets in ein Sehnengewebe über, womit er schließlich am Knochen befestigt ist. Die körpernahe Befestigungsstelle wird Ursprung, die körperferne Anhaftungsstelle Ansatz oder Insertion genannt. Zwar setzen die Muskeln über die Sehnen in erster Linie am Knochen an, dennoch können diese auch in Bänder oder Fasziengewebe einstrahlen.
Sehnen bestehen aus kollagenen Bindegewebsfasern, die sehr straff und fest sind. Diese Fasern sind zu einem Faserbündel zusammengefasst und ergeben den Sehnenstrang, der von Bindegewebe umhüllt wird. Die Dehnungskapazität von Muskeln und Sehnen ist höchst unterschiedlich. Eine Sehne hat eine Dehnungskapazität von nur etwa vier Prozent. Höhere Zugbelastungen führen bereits zu Überdehnungen und ab einer Dehnung von acht Prozent kommt es zu Zerreißungen der Sehnenfasern.

Überbelastungen der Sehne kommen zustande, wenn kurzzeitig zu hohe Zugbelastungen auf die Struktur einwirken, wie beispielsweise bei der Landung nach dem Sprung.
MERKE
Sehnen besitzen eine Dehnkapazität von etwa vier Prozent. Stärkere Zugbelastungen führen zu Verletzungen wie Überdehnungen oder Zerreißungen.
Aufgrund der geringen Dehnkapazität sind Sehnen stark verletzungsgefährdet. Insbesondere ist die Insertionszone – der Übergang des Sehnengewebes zum Knochen – von Verletzungen betroffen. Der Grund ist die große Belastung dieser Region, weil hier ein Ausgleich der Strukturen zwischen Sehne und Knochen geschaffen werden muss, deren Elastizität jedoch höchst unterschiedlich ausfallen. Da diese Kompensation nicht immer gelingt, ist die Ansatzstelle der Sehne einer hohen Beanspruchung ausgesetzt, wodurch es leichter zu Verletzungen kommen kann. So treten bei Pferden relativ häufig sogenannte Insertionstendopathien auf.
Diese und weitere Sehnenverletzungen entstehen insbesondere durch zu hohe und zu schnell einwirkende Zugbelastungen auf die Sehne, beispielsweise beim Auffußen nach dem Sprung. Eine Überbelastung kommt leichter zustande, wenn der Muskel-Sehnen-Bereich nicht genügend aufgewärmt ist. Fachgerechtes Aufwärmen steigert die Dehnungskapazität der myofaszialen Strukturen und schützt somit vor Verletzungen.
Sehnen sind deutlich weniger durchblutet als Muskeln, somit ist der Stoffwechsel im Sehnengewebe herabgesetzt, was zu erheblich längeren Heilungszeiten nach Verletzungen führt. Während Muskelgewebe relativ schnell regeneriert und – je nach Verletzungsgrad – mit nur einigen Wochen Heilungszeit gerechnet werden muss, müssen bei Sehnenschäden mehrere Monate bis über ein Jahr veranschlagt werden, bis eine Verletzung ausgeheilt ist.

Weiße Muskelfasern arbeiten im anaeroben Bereich und stellen kurzzeitig eine hohe Muskelkraft bereit, wie es beim Spin des Westernpferdes notwendig ist.
1.1.2 Verschiedene Muskelfasern
Es werden zwei Haupttypen von Muskelfasern unterschieden. So bietet die Skelettmuskulatur zum einen sogenannte weiße Muskelfasern, die auch helle (blasse), Fast-twitch-, F- oder Typ-2-Fasern genannt werden, zum anderen rote Muskelfasern mit den synonymen Bezeichnungen dunkle, Slow-twitch-, S- oder Typ-1-Fasern.
Das Verhältnis von roten und weißen Muskelfasern ist zum einen genetisch bedingt und rasseabhängig, zum anderen ist die Faserverteilung durch Training bis zu einem gewissen Grad auch veränderbar. So bestimmt unter anderem die Funktion des jeweiligen Muskels die Verteilung von roten und weißen Muskelfasern. Haltemuskeln sind mit einem höheren Anteil von Typ-1-Fasern ausgestattet, Bewegungsmuskeln hingegen beinhalten mehr Typ-2-Fasern. Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Eigenschaften zwischen den roten und weißen Muskelfasern.
Insbesondere ist die Kontraktionsgeschwindigkeit ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Weiße Muskelfasern kontrahieren signifikant schneller als rote und arbeiten im anaeroben Bereich. Slow-twitch-Fasern hingegen benötigen Sauerstoff für ihre Muskelarbeit, funktionieren also vor allem im aeroben Bereich und werden deshalb auch oxidative Fasern genannt. Weil die weißen Muskelfasern im anaeroben Bereich arbeiten, können sie schnelle Muskelkraft bereitstellen, was bei sportlichen Leistungen wie Sprüngen, kurzen Sprints und schnellen Manövern mit hohem Kraftaufwand erforderlich ist. Die langsam zuckenden roten Muskelfasern benötigen mehr Sauerstoffkapazität und eignen sich deshalb nicht für hohe Kraftanstrengungen, sondern vielmehr für Ausdauerleistungen. Die Arbeit kann dafür über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden, jedoch ist die Intensität von Schnelligkeit und Kraft deutlich geringer. Weiße Muskelfasern hingegen ermüden frühzeitig, sie können hohe Kraftleistungen deshalb nur kurzzeitig erbringen.
Die langsam zuckenden roten Muskelfasern sind auf Ausdauerleistungen ausgelegt, wie sie insbesondere das Gelände- und Wanderreitpferd benötigt.

Die langsam zuckenden roten Muskelfasern sind auf Ausdauerleistungen ausgelegt, wie sie insbesondere das Gelände- und Wanderreitpferd benötigt.
Daraus folgt, dass weiße Muskelfasern für Aufgaben geeignet sind, die Schnellkraft erfordern. Rote Muskelfasern bieten sich vielmehr für Ausdauerleistungen an, weil sie eine mäßige Kraft über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten können. Daraus lässt sich ableiten, dass Kurzstreckenrennpferde (Sprinter) im Verhältnis mehr weiße Muskelfasern benötigen. Das Distanz- und Wanderreitpferd hingegen ist mit einer höheren Anzahl von roten Muskelfasern besser bedient.
Die rote Färbung der Muskelfaser ergibt sich über eine höhere Myoglobinkonzentration, wodurch mehr Sauerstoff bereitgestellt werden kann. Die myoglobinarme (weiße) Muskelfaser erscheint im Gegensatz dazu aufgrund der geringeren Konzentration des Muskelfarbstoffs heller.