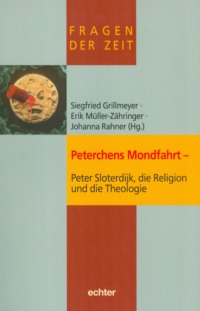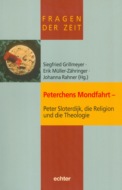Buch lesen: "Peterchens Mondfahrt - Peter Sloterdijk, die Religion und die Theologie"
Peterchens Mondfahrt –
Peter Sloterdijk,
die Religion und die Theologie
Siegfried Grillmeyer ·
Erik Müller-Zähringer ·
Johanna Rahner (Hg.)
Peterchens Mondfahrt –
Peter Sloterdijk,
die Religion und die Theologie
Band 12 der Reihe
Veröffentlichungen der Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
1. Auflage 2015
© 2015 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter-verlag.de Gestaltung: Hain-Team, Bad Zwischenahn (www.hain-team.de) Coverbild: © MK2, Paris Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg ISBN 978-3-429-03823-6 (Print) 978-3-429-04782-5 (PDF) 978-3-429-06221-7 (ePub)
Inhalt
Erik Müller-Zähringer
Vorwort
Erik Müller-Zähringer
Sieben für Theben
Eine kleine philosophische Heldengeschichte in der alternden Moderne
Klaus Müller
Rhetorik des Wegzauberns oder: Wahrheit, Religion und Sloterdijk
Gregor Maria Hoff
„Ein Gespenst geht um …“
Die religionskritischen Sphären des Peter Sloterdijk
Johanna Rahner
Der Garten Eden ist kein Zoo!
Warum eine genmanipulierende Anthropotechnik als Königswissenschaft der späten Moderne nicht taugt und eine aufgeklärte Theologie nottut
Martin Kirschner
Gnadentheologische „Dehnübungen“ im Menschenpark
Transformationen der Anthropotechnik unter dem Vorzeichen der größeren Liebe Gottes
Johannes Först
Metapher, Fragment und Sakrament
Peter Sloterdijks metaphorische Sprachkunst als Impuls für eine sakramentale Daseinshermeneutik
Siegfried Grillmeyer
Fragen der Zeit: Eine Neuverortung der Theologie
Nachwort des Herausgebers der Reihe
Die Autorin und die Autoren
Vorwort
Eine Mondfahrt1 ist eine ernste Sache. Sie ist ein Ausgriff auf die Transzendenz – mit hilfreicher Unterstützung der Naturkräfte. Den Seefahrten der Neuzeit vergleichbar, ist sie Sinnbild einer Moderne, die nicht zuletzt Gott den Himmel zunehmend entzogen hat. Sinnbild einer Moderne auch, deren riskante Aus- und Auffahrt unsanft enden könnte.
Peter Sloterdijk ist ein ernst(zunehmend)er Philosoph? Für ihn „sind die frühen Seefahrten vergleichbar dem, was man Transzendenz, ein Hinübergleiten in höhere Sphären, nennt. […] Meine Gedankenflüge, meine philosophischen See- und Raumfahrten sind Alternativen zu den Bodenkämpfen meiner Kollegen.“2 Für manche schwebt seine fröhliche Wissenschaft in Sphären, in denen nichts als dünne Luft, darin gar manche Blase zu finden ist. Andere schätzen seine zeitdiagnostischen Analysen jener Aus- und Übergriffe des in ‚Vertikalspannung‘ existierenden modernen Menschen, der sich nicht nur nach der Decke streckt, sondern gegen die Deckelung selbst revoltiert. Ausgriffe und Übergriffe sind oft auch sie selbst: Sloterdijks sprachliche Salti und gedankliche Aeronautik, für manche Missgriffe, auf alle Fälle keine weichen Schaumteppiche für abstürzende Akrobaten der Moderne, aber auch keine kantigen Argumentationen, sondern eher schwammartige Gebilde, die dennoch provozieren.
Wie hält es der Sphärenforscher Sloterdijk mit der Religion? Welche Herausforderungen und Anstöße hält er für die Theologie bereit? In diesem Band geben eine katholische Theologin und fünf katholische Theologen aus verschiedenen Perspektiven eine Antwort. Es geht dabei immer auch um die Fragen der Zeit, um die hoffnungsvollen Ausfahrten der Neuzeit bzw. Moderne: Enden sie im Eismeer? Es geht um unsere Mondfahrten: Enden sie als Bruchlandung?
Dass die Hoffnungen auf Erscheinen dieses Buches nicht im Eismeer verschollen sind, dieses Verdienst gebührt allen, die daran mitgewirkt haben: der Autorin und den Autoren, jenen, die in verschiedenen Korrekturstufen das Buch begleitet haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Echter Verlags und der katholischen Akademie der Erzdiözese Bamberg und des Jesuitenordens Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürnberg. Von Herzen Dank für die schönen Stunden der gemeinsamen Arbeit an diesem Buch!
Zierenberg, am Hochfest der Erwählung Mariens 2014
Erik Müller-Zähringer
1 G. von Bassewitz’ Märchen gab über die Jahre schon oft die Formulierung für eine Auseinandersetzung mit P. Sloterdijk vor: vgl. z. B. U. Holbein, Peterchens Mondfahrt, in: Der Spiegel 42/1993 (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9289217.html; abgerufen am 17. 5. 2014); A. Platthaus, Peterchens Mondfahrt. Fährmann, ahoi: Käpt’n Sloterdijk bezwingt den Weltinnenraum, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 63/2005 (http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/peterchens-mondfahrt-1215038.html; abgerufen am 17. 5. 2014); vgl. auch H.-J. Heinrichs, Peter Sloterdijk. Die Kunst des Philosophierens, München 2011, 173 f.
2 So legt es ihm H.-J. Heinrichs in seinem fiktiven Interview in den Mund: Fiction: P. Sloterdijk trifft Kapitän Nemo und den Seefahrer Ismael, in: M. Jongen u. a. (Hrsg.), Die Vermessung des Ungeheuren. Philosophie nach Peter Sloterdijk, München 2009, 16 f. „In diesem Sinn wird der Philosoph zu einem Astronauten des Denkens und der psychischen Innen-Räume. Und in der Tat: Dem Leser von Peter Sloterdijks Büchern geht es noch am ehesten wie dem Zuschauer, der die luftigen Bewegungen der Astronauten in der Weltraumkapsel verfolgt, wie sie die menschlichen Lebensmöglichkeiten in einen größeren Raum ausweiten“ (H.-J. Heinrichs, Peter Sloterdijk, 17 f.; vgl. zu diesem Motiv ferner ebd., 10 f.21 f.). Vgl. auch Sloterdijks Beschreibung des ‚wachen Lebens‘ als ein „meteorisches Phänomen“: „Der Mensch ist ein denkender Meteorit“ (P. Sloterdijk, Der Zauberbaum. Die Entstehung der Psychoanalyse im Jahr 1785. Ein epischer Versuch zur Philosophie der Psychologie, Frankfurt a. M. 1987, 282).
Erik Müller-Zähringer
Sieben für Theben
Eine kleine philosophische Heldengeschichte in der alternden Moderne
Jede Zeit hat ihre Helden, und Helden haben ihre Zeit – gerade die klassischen. Auch die Philosophie, die an der Zeit ist, hat ihre Helden. Frei nach Fichte: Was für einen Helden man wählt, hängt davon ab, in was für einer Zeit man lebt. Helden werden aus der Not geboren, und unterschiedliche Nöte fordern unterschiedliche Helden – das gilt auch für Erklärungsnöte.
Im Helden legieren sich die allgemeinen Signaturen einer Zeit mit höchst individuellen Zügen1 in der Spannungseinheit von kraftvoller Tat und verhängtem Schicksal.
Die Neuzeit wähnte den Einzelnen frei im Kampf gegen die Schimären des Schicksals; sie entdeckte, beschwor und verherrlichte seine Handlungsmacht bis zu ihrer Vergötzung. Die Moderne erhob das Schicksal zum Projekt der einen Menschheit, zum Projekt der Geschichte des Kollektivsubjekts Mensch; Aufklärung war ihr Weg. Aufklärung als Entlarvung aller Mächte, die als unverfügbar galten, im Interesse ihrer Beherrschbarkeit. Frei nach Camus: Es gibt kein Schicksal, das durch Entlarvung nicht in unsere Hände gelegt werden kann; ja, Aufklärung sucht fürwahr „aus dem Schicksal eine menschliche Angelegenheit [zu machen], die unter Menschen geregelt werden muß.“2 Doch mit dem Altern von Neuzeit und Moderne reift die Erkenntnis: Allen Entlarvungen zum Trotz behauptet sich das Schicksal mit Macht; auch selbstverschuldet, selbstgewebt ist es unverfügbar. Mehr noch: „Wir gehören nicht mehr zu jenem Geschlecht der tragischen Helden, die, nachträglich jedenfalls, zu erfahren hatten, daß sie sich selbst ihr Schicksal bereitet hatten. Wir wissen es schon vorher.“3
Dass sich aus dem Faden unserer Taten das Netz knüpfte, in das wir uns verschlingen, das uns verschlingt, diese Erkenntnis teilen die Heroen antiker Tragik mit jenen, die Einsicht in die Tragödie der Aufklärung gewannen; freilich mit unterschiedlichen Prämissen. Der Plan von der Abschaffung des Schicksals misslang; die entzauberte Welt, die vollends aufgeklärte Aufklärung strahlt im Zeichen seiner triumphalen Rückkehr. Ungerührt vom Tod der Götter, unberührt von metaphysischen Kräften schießt es aus unseren Handlungen zusammen und ist uns doch so transzendent wie die Moiren der Antike. Das Schicksal ist fürwahr autopoietisch; darin liegt seine Opazität. Von uns erzeugt und doch nicht geschaffen, selbstgesetzt und selbstgesetzlich in einem radikalen Sinne widersteht es jeglicher nomologischen Aufklärung. Mit dem Schicksal ist wieder zu rechnen; berechenbar ist es nicht. Die Theorie hat diesen Gedanken großflächig exekutiert – und mit ihm althergebrachte Vorstellungen kausal-linearer Handlungszusammenhänge; von der Biologie über die Soziologie hin zur Pädagogik: „Von der Autonomie zur Autopoiesis“4 heißt die Losung. Freiheit, Absichtlichkeit, Zweckdienlichkeit, Moralität einer Handlung – welche Rolle sollten solche Merkmale des klassischen Handlungsbegriffs noch spielen nach der Einsicht: Ich handle, also geschieht es? Längst ist selbst in einer naturwissenschaftlich-nomologisch geprägten Zivilisation wie der unseren das einst hypostasierte Band zwischen Ursache und Wirkung in komplexeren Zusammenhängen gerissen. Gelichtet und opak zugleich tritt das Schicksal in die Lücke.
Wie aber leben, wie aber handeln im Schatten dieser Erkenntnis? Leben, Handeln im Angesicht des Unverfügbaren ist das Schicksal des klassischen Helden. Der Helden aber sind viele, ebenso der Möglichkeiten, dem Schicksal zu begegnen. Im Folgenden sei eine kleine philosophische Heldengeschichte in der alternden Moderne versucht: nicht der Philosophie als Heldengeschichte, wie sie Hegel erzählt5, sondern eine Geschichte ihrer Helden. Und damit eine kleine Archäologie der europäischen Selbstverständigung6, ein Stück Zeitdiagnostik anstelle der üblichen Einleitung – insbesondere im Blick auf jenen, der sich und „seine eigene zeitdiagnostische Arbeit […] als ein ‚automatisches Klavier des Zeitgeistes‘ [sieht]“7: Peter Sloterdijk. „Genau wie Nietzsche sieht er sich selber als ‚Mundstück‘ und ‚Medium‘, ein Klangkörper, der epochale Stimmungen kommuniziert. […] Gleichzeitig weiß er, dass kein einziges Medium transparent ist: ‚Ich nehme Stimmungen leicht auf, aber ich sortiere ziemlich streng.‘“8 Überdies nimmt Sloterdijk in Anspruch, mit seinen Zeitdiagnosen mittendrin, glatt pur dabei zu sein: „zeitkrank […], um zeitdiagnostisch etwas zu sagen zu haben“, teilt er mit Nietzsche die Vision „vom Philosophen als Arzt der Kultur“9, der sich selbst der Gefahr aussetzt10, um als „Immunologe der Kultur“11 zu wirken. Mittendrin, das heißt aber auch: Zeitdiagnostik aus begrenzter Warte, aus dem Gewühl des Schlachtfelds, nicht vom Feldherrenhügel herab.
„Wir sind nicht die Briefträger des Absoluten, sondern Individuen, die die Detonationen der eigenen Epoche im Ohr haben. Mit diesem Mandat tritt der Schriftsteller heute vor sein Publikum, es lautet in der Regel nur ‚eigene Erfahrung‘. Auch diese kann ein starker Absender sein, wenn sie ihr Zeugnis vom Ungeheuren ablegt. Sie ermöglicht unsere Art von Mediumismus. Wenn es etwas gibt, wovon ich überzeugt bin, dann davon, daß es nach der Aufklärung, wenn man sie nicht umgangen hat, keine direkten religiösen Medien mehr geben kann, wohl aber Medien einer historischen Gestimmtheit oder Medien einer Dringlichkeit.“12
„Um Sloterdijks Werk philosophisch ernst nehmen zu können, ist eine großzügige Auffassung von Philosophie erforderlich. […] Sloterdijk ist ein Hyperboliker; seine provokativen Thesen ertragen daher keine dauerhafte Relativierung und Präzisierung. Es ist das Merkmal einer fröhlichen Wissenschaft, dass Ernst und Parodie oder Naivität und Ironie nicht immer unterschieden werden können.“13 Getragen wird sie von durchaus bedenkenswerten zeitdiagnostischen Intuitionen, den „Traumüberschüsse[n] der eigenen Epoche und ihre[m] Terror“14. Theologie, die an der Zeit ist, kann sich eine Auseinandersetzung mit ihnen nicht ersparen. Im Folgenden lasse ich mich von ihnen anregen, bildreich, evokativ, höchst subjektiv, auch in Auswahl und Montage, im Zeichen des Spatzes15, die Detonationen der eigenen Epoche im Ohr.
Odysseus
Aufklärung ist der Aufstand des Menschen gegen die fremdverschuldete Ohnmacht16; ihr Motiv ist Furcht, ihr Programm Entzauberung, ihre Sehnsucht umfassende Selbstbestimmung, ihr Held Odysseus. Der Sohn des Laërtes17 wird für Horkheimer und Adorno zum Urbild des bürgerlichen Individuums18, an ihm exemplifizieren sie im „Grundbuch der neueren Vernunftkritik“19 die Dialektik der Aufklärung. Aber der Reihe nach.
Aufklärung ist der Aufstand des Menschen gegen die fremdverschuldete Ohnmacht: Ihr Ziel im Interesse des Selbsterhalts ist die „Entmächtigung der Mächte“20 in uns und außer uns. Ihr Motiv ist Furcht: Die Quelle der Furcht liegt in der Fremdheit des Fremden und seiner möglichen Macht. Wir fürchten, was sich unserem Verständnis entzieht, und wir ahnen die potenzielle Gewalt, die im Dunkel dieser Fremde lauert. „Der Furcht aber“ wähnen wir „ledig zu sein, wenn es nichts Unbekanntes mehr gibt. […] Aufklärung ist die radikal gewordene mythische Angst. […] Es darf überhaupt nichts mehr draußen sein, weil die bloße Vorstellung des Draußen die eigentliche Quelle der Angst ist.“21 Ihr Programm ist Entzauberung22: Entlarvung aller Mächte, die für unverfügbar galten, und Herrschaft über die Mächte im Zeichen von Formel, Zahl, Gesetz, von Wissenschaft und Technik. In hoc signo sucht Aufklärung zu siegen und ihre Sehnsucht zu befriedigen: umfassende Selbstbestimmung. Niemand, nichts Anderes, nichts Fremdes, soll über mich bestimmen oder Gewalt haben, kein Gott, nicht Natur noch Mensch. An Odysseus illustrieren Horkheimer und Adorno das Scheitern dieser Hoffnungen.
Für Horkheimer und Adorno legt Homers Odyssee, „der Grundtext der europäischen Zivilisation“23, beredtes „Zeugnis ab von der Dialektik der Aufklärung“24; für sie ist Odysseus’ Irrfahrt „ahnungsvolle Allegorie der Dialektik der Aufklärung“25 und „Urgeschichte der Subjektivität“26 zugleich. „Die Irrfahrt von Troja nach Ithaka ist der Weg des […] unendlich schwachen und im Selbstbewußtsein erst sich bildenden Selbst […]. Die Abenteuer, die Odysseus besteht, sind allesamt gefahrvolle Lockungen, die das Selbst aus der Bahn seiner Logik herausziehen.“27 Jedoch: „das Selbst macht nicht den starren Gegensatz zum Abenteuer aus“28. Gerade in der Auseinandersetzung mit den vorweltlichen mythischen Mächten, gerade „an der Erfahrung des Vielfältigen, Ablenkenden, Auflösenden“29, formt das Selbst „in seiner Starrheit sich erst durch diesen Gegensatz“30 – zu eben jenem Selbst, jenem „identische[n], zweckgerichtete[n], männliche[n] Charakter“31, jenem Urbild des bürgerlichen Individuums, das Adorno und Horkheimer ins Zentrum ihrer Kritik stellen.
Odysseus sucht „den Mächten der Auflösung zu widerstehen“32, „den Figuren des Zwanges“33 und „des abstrakten Schicksals, der sinnfernen Notwendigkeit“34 zu trotzen; er stellt sich „wider die Unausweichlichkeit des Schicksals.“35 „Aber die Lockung der Sirenen bleibt übermächtig.“36 Die Mächte lassen sich nicht entmächtigen, sie lassen sich lediglich überlisten. „Das Organ des Selbst, Abenteuer zu bestehen, sich wegzuwerfen, um sich zu behalten, ist die List“37 – „List aber ist der rational gewordene Trotz.“38 „Der Seefahrer Odysseus übervorteilt die Naturgottheiten“39 – hierin liegt der Witz des Odysseus: „Niemals kann er den physischen Kampf mit den exotisch fortexistierenden mythischen Gewalten selber aufnehmen.“40 Ihre Macht vermag er nicht zu brechen. „Stattdessen macht er sie formal zur Voraussetzung der eigenen vernünftigen Entscheidung.“41
So bedingt die Überlistung der mythischen Mächte just die Anerkennung ihrer Macht, so fordert sie ihren Preis, der für Horkheimer und Adorno die Dialektik der Selbstbehauptung zeigt: Im Versuch, dem Bannkreis fremder Mächte zu entrinnen und sich zu erhalten, formt sich das identische Selbst – und deformiert zugleich, weil es ihrem Bannkreis eben nicht zu entrinnen vermag. So wird die Odyssee zur Allegorie der Dialektik der Aufklärung. Wie Odysseus die mythischen Mächte, sucht Aufklärung nach deren Entzauberung die Natur zu beherrschen im Interesse des Selbsterhalts. Wie Odysseus die mythischen Mächte, vermag sie die Natur jedoch nicht eigentlich zu beherrschen, sondern nur zu benutzen.
„Gerade vom naturbeherrschenden Geist wird die Superiorität der Natur im Wettbewerb stets vindiziert. Alle bürgerliche Aufklärung ist sich einig in der Forderung nach Nüchternheit, Tatsachensinn, der rechten Einschätzung von Kräfteverhältnissen. […] Nur die bewußt gehandhabte Anpassung an die Natur bringt diese unter die Gewalt des physisch Schwächeren. […] Das Schema der odysseischen List ist Naturbeherrschung durch solche Angleichung.“42
Aufklärung suchte die Natur zu ent-fremden und zu beherrschen qua Zahl, Formel, Gesetz. Doch unser Zugriff auf Natur bleibt instrumentell, die Zwecklosigkeit ihrer Zwecke uns unverfügbar und verschlossen. „Technik ist das Wesen dieses Wissens“43, das Macht ist, weil wir uns damit die Kräfte der Natur dienstbar machen – ihr Wesen bleibt uns verborgen. So bezahlen die Menschen
„die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von dem, worüber sie die Macht ausüben. Die Aufklärung verhält sich zu den Dingen wie der Diktator zu den Menschen. Er kennt sie, insofern er sie manipulieren kann. Der Mann der Wissenschaft kennt die Dinge, insofern er sie machen kann. Dadurch wird ihr An sich Für ihn. In der Verwandlung enthüllt sich das Wesen der Dinge immer als je dasselbe, als Substrat von Herrschaft. Diese Identität konstituiert die Einheit der Natur.“44
In ihrem Bann verbleibt die Aufklärung – und mit ihr Subjekt und Gesellschaft, Vernunft und Sinne, Philosophie und Kunst, ja, alle Bereiche des menschlichen Daseins. Mit „der Entfremdung der Menschen von den beherrschten Objekten […] wurden die Beziehungen der Menschen selber verhext, auch die jedes einzelnen zu sich.“45 Verdinglichung und Verhärtung, Entfremdung und Entsagung, Aufschub der eigenen Glücksansprüche und regredierte Wahrnehmung, eine Erfahrungswelt, die sich „tendentiell wieder der der Lurche an[ähnelt]“46; eine Gesellschaft im Zeichen des Tauschs, in der alles und jeder zur Ware wird, in der selbst scheinbar Mächtige zur puren Funktion des Apparats werden; ein Rationalismus, der, in instrumentelle Vernünfte ausdifferenziert, sich in der Anhäufung technischen Wissens verausgabt – dies sind u. a. die Stichworte, mit denen Horkheimer und Adorno die Dialektik der Aufklärung schildern. Kurz: „Jeder Versuch, den Naturzwang zu brechen, indem Natur gebrochen wird, gerät nur um so tiefer in den Naturzwang hinein. So ist die Bahn europäischer Zivilisation verlaufen. Die Abstraktion, das Werkzeug der Aufklärung, verhält sich zu ihren Objekten wie das Schicksal, dessen Begriff sie ausmerzt: als Liquidation.“47 Eine solche Aufklärung als Angleichung an die – wohlgemerkt bereits entzauberte – Natur ist „Mimikry ans Amorphe“48, „ist selber Mimesis: die ans Tote“49.
Dante, der Homers Odyssee nicht kannte50, hatte den Betrüger Odysseus im XXVI. Gesang des Inferno seiner Göttlichen Komödie im achten Kreis der Hölle platziert.51 Im Gespräch enthüllt Odysseus seine Geschichte: Seine Neugier trieb ihn aufs Meer und lässt ihn Familie und Heimat flüchten. Immer weiter strebte er, die Welt zu erkunden. So hat Dante „Odysseus als die weltliche Seite des Renaissancemenschen gestaltet […]. Befreit von echter Bindung, strebt er entfesselt und haltlos ins Unbekannte. Keine Familie vermag ihm mehr zu genügen. Die Säulen des Herkules, einst heilige und unverletzbare Grenze des Forscherdrangs, können seinen Wissensdurst nicht mehr hemmen.“52 Er erliegt der curiositas, der cupiditas sapientiae und damit der „Verlockung der Sirenen nämlich als Versuchung zum hybriden Mißbrauch der Vernunft“53 – und stirbt auf dem Meer.
Nietzsches neue Losung aus seiner Fröhlichen Wissenschaft (IV. Buch, Nr. 289) – „Auf die Schiffe!“ – kann fürwahr als Motto über der Neuzeit stehen. Es ist eine Fahrt ohne Wiederkehr. Le siècle des Lumières hat die Anker gelichtet, die Trossen zur alten Welt des Sinns gelöst. Die Götter schwimmen unbewiesen in ihrem Blute (H. Heine), die mythischen Mächte sind entzaubert, die Natur entseelt, der Mensch verdinglicht. Der Versuch, „aus dem Schicksal eine menschliche Angelegenheit [zu machen],“54 ward den Menschen zum Schicksal. Es ist eine Ausfahrt zu einem Horizont, hinter dem kein Land liegt. Und auf dem Meer, in der Rückschau, erweist sich auch die alte Welt als Trug: Heimat ist ein Ort, „worin noch niemand war“55. Ohne Heimat, ohne Ziel bleibt uns nur das Meer – „es gibt kein ‚Land‘ mehr!“56 Der Fliegende Holländer ist unser zu Hause: ewige Weiterfahrt, ohne Aussicht auf Erlösung. Wir sind allein auf dem Meer.57 Heimat wäre das Entronnensein.58 Doch Odysseus, der betrogene Betrüger, sitzt in der Hölle, die er selbst erschuf. Sie hat schwankende Planken.59