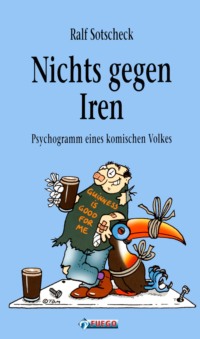Buch lesen: "Nichts gegen Iren"
Ralf Sotscheck
Nichts gegen Iren
Psychogramm eines komischen Volkes
Mit Illustrationen von
© TOM
FUEGO
- Über dieses Buch -
Wie hat es dieses rothaarige, sommersprossige und ständig betrunkene Volk am Rande Europas bloß geschafft, zu einer der reichsten Nationen der Welt zu werden? Anfang der neunziger Jahre begann Irlands Wirtschaftsboom, 2008 war es damit wieder vorbei. Irland sei eine Art Schlaraffenland, schrieb die polnische Presse, und das haben mehr als 200.000 Polen geglaubt. Der Schrei des keltischen Tigers, wie das irische Wirtschaftswunder genannt wird, hat sie auf die Grüne Insel gelockt. Dort machen sie nun fünf Prozent der Bevölkerung aus und wundern sich, auf was sie sich eingelassen haben.
Der Dichter G. K. Chesterton schrieb einmal: »Die großen Gälen von Irland sind die Menschen, die Gott verrückt gemacht hat, denn alle ihre Kriege sind fröhlich und alle ihre Lieder sind traurig.« Und Sigmund Freud hat behauptet, dass die Iren das einzige Volk seien, dem durch Psychoanalyse nicht zu helfen sei. Sie seien voller Widersprüche und immun gegen rationale Denkprozesse.
Während sich die Iren vehement und zu recht dagegen wehren, mit den Briten in einen Hut geworfen zu werden, vereinnahmen sie gerne erfolgreiche Ausländer und machen sie zu Iren wider Willen. Der bisher letzte in dieser Reihe ist der neue US-Präsident Barack Obama: Die Iren haben herausgefunden, dass sein Ur-Ur-Urgroßvater aus dem winzigen Nest Moneygall in der vergessenswerten Grafschaft Offaly stammte und haben ihn prompt adoptiert - ebenso wie 21 seiner Vorgänger.
Es ist Zeit, die Wahrheit über die Iren zu erzählen. Der Autor ist einer von ihnen. Ralf Sotscheck, ein Berliner mit irischen Pass.
Ein komisches Volk
Der Ire an sich
Eine Vorbemerkung
Irland ist eine Insel und liegt westlich von Großbritannien. Soweit sind sich alle einig. Doch die Insel besteht aus dem Staat Irland und aus Nordirland, das zum Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland gehört. Wenn die Nordiren von ihrer Heimat sprechen, weiß man sofort, welcher Religion sie angehören: Unionistische Protestanten, die für den Verbleib bei Großbritannien sind, sprechen von Ulster. Das ist eine der vier irischen Provinzen, aber sie umfasst neben den sechs nordirischen Grafschaften auch drei Grafschaften, die zur Republik Irland gehören. Katholische Nordiren, die für die Wiedervereinigung beider Teile Irlands sind, nennen Nordirland deshalb »die sechs Grafschaften« oder einfach nur »The North«.
»Eire« ist der irische Name für die Republik Irland, er steht auch auf den Briefmarken. »Die pro-britische Mehrheit Nordirlands verwendet aus naheliegenden Gründen den Terminus ›Irland‹ für die Republik Irland nicht gerne«, schreibt Frank McNally in seinem Xenophobe´s Guide To The Irish. »Obwohl sie keine besonderen Sympathien für die irische Sprache hegen, benutzen sie oft den Namen ›Eire‹ im Englischen. Das wird von den Menschen in der Republik Irland als Beleidigung aufgefasst, und als solche ist es von den Unionisten auch gemeint, obwohl beide Seiten große Schwierigkeiten hätten, die Gründe dafür zu erklären.« Manchmal sagen die Nordiren auch einfach »The South«, wenn sie die Republik Irland meinen, obwohl der nördlichste Punkt des Südens – nämlich die Grafschaft Donegal – nördlicher liegt als der nördlichste Punkt des Nordens.
Möglicherweise hat Sigmund Freud also recht mit seiner Behauptung, dass die Iren das einzige Volk seien, dem durch Psychoanalyse nicht zu helfen sei. Sie seien voller Widersprüche und immun gegen rationale Denkprozesse. Und der englische Dichter G. K. Chesterton schrieb einmal: »Die großen Gälen von Irland sind die Menschen, die Gott verrückt gemacht hat, denn alle ihre Kriege sind fröhlich und alle ihre Lieder sind traurig.«
Ob jemand Ire oder Brite ist, hängt manchmal von anderen Dingen als dem Geburtsort ab. Als die Schauspielerin Brenda Fricker mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, war über Nacht vergessen und vergeben, dass sie Irin ist. Sie wurde von den britischen Medien als Britin vereinnahmt. »Wenn du sturzbesoffen auf einem Flughafen herumlümmelst, bist du Ire«, stellte sie fest. »Gewinnst du aber einen Oscar, bist du Brite.« Und Seamus Heaney fand sich, nachdem er den Literatur-Nobelpreis gewonnen hatte, plötzlich in einer Anthologie britischer Dichtung wieder. Er schrieb prompt ein Protestgedicht.
Noch unverfrorener funktioniert das im Sport. Der englische Sportkommentator Harry Carpenter machte sich über den irischen Golfspieler Christy O’Connor lustig, der nach der ersten Runde bei den britischen Open auf dem vorletzten Platz lag. Nach einer sensationellen letzten Runde war der flugs naturalisierte »britische Golfer O’Connor« plötzlich vorne. Und als die englische Fußball-Nationalmannschaft bei den Europameisterschaften 1988 in Deutschland gegen das irische Team ausschied, wurden die Iren umgehend zur »englischen B-Mannschaft« erklärt.
Andererseits neigt auch der Ire dazu, berühmte Ausländer für sich zu vereinnahmen – zum Beispiel Regierungschefs. Charles de Gaulle war eigentlich Ire, denn er hatte eine irische Urgroßmutter, und die Hälfte aller US-Präsidenten hat ebenfalls irische Wurzeln, von Washington und Jackson über Roosevelt und Kennedy bis hin zu Nixon, Reagan, Clinton und den Bushs. Natürlich ist auch Barack Obama im Grunde Ire. Der Pfarrer von Moneygall, einem Kaff in der Grafschaft Offaly, hat herausgefunden, dass ein Fulmuth Kearney in Moneygall geboren ist. Sein Vater war Schuhmacher. Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte in Irland eine furchtbare Hungersnot. So wanderte Fulmuth am 20. März 1850 an Bord der S.S. Marmion nach Amerika aus, er war damals 19. Er ließ sich in Ohio nieder und hatte mit seiner Frau acht Kinder. Eine der Töchter, Mary Ann, heiratete einen Jacob Dunham 1890 in Kansas. Deren Sohn Ralph Dunham hatte einen Sohn, Stanley Dunham, der wiederum eine Tochter hatte: Ann Dunham. Die heiratete einen Kenianer, der in Hawaii studierte und Barack Obama Senior hieß. Deren Sohn, der US-Präsident, ist also der Ur-Ur-Urenkel von Fulmuth Kearney aus Moneygall. Nun nennen sie ihn O’Bama in Irland.
Nur der Herzog von Wellington, der in Dublin geboren ist und später Napoleon besiegte, wehrte sich gegen die Zwangsirisierung. Als er in einer Zeitung als Ire bezeichnet wurde, empörte er sich: »Wer in einem Stall geboren ist, muss noch lange kein Pferd sein.« Aber 45 Millionen US-Amerikaner berufen sich freiwillig auf irische Wurzeln. »Das weist entweder auf einen phänomenalen Erfolg bei der Vermehrung hin«, schreibt Frank McNally, »oder es liegt wahrscheinlicher daran, dass sie aus ihren weit verstreuten Vorfahren sich die armen, unterdrückten Iren aussuchen, weil die ein günstiges soziales Prestige haben.«
Das ist auch einer der Gründe für die Beliebtheit der Iren bei den Deutschen. Sie hatten in Deutschland den Ruf, bemitleidenswert arm zu sein, ihre wenige Habe zu vertrinken und dabei melancholische Lieder zu singen. Heinrich Böll hat das in seinem »Irischen Tagebuch« festgehalten. Aber das Irland, das er beschrieb, gab es schon damals nicht so ganz, einiges hat er erfunden. Zum Beispiel die junge Arztfrau, die bangend am Fenster wartet, weil ihr Mann bei Sturm und Regen unterwegs zu einer Entbindung war. Als er zurückkam, hatte er einen Kupferkessel bei sich – sein Honorar. Die junge Arztfrau ist inzwischen über 70. »Den Kupferkessel hat sich der gute Heinrich ausgedacht«, sagt sie. »So rückständig waren wir damals nicht, es gab schon Geld in Irland.«
Aber rückständig waren sie trotzdem, und das machte für viele Deutsche den Reiz aus. »Das war es vielleicht, was wir an Irland so liebten«, schreibt der Journalist Christian Kranz. »Dass es eine Reise in die Vergangenheit war, dass Irland damals zwanzig Jahre hinter Deutschland zurück war, dass es so war wie bei uns, als noch nicht jeder ein Auto hatte und einen Fernseher.« Menschliches war wichtiger als Materielles. Und die Iren hatten Zeit.
Die Sympathien haben sich die Iren gründlich verscherzt. Anfang der neunziger Jahre zettelten sie hinterrücks einen Wirtschaftsboom an, Irland verzeichnete Wachstumsraten von bis zu zehn Prozent. Irland sei eine Art Schlaraffenland, schrieb die polnische Presse immer wieder, und das haben mehr als 200.000 Polen geglaubt. Der Schrei des keltischen Tigers, wie das irische Wirtschaftswunder genannt wird, hat sie auf die Grüne Insel gelockt. Dort machen sie nun fünf Prozent der Bevölkerung aus.
Irland hat sich durch den Aufschwung verändert – sehr zum Verdruss der alteingesessenen Irlandfans, die ihre Grüne Insel gerne in einer Zeitschleife bewahrt hätten. In den einschlägigen deutschen Irland-Foren war man überwiegend der Meinung, dass die Liebe zu Irland nun erkalten werde. Die Hauspreise und Mieten sind in schwindelerregende Höhen gestiegen, die Restaurants sind teuer, selbst das Guinness ist in vielen Ländern billiger zu haben als in der Stadt, wo es gebraut wird. Dublin ist längst die teuerste Hauptstadt in der Eurozone. Hinzu kommen Reglementierungen, die man bisher eher mit Deutschland in Verbindung gebracht hätte: Die Iren führten das strengste Rauchverbot Europas ein, Autos müssen sich neuerdings einem TÜV unterziehen, Geschwindigkeitskontrollen sind an der Tagesordnung.
Aber das irische Wirtschaftswunder hat das Land, und vor allem die Hauptstadt, aus ihrer Provinzialität gerissen. Boutiquen, Restaurants, italienische Feinkostläden und Kunstgalerien, Diskotheken und Rock-Cafes haben sich in der Innenstadt breitgemacht. Dublin ist eine junge Stadt, 40 Prozent der Bevölkerung sind unter 25, das Durchschnittsalter liegt bei 31. Das spiegelt sich im Nachtleben wider. Es ist eine internationale Stadt, es ist immer etwas los. Deshalb kommen inzwischen junge Deutsche, deren Irlandbild nicht durch Bölls »Irisches Tagebuch« geprägt ist. Sie studieren ein paar Semester, sie arbeiten als Au pair, oder sie jobben für ein paar Monate in einem der zahlreichen Call Centre, bevor sie wieder nach Hause fahren.
Die meisten fühlen sich wohl in Irland und sind von der Großzügigkeit der Einheimischen begeistert. Das beruht allerdings manchmal auf einem Missverständnis, weil sie – im Gegensatz zu den alteingesessenen Irlandfahrern – die Spielregeln im Pub nicht kennen: Wenn das erste Glas am Tisch leer ist, bestellt derjenige unaufgefordert die nächste Runde, der damit an der Reihe ist. Oder man steigt gar nicht erst in eine Runde ein.
Deutsche gelten in Irland als äußerst langsam, wenn es ums Zücken der Brieftasche geht. Manche stellen zur Sperrstunde erfreut fest, dass sie der Abend keinen Pfennig gekostet habe, weil sie ständig eingeladen worden seien. Andere halten sich stundenlang an einem Glas Bier fest – oder bestellen überhaupt nichts. Wenn man sie fragt, warum sie ins Wirtshaus gehen, antworten sie, dass sie die Atmosphäre mögen und sich gerne mit Leuten unterhalten.
Eine andere deutsche Unsitte wird von den Kellnern und Kellnerinnen in irischen Restaurants beklagt. Geht es ans Bezahlen, verlangen die meisten Deutschen eine getrennte Rechnung, auch wenn der Kassenbon jede Suppe und jedes Wässerchen einzeln aufführt. Manch deutsche Gruppe hat schon ganze Speisesäle lahmgelegt, weil Tante Martha aus Bottrop am Ende steif und fest behauptet, den dritten Irish Coffee nicht getrunken zu haben. Das wird dann in der Gruppe diskutiert, und dabei fällt Hans-Georg aus Recklinghausen die Bloody Mary auf seinem Zettel auf, wo er doch nur einen Wodka mit Tomatensaft und Tabasco zu sich genommen hat.
Iren haben es da leichter: Sie teilen die Summe durch die Zahl der Gäste. Das mag manchmal nicht ganz gerecht sein, ist ihnen aber lieber als die Pfennigfuchserei. Einige Lokale haben auf ihren Speisenkarten vermerkt, dass Einzelrechnungen leider nicht in Frage kämen, doch könne sich jeder anhand der verschiedenen Posten seinen Anteil ausrechnen, wenn er möchte. Der Hinweis ist zweisprachig: englisch und deutsch.
Der irische Boom hat auch Missgunst hervorgerufen. Schon 1998 schrieb der Spiegel: »Bonn überweist knapp 22 Milliarden Mark nach Brüssel und erhält 11,5 Milliarden.« Die Iren hingegen machen »ein sattes Plus von über 2,4 Milliarden Mark«. Irische Bauern beschäftigten sich im Grunde nur damit, »sich über den jeweils neuesten Stand der EU-Zuwendungen auf dem laufenden zu halten«. Der Spiegel-Autor warf ihnen »illegale Abzockerei« vor. Er hat festgestellt, dass es offenbar weniger Schafe in Irland gibt als angenommen. Die listigen Schnorrer treiben bei Inspektionen einfach dieselbe Herde auf »verschiedenen Bauernhöfen immer aufs neue zum Nachweis der Subventionsberechtigung« vorbei. Und dann rudern sie mit den Tieren nach Wales hinüber, um dort auch noch mal abzukassieren. Der Agrarinspektor, der ihnen auf die Schliche kommen könnte, lebe gefährlich und »muss im Dienst immer mit Prügel rechnen«.
Der Artikel rief in Irland nicht nur einen landesweiten Wutausbruch hervor, sondern man zahlte es mit gleicher Münze heim. Der Cork Examiner, ein Lokalblatt mit überregionalen Ambitionen, fand den Namen des Spiegel-Autors heraus: Dirk Koch besitze zwei Häuser im Süden der Grafschaft Cork, schrieb die Autorin Anne Lucey, und das sei typisch: »Hohe Mauern, höhere Tore, bellende Stimmen und Missachtung von Jahrhunderte altem Wegerecht.« Selbst die Nägel würden sie aus Deutschland importieren, wenn sie ihre Häuser bauten, weil ihnen die irischen Produkte nicht gut genug seien. »Sie wollen das Land für sich allein und würden uns am liebsten vertreiben.« Das vernichtende Urteil: Die Deutschen seien auch nicht besser als die Engländer, die früher die Köpfe der Iren vermessen haben, um nachzuweisen, dass sie eigentlich zu den Affen gehören.
Und undankbar sind die Affen obendrein. Nicht wenige EU-Politiker empörten sich, dass die Iren erst aus den EU-Töpfen abkassiert und dann im Sommer 2008 den EU-Reformvertrag von Lissabon per Referendum abgelehnt haben. Nicht ganz zu Unrecht wirft man den Iren außerdem vor, das europäische Finanzsystem ins Wanken gebracht zu haben. Irische Gesetze garantieren Steuerfreiheit für das Management, stellen geringe Anforderungen an die Kapitalunterlegungen und sehen keine aufsichtsrechtliche Hürden und eine vereinfachte Kotierung an der irischen Börse vor.
»Der Inselstaat ist langsam reif für den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde«, schrieb Tobias Bayer in der Financial Times Deutschland. »Ob EU-Referendum oder Bankenschieflagen, die Iren sind allgegenwärtig.«
Die Iren bemühen sich nach Kräften, alles wieder gut zu machen. Sie haben eingesehen, dass ein Wirtschaftsaufschwung nicht zu ihnen passt und ihr Image im Ausland ruiniert. So sind sie schneller und gründlicher in die Rezession gerauscht, als alle anderen.
Die Europäische Kommission prophezeit, dass Irland in den nächsten Jahren die zweitschwächste Wirtschaft aller EU-Länder haben wird, die Arbeitslosigkeit werde auf über zehn Prozent ansteigen. Die irische Regierung hat vorbildlich dazu beigetragen: Sie hat die satten Haushaltsüberschüsse der fetten Jahre für pompöse Straßenbauprojekte und für den Stimmenfang verpulvert, so dass nun nichts mehr übrig ist und allerorten gekürzt werden muss.
So waren die Boomjahre wohl lediglich ein kurzer Abstecher in den Reichtum – vom Armenhaus zum keltischen Tiger und wieder zurück zum Armenhaus? Die traditionellen Irlandfans aus aller Welt würde es freuen, wenn ihre Grüne Insel wieder zum Naturreservat für ausgebrannte Kapitalisten würde. Dann könnten sich die Iren endlich auf das Wesentliche konzentrieren: das Trinken des schwarzen Bieres, das Singen melancholischer Lieder und das Verfassen von Werken der Weltliteratur.

Wer hustet, hat schon verloren
Der Ire und seine Alltagsfreuden
Wie viele Iren gibt es eigentlich? Mehr als noch vor 25 Jahren. Die Bevölkerungszahl ist von dreieinhalb auf über vier Millionen gestiegen. Dafür ist nicht nur die Geburtenrate der Grünen Insel verantwortlich, die mit 1,93 Kindern pro Frau noch immer deutlich über dem EU-Mittelwert liegt – und das Durchschnittsalter deshalb mit 34,2 Jahren unter dem EU-Schnitt von 38,9 Jahren. Hinzu kommt, dass Irland, das klassische Auswandererland, im vergangenen Vierteljahrhundert zum Einwandererland geworden ist. Die größte Gruppe stellen die Polen mit mehr als 200.000 Menschen. Der irische Billigflieger Ryanair spielt dabei eine große Rolle, da vor allem Polen aus den Regionen nach Irland einwandern, die über eine Ryanair-Direktverbindung nach Dublin verfügen.
Doch die Zeiten des Wirtschaftsbooms mit Wachstumsraten um zehn Prozent, die Irland den Spitznamen »keltischer Tiger« einbrachten, sind vorbei. Mit stagnierender Wirtschaft und steigender Arbeitslosigkeit hat die Auswanderung inzwischen wieder zugenommen, die Einwanderung ist in den ersten sechs Monaten 2008 um 40 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr gesunken.
Nur die wenigsten Immigranten sehen Irland als neue Heimat an, noch weniger haben die irische Staatsbürgerschaft angenommen. Dabei ist es nicht sonderlich schwer, Ire zu werden. Kein Land in Europa handhabt die Einbürgerung so großzügig wie Irland. Wer genügend Geld auf der Grünen Insel investiert, wird gerne naturalisiert. Der damalige Premierminister Charles Haughey überreichte dem Scheich Khalid bin Mahfouz, einem Schwager Ussama bin Ladens, bei einer Dinner Party in den achtziger Jahren elf irische Pässe für die ganze Familie – gegen eine »persönliche Spende«.
Bis 2005 reichte es für die Staatsbürgerschaft auch aus, in Irland – und dazu gehört auch Nordirland – geboren zu sein, selbst wenn das zufällig bei einer Urlaubsreise geschah. Diese Regelung wurde dann per Referendum geändert, da die Regierung behauptete, dass Asylbewerberinnen das ausgenutzt haben und geschwind einreisten, nachdem die Wehen eingesetzt hatten.
Nun muss man ein irisches Eltern- oder Großelternteil nachweisen, um einen Pass zu bekommen. Das trifft zum Beispiel auf die irische Fußball-Nationalmannschaft zu, die überwiegend aus Spielern besteht, die in England geboren sind. Wer einen Iren oder eine Irin heiratet und danach mindestens drei Jahre auf der Insel lebt, hat ebenfalls Anrecht auf die irische Staatsbürgerschaft. Alle anderen Ausländer müssen ihren »guten Charakter« nachweisen und eine Loyalitätserklärung zum Staat abgeben. Die Entscheidung liegt dann beim Justizminister. Die genaue Zahl der Ausländer, die derzeit in Irland leben, ist ungewiss, da es keine Meldepflicht gibt.
Der Staat interessiert sich aber brennend für das Privatleben seiner Schäfchen. Zu diesem Zweck veranstaltet er alle paar Jahre eine Volkszählung, bei der man über Wohnsituation, Bildungsstand, Gesundheit, Aufstehgewohnheiten und allerlei Intimes Auskunft geben muss. Andernfalls drohen 25.000 Euro Geldstrafe.
Mein Freund Robert hatte sich als Volkszähler beworben, und weil er ein pensionierter Mathematik-Professor ist, beförderte man ihn sogleich zum Teamleiter: Er bekam elf Studenten und Studentinnen zugeteilt und musste deren Einsatzgebiete koordinieren. Er selbst konnte auf seiner Gartenbank abwarten, ob irgendein Notfall es erforderlich machte, dass er einspringen musste. Natürlich gab es einen Notfall. Sharon, eine Studentin, war für die Cross Guns Apartments in Nord-Dublin eingeteilt, eine ehemalige Getreidemühle, die vor einigen Jahren in teure Yuppie-Wohnungen umgebaut worden war. Einer der Yuppies stammte offenbar von einem Rottweiler ab. Jedenfalls knallte er Sharon die Tür vor den Latz und brüllte, dass sie sich ihren Fragebogen rektal verabreichen könne – er beschrieb es etwas anschaulicher. Nun musste Robert ran.
Volkszähler hassen Apartmentblocks, weil sie wie Hochsicherheitstrakte abgeschirmt sind, damit kein Unbefugter hineinkommt. Und auch kein Volkszähler. Zwar gibt es Klingeln, aber selbst wenn einem per Türöffner aufgemacht wird, kommt man nicht weiter als in ein Foyer. Die zweite Tür zum Treppenhaus kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden, doch natürlich bequemt sich niemand für einen Volkszähler nach unten.
Robert musste eine halbe Stunde warten, bis ein Bewohner nach Hause kam und er hinter ihm durch die zweite Tür schlüpfen konnte. Das bereute er sogleich. Der Rottweiler aus Apartment 61 erklärte lautstark, dass er die Tür keineswegs öffnen werde. Robert tippte auf Damenbesuch, der geheim bleiben sollte. Am Stichtag muss man sich nämlich dort in den Fragebogen eintragen, wo man sich gerade aufhält, auch wenn es ein Hotel, ein Krankenhaus oder eine Ausnüchterungszelle ist.
Robert wusste, dass bei dem Rottweiler nichts zu machen war. Macht nichts, dachte er sich, dafür gibt es ein Formblatt, und zwar mit der dringenden Aufforderung, den Fragebogen umgehend per Post zurückzuschicken. Robert schob es unter der Tür durch. Das gleiche tat er ein paar Türen weiter, wo die Volkszähler schon drei Mal niemanden angetroffen hatten. Im letzten Moment bemerkte er, dass er die irischsprachige Version des Mitteilungsblattes unter die Tür geschoben hatte. Irisch ist zwar erste Landessprache, wird aber nur noch von wenigen Menschen gesprochen. Ob er etwa auch bei dem Rottweiler...?
Er hatte. Der Mann stürzte aus der Wohnung und wedelte aufgebracht mit dem Zettel. »Ihr wollt mich wohl verarschen«, giftete er, »ich habe bei der letzten Volkszählung vor vier Jahren angekreuzt, dass ich kein Irisch kann. Glaubst du etwa, ich habe es in der Zwischenzeit gelernt?« Robert warf ihm die englische Version vor die Füße und machte sich aus dem Staub. Als er in Sicherheit war, füllte er den Fragebogen für den Rottweiler nach Gutdünken aus. Bei der Frage nach der Gesundheit trug er »Choleriker« ein.
In Anbetracht der irischen Politiker und Dienstleistungsunternehmen ist es ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis man zum Choleriker wird. Trotz Wirtschaftswachstum und Modernisierung ist Irland in vieler Hinsicht eine Bananenrepublik geblieben. Viele Politiker haben keinen anständigen Beruf ergriffen, weil sie ihr Einkommen mit Bestechungsgeldern aufbessern und bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen obendrein die Großfamilie finanziell absichern können. Und in keinem Land Europas können Unternehmen ihre Profitsucht so hemmungslos ausleben wie auf der Grünen Insel. So hat zum Beispiel die Müllabfuhr in Dublin 2008 die Gebühr still und heimlich um ein Viertel erhöht.
An der Spitze der Tabelle der unverschämtesten Firmen liegt Eircom. Die Telefongesellschaft, die 1999 privatisiert wurde, war bis 2007 die teuerste in Europa. Das reichte den Geldsäcken jedoch nicht, und so erhöhten sie flugs die Grundgebühr. Nun ist Eircom die teuerste Telefongesellschaft der Welt. Und die inkompetenteste. Um den Profit nicht durch irgendwelchen Schickschnack zu beeinträchtigen, hat man den Service komplett gestrichen.
Das wurde mir klar, als meine Telefonleitung den Geist aufgab. In der Störungsstelle sitzt kein Mensch, sondern ein Computer, der mit einem Spracherkennungssystem ausgerüstet ist. Ob ich von meinem eigenen Telefon aus anrufe? Aha, eine Fangfrage, aber ich fiel nicht darauf herein. Dann erklärte er mir, dass ein Sturm die Leitungen beschädigt habe. Aber sie verlaufen doch unterirdisch, wandte ich ein, was den Computer ärgerte, so dass er auflegte. Beim nächsten Versuch riss ich mich zusammen und redete nicht dazwischen. Die Reparaturarbeiten werden vier Tage dauern, erklärte mir die Maschine.
Nach fünf Tagen war die Leitung immer noch tot. Ich rief erneut den Blecheimer an, musste jedoch husten, woraufhin er das Gespräch beendete. Nach einem Gläschen Hustensaft ging es mir besser. Das garstige Gerät verriet, dass die Reparatur vier Tage dauern werde. Ich musste mit einer richtigen Person sprechen, das wurde mir klar.
In der irrigen Annahme, dass er mich mit jemandem verbinden würde, wenn er mich nicht versteht, schrie ich mehrmals »Fuck you«, als sich der Computer meldete, doch er begann, Eircom zu preisen. Er war durch nichts zu bremsen. Als er fertig war, legte er auf. Es ist wohl die Rache der Programmierer, die den Fuck-you-Trick kennen.
Bei meiner nächsten Anfrage schnauzte mich die kundenhassende Kiste an, dass ich für diese Nummer bereits eine Störung gemeldet habe, und legte auf. Er ist anscheinend nachtragend, ich musste mich entschuldigen. Und siehe da – er nahm meine Entschuldigung an und stellte mich zu einer Beatrice durch. Am Montag werde mein Telefon wieder funktionieren, versprach sie mir. Am Montag geschah gar nichts. Beatrice hatte gelogen.
Schlimmer war, dass wegen der Störung das Internet nur sporadisch funktionierte. So gingen mir 80 Euro durch die Lappen, weil die Verbindung zusammenbrach, als ich auf einen Geheimtipp beim Grand National wetten wollte. Von Eircom gab es kein Lebenszeichen, und vom Telefon erst recht nicht. Nur mein neuer Freund, der Computer, behauptete unverdrossen, dass der Schaden in vier Tagen behoben sein würde.
Nach vier Wochen Totalausfall von Telefon und Internet, wodurch ich täglich zu schlechter Musik im Internetcafé verurteilt war, funktionierte plötzlich alles wieder. Die Freude währte keine Woche – das Telefon gab erneut keinen Ton mehr von sich. Wenigstens tat es die Internet-Leitung noch. Die mir bereits bestens bekannte Computerstimme des Störungsdienstes versicherte wieder, dass innerhalb von vier Tagen alles gut werde. Tatsächlich tauchten vier Tage später zwei Eircom-Herren auf.
Statt sich an die Reparatur zu machen, lästerten sie über meine Telefonanlage, als ob ich sie selbst installiert hätte. Mein Einwand, dass ihre Kollegen für den Kabelsalat verantwortlich seien, quittierten die Herren mit einem verächtlichen »Hör mir bloß auf mit den Kollegen«.
Die hatten, so erklärten sie mir, meine Telefonleitung gesplittet, so dass darüber nun auch das Internet laufe. So etwas könne ja nicht funktionieren.
Hat es aber jahrelang, wandte ich ein, aber die Herren ließen das nicht gelten: »Die ganze Anlage hätte jeden Moment zusammenbrechen können.« Das sei sie ja nun auch, meinte ich und ermunterte die beiden Klotzköpfe, den Schaden zu beheben. Völlig unmöglich, bedauerten sie: Für die Verteilerbox, in der meine Leitung gesplittet sei, gebe es schon lange keine Ersatzteile mehr. Aber man habe immerhin einen Teilerfolg erzielt: Mein Internet sei einsatzbereit. Das war es auch zuvor, meinte ich.
Was sei mit dem Telefon? Das müsse endgültig abgeschaltet werden. Eine neue Leitung sei vonnöten, doch dazu müsse man die Straße aufreißen und einen Graben durch den Garten ziehen. Dann würde ich zwei nagelneue Telefonsteckdosen an der Eingangstür bekommen. Dort nützen sie mir nichts, da der Computer oben im Büro stehe. Das sei ja wohl mein Problem, meinten die Herren. Ein Kollege werde mir demnächst alles erläutern.
Der hatte leider schlechte Laune, als er drei Tage später auftauchte. Meine Frage, ob er gegen die losen Kabel, die wie ein Mikadospiel aus der Wand ragten, etwas unternehmen könne, beantwortete er mit einer Gegenfrage: »Wieso? Ich war das nicht.« Nein, es waren die Kollegen. »Hör mir auf mit den Kollegen«, winkte er ab. Offenbar herrscht bei Eircom eine kollegiale Atmosphäre. Außerdem müsse er jetzt zum Lunch, er habe seit dem Frühstück nichts gegessen. Und nach dem Lunch? »Dann habe ich Feierabend.«
Er würde zurückkommen, wenn der Graben gezogen sei – von den Kollegen. Die riefen mich eine Woche später auf dem Handy an, als ich unterwegs war. Man habe die Straße aufgerissen und einen breiten Graben durch den Vorgarten gezogen, nun könne das Kabel verlegt werden. Wann ich denn zu Hause sein werde? Ich wohne doch in Nummer 148? Nicht ganz, korrigierte ich, es sei die Nummer 128. Die Nachbarn in Nummer 148 haben in ihrem umgegrabenen Garten inzwischen Kartoffeln angepflanzt.
Auf meine schriftliche Anfrage, ob wenigstens meine Telefonrechnung für den Ausfallzeitraum reduziert werden könne, erhielt ich einen Anruf: Man habe kein Personal, um Kundenbriefe zu lesen. Ich solle das telefonisch klären. Nach tagelangen Versuchen erreichte ich einen Joe, der seinen Nachnamen nicht herausrücken wollte: Es handle sich um seinen Familiennamen, und mein Anliegen sei ja wohl keine Familienangelegenheit. Dann erklärte er mir, dass ich keine Störung gemeldet habe und daher auch keinen Preisnachlass erhalten könne.
Joe gehört der irischen Dienstleistungsmafia an, und die ist ebenso perfide, wie die Drogenmafia, doch keine der beiden Organisationen wird durch eine Fernsehfahndung gesucht. Das bleibt den gefährlichen Verbrechern vorbehalten. Der irische Ede Zimmermann heißt Brenda Power. Sie präsentiert die Sendung »Crimecall« im staatlichen Fernsehen RTE. Wie bei »Aktenzeichen XY« geht es um ungelöste Verbrechen, und davon gibt es jede Menge in Irland.
Bei der Tatwaffe, um die es diesmal bei »Crimecall« ging, handelte es sich um eine Holzlatte. Schauspieler hatten das Verbrechen aufwändig nachgestellt, ein Polizist kommentierte den Fall im Studio. Zwei Zigarettenlieferanten hatten ihren Transporter vor einer Kneipe in der Nähe der Dubliner Innenstadt geparkt. Während einer die Kippen ins Wirtshaus trug, sortierte der andere im Laderaum die Lieferung für den nächsten Kunden. Plötzlich befahl ihm ein Passant, er solle sofort aus dem Lieferwagen verschwinden. Er hielt das zunächst für einen Scherz, bis ihm der bärtige Fremde mit einer Holzlatte auf die Beine schlug. Der Zigarettenlieferant ergriff vorsichtshalber die Flucht, wurde von dem Gangster jedoch nach wenigen Metern gestellt und zu seiner Verblüffung pausenlos mit leichten Schlägen auf die Unterschenkel traktiert. Unterdessen kletterte ein Komplize in den Lieferwagen und entwendete einen Karton Zigaretten.
Dann stiegen die beiden Diebe in ihr Fluchtfahrzeug, das in zweiter Spur neben dem Lieferwagen geparkt war, und rasten davon. Weit kamen sie nicht. Nach ein paar Kilometern kollidierten sie mit einer Mauer. Das Auto ging in Flammen auf, aber die Gauner konnten ihre wertvolle Beute – den Karton Zigaretten – aus dem brennenden Auto retten. Sie liefen damit wie die Hasen über eine breite Hauptstraße und verschwanden im Phoenix Park, dem großen Dubliner Stadtpark. Danach verlor sich ihre Spur.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.