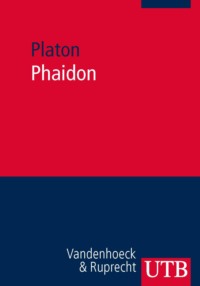Buch lesen: "Phaidon"

Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas.wuv · Wien
Wilhelm Fink · Paderborn
A. Francke Verlag · Tübingen
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Nomos Verlagsgesellschaft · Baden-Baden
Ernst Reinhardt Verlag · München · Basel
Ferdinand Schöningh · Paderborn
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlagsgesellschaft · Konstanz, mit UVK / Lucius · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen · Bristol
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Platon
Phaidon
Übersetzung von Theodor Ebert
Vandenhoeck & Ruprecht
Dr. Theodor Ebert ist Professor für Philosophie an der Universität Erlangen-Nürnberg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2014 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Printed in Germany.
Umschlaggestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
UTB-Nr. 4149
ISBN 978-3-8463-4149-0 (UTB-Bestellnummer)
Inhalt
Platon, Phaidon oder Über die Seele
Platon, Phaidon
oder
Über die Seele
ECHEKRATES: Phaidon, warst du selber an dem Tag bei Sokrates, als er im [57 a] Gefängnis das Gift getrunken hat, oder hast du es von jemand anderem gehört?
PHAIDON: Ich war selber da, Echekrates.
ECH: Was hat denn der Mann vor seinem Tode gesagt? Und wie hat er sein Leben beendet? Denn das würde ich gerne erfahren. Aus Phlius kommt zur Zeit nämlich überhaupt kein Bürger nach Athen, und von dort ist seit langem kein Besucher mehr hierhin gekommen, der uns darüber etwas [b] Genaues hätte mitteilen können, außer daß Sokrates durch das Trinken des Giftes zu Tode gekommen ist. Von den sonstigen Umständen wußte niemand etwas zu berichten.
PHAI: Ihr habt also auch nicht erfahren, wie es zu dem Urteil gekommen [58 a] ist?
ECH: Doch, das hat uns jemand berichtet, und wir waren freilich erstaunt, daß Sokrates, obwohl das Urteil schon lange gefällt war, offenbar erst viel später gestorben ist. Wie kam es dazu, Phaidon?
PHAI: Das ergab sich für ihn durch einen glücklichen Zufall, Echekrates. Zufällig war nämlich am Tag vor dem Urteil das Heck des Schiffes bekränzt worden, das die Athener nach Delos schicken.
ECH : Und was hat es damit auf sich?
PHAI: Es ist das Schiff, auf dem einst, wie man in Athen erzählt, Theseus mit den ,zweimal Sieben‘ nach Kreta fortsegelte und diese dann rettete und auch selbst gerettet wurde. Damals hatten sie nun, wie erzählt wird, [b] dem Apollon gelobt, im Fall ihrer Rettung jedes Jahr eine Wallfahrt nach Delos zu schicken. Die senden die Athener wie bisher immer so auch jetzt noch jedes Jahr dem Gott. Nun gilt aber bei ihnen ein Gesetz, daß mit Beginn dieser Wallfahrt die Stadt für diese Zeit rein zu halten ist, d. h. daß niemand von Staats wegen getötet werden darf, bis das Schiff in Delos angekommen und wieder zurück ist. Das dauert manchmal recht lange, wenn etwa Stürme sie aufhalten. Als Beginn der Wallfahrt gilt die Bekränzung [c] des Schiffshecks durch den Apollonpriester. Die aber hatte, wie ich schon sagte, am Tag vor dem Urteilsspruch stattgefunden. Deswegen war Sokrates zwischen Urteil und Tod so lange im Gefängnis.
ECH: Was ist denn aber nun über die Umstände des Todes selbst zu berichten, Phaidon? Was wurde gesagt und getan, und wer von seinen Vertrauten war bei ihm? Oder hatte die Behörde ihren Besuch verboten? Hat er etwa sein Leben getrennt von seinen Freunden beendet?
PHAI: Keineswegs. Sie waren durchaus und sogar recht zahlreich bei ihm. [d]
ECH : Über all das berichte uns doch bitte so genau wie möglich, wenn du nicht anderes zu erledigen hast.
PHAI: Nein, ich habe Zeit und will versuchen, es euch zu erzählen. Gibt es doch für mich nie etwas Schöneres als die Erinnerung an Sokrates, sei es, daß ich selber von ihm rede, sei es, daß ich jemand anderen über ihn reden höre.
ECH: Das Gleiche gilt auch für deine Zuhörer hier; versuche also, uns alles so genau, wie du nur kannst, zu berichten.
PHAI: Nun, ich selber war in seiner Gegenwart in einer ganz seltsamen [e] Stimmung. Ich empfand nämlich gar kein Mitgefühl, wie man es doch von jemandem erwarten sollte, der beim Tod eines vertrauten Menschen anwesend ist. Denn der Mann schien mir in seinem Verhalten und in dem, was er sagte, glücklich zu sein, Echekrates; beendete er doch sein Leben voller Zuversicht und festen Sinnes; daher kam ich zu der Überzeugung, daß er auch seinen Gang in den Hades nicht ohne göttliche Fügung ging und daß, wenn irgend jemand, dann er es ist, der auch im Jenseits glücklich sein würde. Deswegen empfand ich so gut wie keine Anwandlung von Mitgefühl, [59 a] wie es doch unter solch traurigen Umständen zu erwarten gewesen wäre, aber auch kein Vergnügen, obwohl wir doch wie üblich in der Philosophie waren – denn derart waren auch diesmal unsere Gespräche –, sondern ich war einfach in einer ganz seltsamen Stimmung, einer ungewohnten Mischung aus Freude und zugleich Traurigkeit bei dem Gedanken, daß er nun bald sterben müsse. Und allen Anwesenden erging es ziemlich genauso, bald lachten wir, manchmal weinten wir, ganz besonders einer von uns, Apollodoros – du kennst ihn ja wohl und seine Art. [b]
ECH : Natürlich.
PHAI: Der verhielt sich ständig so, aber auch ich selber war sehr bewegt und alle anderen ebenso.
ECH: Wer war denn alles da, Phaidon?
PHAI: Von den Einheimischen, wie erwähnt, Apollodoros, dann Kritoboulos und sein Vater Kriton, weiter Hermogenes, Epigenes, Aischines und Antisthenes; außerdem waren der Paianier Ktesippos und Menexenos und noch einige andere Einheimische da; Platon aber war, glaube ich, krank.
ECH : War von außerhalb Athens jemand da?
PHAI: Ja, aus Theben Simmias, Kebes und Phaidondes, und aus Megara [c] Eukleides und Terpsion.
ECH: Aristipp und Kleombrotos, waren die gekommen?
PHAI: Nein, es hieß, sie seien in Ägina.
ECH : War sonst noch jemand da?
PHAI: Ich glaube, das sind etwa die, die anwesend waren.
ECH: Wie weiter? Was, sagst du, waren das für Gespräche?
PHAI: Ich will versuchen, dir alles von Anfang an zu erzählen. Wir hatten es uns auch an den Vortagen schon zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig [d] zu Sokrates zu gehen, ich und die anderen, und wir trafen uns deshalb morgens am Gerichtsgebäude, in dem auch der Prozeß stattgefunden hatte. Es lag nämlich in der Nähe des Gefängnisses. Wir warteten dann jeweils darauf, daß das Gefängnis geöffnet wurde, und unterhielten uns; es wurde nämlich nicht sehr früh aufgemacht. Sobald aber geöffnet wurde, gingen wir zu Sokrates hinein und verbrachten den größten Teil des Tages zusammen mit ihm. An jenem Tag hatten wir uns noch früher getroffen; denn wir hatten am Vortag, nachdem wir abends das Gefängnis verlassen hatten, erfahren, [e] daß das Schiff aus Delos angekommen war. Wir hatten uns nun verabredet, so früh wie möglich zu unserem üblichen Treffpunkt zu kommen. Das taten wir auch, und der Türhüter, der uns immer einließ, kam heraus und sagte, wir sollten warten und nicht eher herbeikommen, bis er selbst uns dazu auffordere. „Denn die Elfmänner“, sagte er, „lassen dem Sokrates gerade die Fesseln abnehmen und geben Anweisungen dafür, daß er heute sterben soll.“ Bald darauf kam er aber wieder und rief uns herein. Im Inneren trafen wir Sokrates an, dem gerade die Fesseln abgenommen [60 a] waren, und neben ihm sitzend Xanthippe – du kennst sie ja – mit seinem Kind im Arm. Als Xanthippe uns sah, brach sie in lautes Klagen aus und sagte Dinge, wie sie Frauen zu sagen pflegen: „Sokrates, zum letzten Mal werden also deine Freunde mit dir sprechen und du mit ihnen.“ Da blickte Sokrates Kriton an und sagte: „Kriton, jemand sollte sie nach Hause bringen.“
Sie wurde dann von einigen Leuten Kritons fortgebracht, wobei sie laut wehklagte und sich schlug. Sokrates setzte sich auf seinem Lager auf, zog [b] ein Bein an, rieb es mit seiner Hand und sagte dabei: „Wie merkwürdig scheint doch das zu sein, was die Menschen angenehm nennen. Und ganz seltsam ist seine Beziehung zu dem, was als sein Gegenteil gilt, zum Schmerzlichen: Zwar wollen sich nicht beide gleichzeitig beim Menschen einstellen, wenn aber jemand das eine verfolgt und zu fassen bekommt, so ist er so gut wie immer gezwungen, auch das andere zu fassen, so als ob sie zwar zwei sind, aber doch an einem einzigen Kopf zusammenhängen. Ich denke“, sagte er, „wenn Äsop darauf aufmerksam geworden wäre, hätte er [c] eine Fabel daraus gemacht: Gott hätte die Kämpfenden versöhnen wollen, da er das aber nicht fertigbrachte, hätte er sie an ihren Scheiteln verbunden, und deswegen folgt, wenn sich bei jemandem das eine einstellt, später auch das andere. Wie es jetzt auch bei mir der Fall zu sein scheint. Weil mein Bein von der Fessel weh tat, kommt nun offenbar das Angenehme hinterher.“
Da unterbrach ihn Kebes mit den Worten: „Beim Zeus, du erinnerst mich gerade richtig an etwas. Denn nach den Gedichten, in denen du die Fabeln des Äsop in Verse gesetzt hast, und nach deiner Hymne an Apollon [d] haben mich auch andere schon und vor ein paar Tagen doch sogar Euenos gefragt, wie du darauf kommst, ausgerechnet hier im Gefängnis diese Gedichte zu verfassen, obwohl du doch früher nie gedichtet hast. Wenn dir also daran liegt, daß ich dem Euenos antworten kann, wenn er mich nochmals fragt – denn ich weiß genau, daß er mich fragen wird –, so sage mir, was ich ihm sagen soll.“
„Sage ihm also“, so Sokrates, „die Wahrheit, Kebes: Ich habe sie nicht verfaßt, um mit ihm und seinen Gedichten zu konkurrieren – denn ich wußte, das wäre nicht leicht –, sondern um die Deutung bestimmter Träume [e] zu versuchen und um meinen Fehler zu sühnen, wenn nämlich ihre wiederholten Aufforderungen mir etwa auftragen sollten, mich dieser Art von Musenkunst zu widmen. Es war nämlich so: In meinem vergangenen Leben erschien mir häufig derselbe Traum, einmal in der Gestalt, einmal in einer anderen, aber immer mit derselben Botschaft: ,Sokrates‘, sprach er, ,widme dich der Musenkunst und wirke damit.‘ Früher nahm ich immer an, daß er mich aufforderte und anfeuerte, eben das zu tun, was ich tat, und daß der Traum mich so, wie diejenigen, die die Läufer anfeuern, dazu [61 a] anfeuerte, das zu tun, was ich tat, mich der Musenkunst zu widmen, da doch wohl die Philosophie die größte Musenkunst ist und ich mich dieser widmete. Nun aber, nachdem das Urteil ergangen ist und das Fest des Gottes einen Aufschub für meinen Tod bewirkt hat, schien mir, wenn denn der Traum mir etwa immer wieder auftragen sollte, mich der Musenkunst im üblichen Sinne zu widmen, ich dürfe ihm gegenüber nicht ungehorsam sein, sondern müsse es tun. Denn es schien mir sicherer, nicht wegzugehen, bevor ich nicht auf diese Weise Sühne geleistet, Gedichte verfaßt und [b] damit dem Traum gehorcht hatte. So habe ich zunächst ein Gedicht auf den Gott verfaßt, dessen Opferfest gerade begangen wurde. Nach dem Gedicht auf den Gott sagte ich mir aber, daß der Dichter, wenn er ein Dichter sein will, Fabeln und keine wahren Darstellungen dichten müsse; und da ich selber wirklich kein Fabelerfinder bin, habe ich deshalb die Fabeln Äsops, die mir zur Hand waren und die ich kannte, so wie sie mir gerade kamen, in Verse gesetzt. Das also, Kebes, teile dem Euenos mit, richte ihm meine besten Wünsche aus und sage ihm, daß er, wenn er vernünftig ist, mir möglichst bald nachkommen solle. Ich aber gehe, wie es scheint, schon heute; denn so haben es die Athener angeordnet.“ [c]
Darauf sagte Simmias: „Sokrates, was für einen Rat gibst du da dem Euenos! Ich war nämlich oft in seiner Gesellschaft; aber nach dem zu schließen, was ich dabei gesehen und gehört habe, wird er dir freiwillig wohl kaum Folge leisten.“
„Wieso?“ fragte er. „Ist denn Euenos kein Philosoph?“
„Ich denke schon“, sagte Simmias.
„Dann wird auch Euenos das wollen und ebenso jeder, der an dieser Sache so teilnimmt, wie sie es verdient. Er wird freilich wohl nicht Hand an sich legen. Denn das, so sagen sie, ist verboten.“
Mit diesen Worten setzte er seine Beine auf den Boden, und so blieb er [d] für den Rest des Gespräches sitzen. Da fragte ihn Kebes: „Wie meinst du das, Sokrates, daß es verboten ist, Hand an sich zu legen, daß aber andererseits der Philosoph wohl dem Sterbenden folgen will?“
„Was denn, Kebes? Habt ihr, du und Simmias, über diese Dinge nichts gehört, als ihr mit Philolaos zusammen wart?“
„Nichts Genaues wenigstens, Sokrates.“
„Nun gut, auch ich kann nur vom Hörensagen darüber reden. Was ich aber durch Zufall gehört habe, das will ich nicht vorenthalten. Denn es ist ja wohl ganz passend für jemanden, der im Begriff ist, nach drüben zu reisen, [e] über den Aufenthalt dort nachzudenken und sich auszumalen, wie wir ihn uns vorstellen können. Denn was könnte man auch sonst in der Zeit bis zum Sonnenuntergang tun?“
„Weshalb sagen sie denn nun, daß es verboten ist, sich selbst zu töten, Sokrates? Ich habe nämlich, um auf deine gerade gestellte Frage zu antworten, auch schon von Philolaos gehört, als er sich bei uns aufhielt, und auch schon von anderen, daß man das nicht tun dürfe. Genaues aber habe ich darüber nie von irgend jemandem gehört.“
„Du mußt nur den Mut nicht sinken lassen“, sagte er, „denn dann wirst [62 a] du es wohl auch hören. Vielleicht kommt es dir allerdings merkwürdig vor, daß dies allein von allen Dingen ausnahmslos gelten soll, das heißt, daß es für den Menschen in diesem Fall niemals wie in anderen Fällen ist; daß es nämlich manchmal und für bestimmte Personen besser ist zu sterben als zu leben. Und es kommt dir merkwürdig vor, daß es für die Menschen, für die es besser ist zu sterben, nicht recht sein soll, sich selbst etwas Gutes zu tun, sondern daß sie auf einen anderen Wohltäter warten sollen.“
Da erwiderte Kebes mit einem leisen Lachen in seinem Dialekt: „Das mag Gott wissen.“
„Es könnte wohl den Anschein haben“, sagte Sokrates, „als ob es, so formuliert, [b] ohne vernünftigen Grund wäre. Doch es dürfte dafür wohl einen geben. Der in den Geheimlehren dafür angeführte Grund, daß wir Menschen gleichsam auf einer Wache sind und daß wir uns nicht selbst davon befreien und davonlaufen dürfen, scheint mir ein großartiger Gedanke zu sein und nicht leicht zu begreifen. Das allerdings scheint mir gut gesagt zu sein, Kebes, daß die Götter unsere Hüter sind und daß wir Menschen für die Götter eines ihrer Besitztümer sind. Oder scheint dir das nicht so?“
„Mir schon“, erwiderte Kebes.
„Würdest du nun nicht auch,“ so Sokrates, „wenn etwas, das dir gehört, [c] sich selbst umbrächte, ohne daß du es hättest wissen lassen, du wolltest seinen Tod, ihm dies sehr übelnehmen und es, wenn du eine Strafe für es hättest, bestrafen?“
„Aber sicher“, sagte er.
„Also ist es wohl doch nicht ohne vernünftigen Grund, daß man sich selbst nicht eher töten darf, als bis Gott irgendeinen Zwang herbeigeführt hat, wie jetzt in unserem Fall.“
„Das dürfte schon wahrscheinlich sein“, sagte Kebes. „Was du allerdings eben gesagt hast: ,Die Philosophen sind wohl gerne bereit zu sterben‘, das scheint absurd, Sokrates, wenn unsere letzte These gut begründet [d] war: ,Gott ist unser Hüter und wir sind sein Besitz.‘ Denn daß gerade die Vernünftigsten sich willig aus dieser Obhut wegbegeben sollten, in der sie von den besten Hütern, die es gibt, von den Göttern nämlich, gehütet werden, das ist nicht zu begründen. Denn es kann doch wohl niemand glauben, daß er besser für sich sorgen kann, wenn er aus dieser Hut befreit ist. Ein unvernünftiger Mensch würde das zwar vielleicht glauben, daß man von diesem Herrn fortlaufen müsse, und er würde nicht bedenken, daß [e] man wenigstens einem guten nicht entfliehen darf, sondern bei ihm so lange wie möglich bleiben muß, und er würde wider alle Vernunft weglaufen. Aber jemand, der bei Verstand ist, würde immer bei dem sein wollen, der besser ist als er. Auf diese Weise, Sokrates, stellt sich das Gegenteil der vorher gemachten Behauptung als wahrscheinlich heraus. Die Vernünftigen müssen sich dann nämlich gegen das Sterben sträuben, die Unvernünftigen sich darüber freuen.“
Als Sokrates das hörte, hatte ich den Eindruck, daß er sich über Kebes’ [63 a] Eifer freute, und mit einem Blick auf uns sagte er: „Kebes spürt immer Argumente auf und läßt sich nicht leicht von dem überzeugen, was jemand sagt.“
Darauf erwiderte Simmias: „Dieses Mal, Sokrates, hat Kebes aber selbst meiner Meinung nach etwas Richtiges gesagt: Denn warum sollten wirklich verständige Männer ihren Herren, die besser sind als sie, entlaufen wollen und sich leichthin von ihnen trennen? Darum scheint mir Kebes mit seinem Argument auf dich zu zielen, weil du dich so leichthin damit abfindest, uns und die Götter zu verlassen, die, wie du selber zugibst, gute Herren sind.“
„Ihr habt recht“, sagte er. „Ich glaube nämlich, ihr meint, daß ich mich [b] dagegen wie vor Gericht verteidigen soll.“
„Ja, genau das“, sagte Simmias.
„Gut denn“, so Sokrates, „dann will ich versuchen, mich vor euch überzeugender zu verteidigen als vor meinen Richtern. Denn, Simmias und Kebes, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, daß ich erstens zu anderen verständigen und guten Göttern kommen werde und zweitens zu verstorbenen Menschen, die besser sind als die in dieser Welt, dann wäre es falsch von mir, mich nicht gegen den Tod zu sträuben. Ihr sollt aber wissen, daß ich hoffe, zu guten Männern zu kommen; diesen Punkt möchte ich zwar nicht [c] mit letzter Sicherheit behaupten, daß ich aber hoffe, zu Göttern zu kommen, die sehr gute Herren sind, das sollt ihr wissen, und daß ich, wenn irgend etwas, dann diesen Punkt verteidigen möchte. Deshalb also sträube ich mich nicht gegen den Tod, sondern vertraue darauf, daß es etwas nach dem Tode gibt und daß dies, wie es von altersher heißt, für die Guten viel besser ist als für die Schlechten.“
„Was denn, Sokrates?“ erwiderte Simmias. „Hast du die Absicht, diesen Gedanken für dich zu behalten und so von uns zu gehen, oder möchtest du ihn mit uns teilen? Denn er ist, glaube ich jedenfalls, doch ein gemeinsamer [d] Besitz und auch für uns ein Gut; und zugleich ist es deine Verteidigung, wenn du uns mit dem, was du sagst, überzeugen kannst.“
„Ich will es versuchen“, sagte er, „vorher aber wollen wir uns um das kümmern, was Kriton hier, wie mir scheint, uns schon seit einiger Zeit mitteilen will.“
„Nun, Sokrates“, so Kriton, „nur dies, daß der Mann, der dir das Gift verabreichen soll, mir schon seit einiger Zeit sagt, man müsse dir klarmachen, daß du dich möglichst wenig unterhalten solltest. Er behauptet nämlich, durch zu viel Reden würde man erhitzt, man solle aber nichts tun, was das Gift in seiner Wirkung beeinträchtige. Wenn man sich nicht daran halte, so komme es manchmal vor, daß man das Gift zwei oder sogar drei [e] Mal einnehmen müsse.“
Darauf Sokrates: „Er möge uns in Ruhe lassen; er soll seine Sache so vorbereiten, daß es für zwei und, wenn nötig, auch für drei Mal langt.“
„Das habe ich mir schon gedacht“, sagte Kriton, „aber er liegt mir schon die ganze Zeit damit in den Ohren.“
„Kümmere dich nicht um ihn“, sagte er. „Aber vor euch als meinen Richtern will ich Rechenschaft ablegen für meine Überzeugung, daß ein Mann, der sein Leben wirklich in der Philosophie zugebracht hat, im Angesicht [64 a] des Todes wahrscheinlich zu Recht zuversichtlich sein und darauf vertrauen kann, daß nach seinem Hinscheiden drüben die größten Güter auf ihn warten. Wieso das so ist, Simmias und Kebes, das will ich euch klar zu machen suchen.
Es könnte nämlich gut sein, daß die übrigen Menschen gar nicht wissen, daß diejenigen, die sich richtig mit der Philosophie befassen, nichts anderes im Sinn haben als zu sterben und tot zu sein. Wenn das nun wahr ist, dann wäre es wirklich unsinnig, sein Leben lang nur darauf aus zu sein, wenn es aber soweit ist, sich gegen das zu sträuben, was das Ziel des langen Strebens und der Mühen war.“
Da lachte Simmias und sagte: „Beim Zeus, Sokrates, obwohl mir jetzt gar nicht zum Lachen zumute ist, hast du mich zum Lachen gebracht. Ich [b] glaube nämlich, daß die Leute, wenn sie das hören, der Meinung sind, daß das die Philosophen ganz treffend charakterisiert – und meine Landsleute würden dem ganz sicher zustimmen –, daß die Philosophen wirklich todessüchtig sind und den Tod, wie die Leute bei uns sehr wohl wissen, auch verdienen.“
„Und sie hätten auch recht, Simmias, nur nicht, soweit sie ihr Nichtwissen bestreiten. Sie wissen nämlich nicht, auf welche Weise die wahren Philosophen todessüchtig sind und in welchem Sinn sie den Tod verdienen und was für einen Tod. Denn wir wollen hier“, sagte er, „für uns diskutieren [c] und jene verabschieden. Wir sind doch der Meinung, daß der Tod etwas ist?“
„Allerdings“, gab Simmias zur Antwort.
„Doch wohl nichts anderes als die Trennung der Seele vom Körper? Und das Gestorbensein wäre dies, daß der Körper von der Seele getrennt worden und für sich ist und daß die Seele vom Körper getrennt für sich ist? Der Tod ist doch wohl nichts anderes als dieses?“
„Nein, sondern dieses.“
„Dann zieh folgendes in Betracht, mein Freund, falls du denn derselben Meinung bist wie ich: Denn aufgrund der folgenden Punkte werden wir, [d] glaube ich, bei den Dingen, die wir untersuchen, klarer sehen. Scheint es dir für einen Philosophen passend zu sein, sich um die sogenannten Vergnügen zu kümmern, etwa um die von Essen und Trinken?“
„Nicht im mindesten, Sokrates“, sagte Simmias.
„Und was die sexuellen Vergnügen angeht?“
„Keineswegs.“
„Und was ist mit den anderen Dingen, die dem Körper gelten? Denkst du, daß er darauf Wert legt? Etwa auf den Besitz ausgesuchter Kleidung oder Schuhe oder auf anderen Putz für seinen Körper, denkst du, daß er das hoch- oder daß er das geringschätzt, soweit es nicht eine zwingende Notwendigkeit gibt, sich darum zu kümmern?“ [e]
„Der wahre Philosoph, denke ich, wird das geringschätzen.“
„Denkst du nicht ganz allgemein, daß das Tun und Trachten eines solchen Menschen nicht seinem Körper gilt, sondern darauf gerichtet ist, sich, soweit möglich, davon fernzuhalten, und daß es seiner Seele gilt?“
„Ich denke schon.“
„Wird dann nicht an Dingen dieser Art in erster Linie klar, daß der Philosoph, [65 a] im Unterschied zu allen anderen Menschen, seine Seele soweit als möglich vom Umgang mit dem Körper löst?“
„So scheint es.“
„Aber die meisten Menschen, Simmias, denken doch, daß jemand, dem solche Dinge kein Vergnügen bedeuten und der nicht an ihnen teilnimmt, gar nicht zu leben verdiene; vielmehr sei jemand, der sich nichts aus den Vergnügen macht, zu denen uns der Körper verhilft, so gut wie tot.“
„Da hast du völlig recht.“
„Und was ist mit dem Erwerb selber der Einsicht? Ist der Körper dabei hinderlich oder nicht, wenn man ihn bei der Suche danach als Partner mit heranzieht? Ich meine zum Beispiel folgendes: Vermitteln das Gesicht und [b] das Gehör den Menschen irgendeine Wahrheit oder erzählen uns nicht auch die Dichter immer und immer wieder, daß wir nichts Genaues hören und sehen? Wenn nun aber von den körperlichen Sinnen schon diese nicht genau und zuverlässig sind, so werden die anderen es kaum sein. Denn sie sind alle schlechter als diese. Oder kommen sie dir nicht so vor?“
„Aber doch“, sagte er.
„Wann“, fragte er, „kommt die Seele nun in Kontakt mit der Wahrheit? Denn wenn sie zusammen mit dem Körper etwas untersuchen will, so wird sie offensichtlich von ihm getäuscht.“
„Da hast du recht.“ [c]
„Wenn irgendwo, wird ihr dann nicht im Rechnen etwas offenbar von dem, was ist?“
„Ja.“
„Sie rechnet aber doch am besten dann, wenn nichts von den folgenden Dingen sie beeinträchtigt: weder Sehen noch Hören noch Schmerz noch Vergnügen, sondern wenn sie so weit wie möglich ganz für sich ist, den Körper links liegen läßt und, so weit sie eben kann, ohne Verkehr und Kontakt mit ihm nach dem strebt, was ist.“
„So ist es.“
„Nicht wahr, auch hierin zeigt sich, daß die Seele des Philosophen den Körper äußerst geringschätzt und vor ihm flieht, und daß sie dagegen versucht, [d] ganz für sich zu sein?“
„So scheint es.“
„Was ist schließlich mit folgendem, Simmias: Behaupten wir, daß das Gerechte selbst etwas ist oder nichts?“
„Beim Zeus, das behaupten wir allerdings.“
„Und daß ebenso das Schöne etwas ist und das Gute?“
„Aber ja.“
„Hast du je irgendwann etwas davon mit deinen Augen gesehen?“
„Nie“, erwiderte er.
„Hast du denn etwas davon mit irgendeiner anderen körperlichen Wahrnehmung erfaßt? Ich meine das ganz allgemein, etwa Größe, Gesundheit, Kraft, mit einem Wort, das Wesen von allen Dingen, was jedes ist. Wird durch den Körper ihr wirklichstes Sein erkannt, oder verhält es sich nicht [e] vielmehr so: Wer von uns sich darauf einstellt, jeden Gegenstand seiner Untersuchung als diesen selbst intensiv und sehr genau zu durchdenken, der dürfte dessen Erkenntnis am nächsten kommen?“
„Ganz recht.“
„Wird das nun nicht derjenige am reinsten tun, der so weit wie möglich mit dem Denken selbst jeden Gegenstand angeht und dabei weder beim Denken eine optische Wahrnehmung zu Hilfe nimmt, noch irgendeine andere Wahrnehmung in sein Überlegen mit hereinzieht, der vielmehr versucht, [66 a] indem er sich des klaren, für sich genommenen Denkens bedient, jeden seienden Gegenstand als klaren und für sich genommenen zu verfolgen – unter möglichstem Verzicht auf den Gebrauch von Augen und Ohren und, kurz gesagt, des ganzen Körpers, da dieser nur Verwirrung stiftet und die Seele, wenn er mit dabei ist, nicht Wahrheit und Einsicht gewinnen läßt? Simmias, ist es nicht dieser Mann, wenn überhaupt einer, der das Seiende erreichen wird?“
„Großartig, wie du das Richtige getroffen hast, Sokrates,“ erwiderte Simmias.
„Muß sich nun nicht“, fuhr er fort, „aufgrund aller dieser Punkte bei [b] den echten Philosophen eine derartige Meinung bilden, daß sie zueinander folgendes sagen: ,Es scheint so, als würde uns und unser Denken bei der Untersuchung ein Weg in die Irre führen: Solange wir nämlich einen Leib haben und solange unsere Seele mit einem solchen Übel vermengt ist, werden wir niemals wirklich besitzen, wonach wir streben. Das aber ist, wie wir sagen, das Wahre. Denn unser Leib ist der Anlaß für tausenderlei Ablenkungen wegen der lebensnotwendigen Nahrung, und wenn sich Krankheiten [c] einstellen, hindern sie uns an der Jagd nach dem Seienden. Er erfüllt uns mit sexuellen Gelüsten, mit Begierden und Ängsten, mit allen möglichen Phantasien und unzähligen Nichtigkeiten, so daß wir, um die Wahrheit zu sagen, unter seinem Einfluß tatsächlich niemals zu irgendeiner Einsicht kommen. Denn zu Kriegen, Aufständen und Kämpfen sind nur der Leib und seine Begierden der Anlaß. Alle Kriege entstehen nämlich, um Besitz zu erwerben. Besitz zu erwerben aber sind wir unseres Leibes wegen genötigt, seinem Unterhalt als Knechte dienend. Aus all diesen [d] Gründen finden wir seinetwegen keine Muße für die Philosophie. Und was das Schlimmste ist, wenn dann einmal einer von uns Ruhe vor ihm hat und wir uns an eine Untersuchung machen, so dringt er ungebeten überall in unsere Forschungen ein, Lärm, Unruhe und Schrecken verbreitend; so sind wir unter seinem Einfluß nicht in der Lage, das Wahre ins Auge zu fassen. Aber damit ist uns wirklich gezeigt worden, daß wir uns, wenn wir jemals etwas auf reine Weise wissen wollen, von ihm trennen und mit der Seele selbst die Dinge selbst betrachten müssen. Erst dann, wenn wir von [e] hinnen gegangen sind, nicht aber solange wir leben, wird uns, wie die Rede andeutet, offenbar das gehören, worauf wir aus sind und als dessen Liebhaber wir uns bezeichnen: die Einsicht. Denn wenn es unmöglich ist, etwas im Verein mit unserem Körper rein zu erkennen, dann gibt es nur eine von zwei Möglichkeiten: das Wissen entweder niemals oder erst nach dem Tode zu besitzen. Erst dann nämlich und nicht eher wird unsere Seele [67 a] ganz für sich und des Leibes ledig sein. Solange wir aber leben, werden wir offenbar dem Wissen auf diese Weise sehr nahe kommen: Wenn wir so wenig wie eben möglich mit dem Körper irgendeinen Umgang und Verkehr haben, nur soweit es unbedingt sein muß, und uns nicht von seinem Wesen anstecken lassen, sondern uns von ihm rein halten, bis Gott selbst uns loslöst. Auf diese Weise werden wir, rein und frei von des Leibes Torheit, wahrscheinlich mit Dingen gleicher Art zusammen sein und durch uns selbst alles Klare erkennen; das aber ist wohl das Wahre. Denn nicht gebührt [b] es dem Unreinen, Reines zu berühren.‘ Solcherart muß, wie ich glaube, Simmias, das sein, was alle rechten Philosophen zueinander sagen und was sie meinen. Oder scheint dir das nicht so?“
„Vollkommen richtig, Sokrates.“
„Also, wenn das wahr ist, mein Freund“, sagte Sokrates, „dann besteht große Hoffnung für jemanden, der dorthin kommt, wohin jetzt meine Reise geht, daß er, wenn irgendwo, dann dort in vollem Maße das besitzen wird, worum wir uns im verflossenen Leben so sehr bemüht haben; daher kann die Reise, die mir jetzt aufgetragen ist, voll guter Hoffnung auch von jedem [c] anderen unternommen werden, der überzeugt ist, sein Denken rein gehalten zu haben.“
„Ganz gewiß“, sagte Simmias.
„Stellt sich dann nicht als Reinigung das heraus, was vorhin schon in unserer Argumentation zur Sprache kam, unsere Seele so weit wie möglich vom Leib abzusondern, sie daran zu gewöhnen, sich zu sammeln aus allen Teilen des Leibes und ganz für sich selbst beisammen zu sein, und, soweit sie eben kann, in der Gegenwart wie in der Zukunft allein für sich zu leben, vom Leibe wie von einer Fessel losgelöst?“ [d]
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.