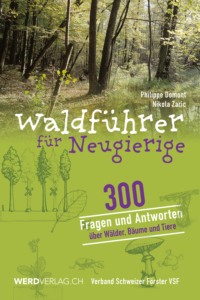Buch lesen: "Waldführer für Neugierige"
Waldführer für Neugierige
300 Fragen und Antworten über Wälder, Bäume und Tiere
Texte von Philippe Domont
Illustrationen von Nikola Zaric
Herausgegeben vom Verband Schweizer Förster VSF
Aus dem Französischen übersetzt von Revitext
Dieses Buch zum 100-Jahr-Jubiläum des Verbands Schweizer Förster VSF erschien mit finanzieller Unterstützung folgender Institutionen und Firmen: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Buwal)/Eidgenössische Forstdirektion Bundesamt für Kultur (Bak)
SGS International Certification Services AG
Verschiedene Spender zum 100-Jahr-Jubiläum des
Verbands Schweizer Förster VSF
Bürgis Forstbaumschulen
Vontobel-Stiftung
Basler & Hofmann AG
MIGROS Kulturprozent
Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
© 1999 Werd & Weber Verlag AG, CH-3645 Thun / Gwatt
7. Auflage 2016
Übersetzung: Revitext, Hans-Peter Marti, Grenchen
Foto Umschlag: Verena Eggmann /Internationales Baumarchiv, Winterthur
Foto von Philippe Domont: Susanne Keller
Layout: Manuela Krebs, Werd & Weber Verlag AG
Korrektorat / Lektorat: Michael Borter, Werd & Weber Verlag AG
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
E-Book ISBN 978-3-03922-050-2

Inhalt
Vorwort
Der Wald, Treffpunkt von Natur und Zivilisation
Waldführer für Neugierige
Vom Detail zum globalen Verständnis
Der Baum im Wald
Die Wurzeln
Der Stamm und das Holz
Alter und Grösse der Bäume
Abgebrochene und entwurzelte Bäume, Totholz
Rinde
Äste
Knospen
Blüten, Früchte und Samen
Blätter
Begleitende Waldpflanzen
Pilze und Flechten
Moose, Schachtelhalme, Farne und Frühblüher des Unterholzes
Exzetrische Holzpflanzen
Waldtiere
Säugetiere, Vögel, Amphibien
Insekten, Schnecken & Co.
Der Lebensraum des Baumes
Das Klima
Der Waldboden
Der Wald
Der Wald ohne menschlichen Einfluss
Erscheinungsbild und Entwicklung
Wald und Mensch
Geschichte einer Beziehung
Der Wald und seine Funktionen
Naturnaher Waldbau
Holzernte
Berufe im Wald
Neugier in der Praxis
Verwendung dieses Waldführers
Wie auf «Warum»-Fragen antworten?
Und wenn man die Antwort nicht kennt?
Suchaufträge im Wald
10 Regeln im Umgang mit Gruppen im Freien
Wald- und Baumrätsel
Sprichwörter ergänzen
Rücksichtsvolles Verhalten im Wald
Anhang
Bestimmungsschlüssel
Bibliografie
Interessante Internetseiten
Stichwortverzeichnis
Vorwort Der Wald, Treffpunkt von Natur und Zivilisation
Das angenehme Gefühl, «in der Natur» zu sein, genügt heute Vielen nicht mehr. Sie möchten ihre Beziehung zur Umwelt durch eine Vertiefung ihrer Kenntnisse bereichern. Ein Beweis dafür sind die zahlreichen Fragen, die von Wissbegierigen jeden Alters immer wieder im Wald oder über den Wald gestellt werden. Es sind diese Fragen, die den vorliegenden Waldführer entstehen liessen. Er soll Spaziergänger, Pädagogen und alle Waldliebhaber bei ihrer Entdeckungsreise durch die Wälder begleiten, die eine weite, in ständiger Wandlung befindliche Kulturlandschaft darstellen, wo sich Natur und Zivilisation begegnen. Dieses Werk soll eine Orientierungshilfe nicht nur im Wald selbst, sondern auch bei den sich daraus ergebenden Diskussionen sein.
Schon in den siebziger Jahren hat Jean-Louis Loutan, ein Genfer Lehrer und leidenschaftlicher Waldfreund, erkannt, dass Lernen eine Beziehung schaffen heisst. So hat er während Jahren unzählige Wald-Workshops für Schulklassen durchgeführt. Zudem hat er viele der von seinen Schülern gestellten Fragen in einer heute vergriffenen pädagogischen Broschüre gesammelt, die nun für das vorliegende Buch verwendet und ergänzt wurde. Die Fragen verraten eine ausgeprägte Neugier und eine auf dem direkten Kontakt mit dem Wald beruhende Beobachtungsgabe. Darüber hinaus haben der Wissensdurst der Erwachsenen, verstärkt durch die Diskussionen über das Waldsterben in Europa oder die Abholzung der Tropenwälder und das Prinzip der Nachhaltigkeit, zu neuen Fragen geführt, die einen grossen Teil dieses Buches einnehmen.
Der Wald, welche Fragen er auch immer aufwerfen mag, bleibt indes ein Sinnbild für Natur und Lebenskraft und darüber hinaus eine lebendige Realität mit erstaunlichem Reichtum. Die Tatsache, dass sich die europäischen Wälder heute in beispiellosem Ausmass ausdehnen, dürfte für Viele überraschend sein. Ebenso die Entdeckung, dass die Wälder manchmal trotz, oft hingegen dank des Einflusses des Menschen ein Lebensraum mit grossem biologischem Reichtum bleiben.
Unter den Werken, die von Natur, von Fauna und Flora reden, behandeln nur wenige die heutige oder vergangene Beziehung zwischen der Natur und dem Menschen. Noch seltener sind Werke, die anschaulich aufzeigen, wie sich die Natur und die Zivili-sation gegenseitig bereichern können. Denn auch wenn der Mensch in seiner (aufgezwungenen) Rolle als «Räuber an der Natur» Fehler an seiner Umwelt begangen hat, so hat er doch auch oft Wege gefunden, seinen Platz zu behaupten, ohne den eigenen Lebensraum zu zerstören. Hier bietet die moderne Waldbewirtschaftung durch naturnahen Waldbau bemerkenswerte Beispiele eines gelungenen Gleichgewichts zwischen den menschlichen Bedürfnissen und den Ressourcen der Natur. Diese Modelle nachhaltiger Entwicklung verdienen es, in allen Bereichen der Wirtschaft Schule zu machen.
Wir alle sind trotz der Komplexität des Waldes in der Lage, ihn sowohl unter dem Gesichtspunkt der Natur als auch der Bewirtschaftung zu beobachten und zu verstehen. Eine solche Kenntnis des Waldes in all seinen Aspekten ist in dem Masse wichtig, als die modernen Methoden der forstlichen Planung eine vermehrte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den Diskussionen erfordern.
Möge dieser Waldführer dazu beitragen, das Auge zu schärfen und die Diskussionen zu bereichern.
Philippe Domont
Waldführer für Neugierige Vom Detail zum globalen Verständnis
Ein Waldführer für Neugierige mit und ohne Vorkenntnisse
Dieses Buch soll diejenigen begleiten, welche die Welt der Bäume und des Waldes besser beobachten und verstehen möchten. Der Leser geht von einer Beobachtung im Wald oder einer Frage aus, die er sich stellt. Dann kann er über das Stichwortverzeichnis, die Zeichnungen oder die behandelten Fragen tiefer in die Problematik eindringen.
Ein Mittel zum Beobachten und zum Gedankenaustausch
Dieses Buch regt auch zum Gedankenaustausch an, sei es im Familienkreis, in der Schule oder unter Freunden (siehe Kapitel «Neugier in der Praxis»). Es erweitert nicht nur die Kenntnisse über die Bäume, sondern ermöglicht es auch, den Blick zu schärfen, Vorgänge aufzudecken, Veränderungen zu verstehen, in eine Dynamik einzudringen, bei der aus jeder Entdeckung wieder eine andere hervorgeht. So trägt es schliesslich zu fundierten Kenntnissen über so verschiedene Themen wie Tropenwälder, Wachstum der Bäume, Waldsterben oder Holzernte bei.
Eine Sammlung von Fragen, kein Lexikon
Es sind Fragen des Publikums, welche den Aufbau und den Inhalt des Buches bestimmt haben. Dieses ist keineswegs ein erschöpfendes Werk. Es soll vielmehr dazu anregen, neugierig zu werden oder zu bleiben, und es ist diese Neugier, die zur Fachliteratur oder zum Kontakt mit Spezialisten führen wird.
Gültig für die meisten Baumarten und Waldtypen
Die gestellten Fragen könnten sich auf irgendeinen Baum oder auf irgendeinen Wald in Mittel- oder Westeuropa beziehen. Oft ist ihre Tragweite sogar unbegrenzt, vor allem, wenn sie den Lebensablauf der Bäume oder das Ökosystem des Waldes betreffen.
Vom wahrgenommenen Detail zum globalen Verständnis führend
Der Wissensdurst der Fragesteller zeigt nicht nur das momentane Erscheinungsbild des Waldes mit einer Fülle von Details auf, sondern auch seine Dynamik über längere Zeiträume. Dieser weit reichende Überblick über Jahrhunderte hinweg ist nötig, um über den Lebensraum Wald sprechen zu können. Ein solches Vorgehen, welches die Wahrnehmung des Details mit der Gesamtsicht verbindet, gehört zum beruflichen Alltag der Forstleute. Darüber hinaus sind diese Grundsätze wegweisend für all jene, die um einen für kommende Generationen bewohnbaren Planeten besorgt sind.

Der Baum im Wald
Wäre der Baumstamm im Verlauf der Entwicklungsgeschichte nicht entstanden, so könnte sich die Vegetation lediglich zu ebener Erde ausbreiten. Ohne diese solide Transportverbindung zwischen den Blättern und den Wurzeln der Bäume müssten wir einen der schönsten Lebensräume, den die Natur eingerichtet hat, entbehren: den Wald. Die Wurzeln, die Stämme und die Kronen sind das Fundament, die Säulen und das Dach dieses forstlichen Bauwerks. In einem Wald bilden die Bäume zwischen dem Kronendach und dem Boden einen geschützten Lebensraum, reich an einer besonderen Tier- und Pflanzenwelt.
Unter dem Schutzdach der Bäume, ob Laub- oder Nadelholz, gedeiht eine vielfältige Pflanzen- und Tierwelt mit Zehntausenden von Arten. Trotz ihrer dominierenden Erscheinung sind die grossen Bäume von den kleinen Pflanzen abhängig. Zu denken ist etwa an die Tierwelt im Boden und an die Pilze, welche die Blätter und das Totholz abbauen und in Humus überführen, der wiederum die Nahrungsgrundlage für den Baum bildet. Oder an die Bedeutung der Insekten für die Befruchtung der Blüten und die Verbreitung der Samen. Oder schliesslich an die unverzichtbare Symbiose mit den «Wurzelpilzen», welche dem Baum die Wasseraufnahme aus dem Boden erleichtern.
Ein erwachsener Baum ist einer von wenigen Überlebenden aus einer Vielzahl kleiner Bäume, die im Verlauf der Jahrzehnte verschwunden sind. Wenn auf einem Waldstück hundert grosse Bäume übrig geblieben sind, heisst das, dass dort einst Millionen von Samen ausgestreut wurden, dass daraus dicht beisammen Hunderttausende von Keimlingen und schliesslich Tausende kleiner Bäume gewachsen sind. Nur diejenigen Bäume werden also erwachsen, die sich rascher entwickeln als ihre Nachbarn und die ihren Platz an der Sonne behaupten können. Dieses Streben nach Licht, eine Lebensnotwendigkeit, lässt sich gut an den glatten, früher aber beasteten Stämmen im Innern des Waldes erkennen: Nicht nur die Bäume, auch die Äste sterben ab, wenn sie zu wenig Licht bekommen.
Der Baum, der weder flüchten noch sein verletztes Gewebe ersetzen kann, ist das getreue Archiv all der Ereignisse, die er in seiner unmittelbaren Umgebung erlebt hat. Er trägt die Spuren seines Wachstums und seines Daseinskampfes, was unendlich viele Beobachtungsthemen für alle Wissensdurstigen bietet.
Der Baum im Wald Die Wurzeln
Die Wurzeln stützen den Baum und ernähren ihn zugleich. Man kann sich ihre enorme Widerstandskraft vorstellen, wenn man bedenkt, dass ein grosser Baum, der einige zehn Tonnen wiegt, wie auf einem Hebelarm von 40 Metern balanciert. Das Schauspiel der sich unter den Windstössen wiegenden Baumkronen ist faszinierend. Die physiologische Rolle der Wurzeln ist nicht minder eindrücklich, wenn man sich vorstellt, dass ein einzelner Baum während eines warmen Tages einige hundert Liter Wasser aus dem Boden pumpt und durch seine Krone verdunstet.
Für die Gesundheit des Baumes und des Waldes selbst ist also die Gesundheit der Wurzeln von grösster Bedeutung. Weil sie aus praktischen Gründen schwierig zu erforschen sind, weiss man über die Wurzeln noch wenig.
1 Wie dringen die Wurzeln in den Boden vor?
Die Wurzeln enden in feinen, zarten Wurzelspitzen. Diese vermehren die Zellen an ihren Enden durch Zellteilung und dringen so durch die Erdpartikel vor (→ 7).
Pfahlwurzeln und Flachwurzeln
Gewisse Baumarten wie die Eiche und die Weisstanne treiben solide Pfahlwurzeln, auch wenn der Boden schwer und schlecht durchlüftet ist. Die Fichte und die Espe besitzen Flachwurzeln, die eher an der Oberfläche bleiben. Die Buche und der Ahorn bilden Wurzeln, die zwischen den beiden Formen liegen.

2 Bis in welche Tiefe reichen die Wurzeln?
Die Mehrzahl der Feinwurzeln entwickelt sich in einer Schicht von 0 bis 60 (80) cm, da sie Sauerstoff benötigen (→ 99, 187). Wenn der Boden gut gelockert, nährstoffreich und durchlüftet ist, können gewisse Wurzeln bis zu zwei und mehr Meter hinunterwachsen. Ist der Boden zu wenig durchlüftet, etwa zu feucht, kann es vorkommen, dass alle Wurzeln in den obersten 20 cm konzentriert sind. Dies ist für die Standhaftigkeit des Baumes ungünstig. Betrachtet einen durch den Sturm entwurzelten Baum: Der herausgerissene Wurzelteller ist oft flach und oberflächig!

3 Ist es wahr, dass das Wurz elwerk den gleichen Raum einnimmt wie die Krone?
Nein, denn die Wurzeln sind relativ nahe an der Oberfläche. Ihr Volumen ist daher sehr viel geringer als das der Krone, die sich über zehn bis zwanzig Meter erhebt. Im Wald ist die von den Wurzeln eingenommene Fläche etwa gleich gross wie die Projektion der Krone auf den Boden. Genau wie die Äste sich um das Licht streiten, kämpfen die Wurzeln um das Wasser und die Nährstoffe. Die Wurzeln eines freistehenden Baumes hingegen können ohne weiteres über seine äussersten Äste hinausreichen.

4 Wie holen die Wurzeln die Nahrung aus dem Boden?
Die Wurzeln versorgen den Baum dank ihren Feinwurzeln mit rohem Saft (→ 9, 208). Diese «saugen» das Wasser und die gelösten Stoffe durch die Wände ihrer jungen Zellen, wobei sie von den sie überziehenden Wurzelpilzen wirksam unterstützt werden (→ 127). Die Wurzel selbst ernährt sich von dem in den Blättern aufbereiteten Saft, der durch die Rinde transportiert wird (→ 93). Die Wurzeln gewisser Bäume können den Stickstoff der Luft mit Hilfe von Knöllchenbakterien (Erle) oder mit Hilfe von Pilzen (Robinie) binden.



Mykorrhiza
(aus dem Griechischen = «Wurzelpilz»)
Unsere Waldbäume leben alle in einer engen Beziehung mit Pilzen, wie Knollenblätterpilze, Täublinge, Röhrlinge, Milchlinge, Trüffeln. Die Feinwurzeln der Bäume, welche nur wenige aufnahmefähige Wurzelhaare besitzen, sind vom unterirdischen Pilzgeflecht umgeben. Sie profitieren von diesem Filz, der ihre Austauschfläche gewaltig erhöht. Als Gegenleistung wird der Pilz durch seinen hölzernen Verbündeten mit Kohlehydraten versorgt. Man spricht von einer Symbiose, weil jeder Partner auf den andern angewiesen ist.
Dank dieser verborgenen und ausgeklügelten Verbindung findet man den Hohlfuss-Röhrling unter der Lärche, den Grünen Knollenblätterpilz vor allem unter der Eiche und der Buche sowie den Eierschwamm vor allem unter der Fichte. Einige Pilze sind sowohl Parasiten wie auch Partner: Während der Hallimasch bei den Wurzeln und den Stämmen der Nadelbäume schwere Fäulnis auslöst, ist er für diverse Orchideenarten eine Mykorrhiza.
5 Warum ist dieser Baum auf solchen «Stelzen» gewachsen?
Könnte es nicht einen verfaulten Baumstumpf unter diesen stelzenartigen Wurzeln gegeben haben? Eine kleine Fichte ist auf einem nun verschwundenen Wurzelstock gewachsen, wobei ihre Wurzeln das verrottende Holz nach und nach durchdrungen haben.
Fichtensamen keimen oft auf verrottenden Wurzelstöcken oder Baumstämmen. Die auf solchen Erhöhungen wachsenden Keimlinge haben bessere Überlebenschancen, vor allem im Gebirge (→ 196).

6 Warum sind die Wurzeln auf dieser Böschung an der Oberfläche gewachsen?
Früher waren sie im Boden, sind dann aber nach und nach infolge des abfliessenden Wassers, das die Erde wegschwemmte, an die Oberfläche getreten.

Der Baum im Wald Der Stamm und das Holz
In der Entwicklungsgeschichte der Pflanzen ist das Dickenwachstum des Stammes eine recht neue Erscheinung. So konnten die «Stämme» der Baumfarne noch nicht in die Dicke wachsen, wie dies bei den ersten Nadelbäumen, vor 300 Millionen Jahren, dann der Fall war.
Diese Zunahme in der Dicke ist dank einer feinen, zwischen dem Holz und der Rinde eingebetteten Gewebeschicht, dem Kambium, möglich. Durch die Zunahme in der Dicke gelang es den Bäumen, sich in die Höhe zu entwickeln, die anderen Pflanzen zu überragen und so das Sonnenlicht in Anspruch zu nehmen und sich über den grössten Teil der Erdoberfläche auszubreiten.
Jedes Jahr entsteht unter der Rinde ein weiterer Wachstumsring. Im Monat Mai noch ganz weich, verhärtet er sich während des Sommers und umhüllt schliesslich alle verholzten Teile des Baumes mit einer neuen Holzschicht. Da dieses Wachstum je nach Klima, Alter, Parasitenbefall und anderen Lebensumständen des Baumes verschieden ist, kann man aus den Jahrringen wie aus einem privaten Archiv die Geschichte des Baumes herauslesen. Beobachtet die am Wegrand gelagerten Stämme. Zahlreiche Geheimnisse verstecken sich unter der rauen Rinde!
7 Welcher Faktor bewirkt, dass «es wächst»?
Die Pflanzen wachsen, indem sich ihre Zellen während der Vegetationsperiode teilen. Die Bäume haben die Eigenheit, sowohl in die Länge als auch in die Dicke zu wachsen.

Längenwachstum
Der Baum wächst an seinen Endpunkten, wo sich teilungsfähige Zellen befinden (Meristeme). Unter der Erde sind es die Wurzelspitzen, die sich verlängern (→ 1). Die oberirdischen Teile wachsen bei den an den Ästen und am Wipfel sitzenden Knospen (→ Rätsel C, D).

Dickenwachstum
Der Baum nimmt an seiner gesamten Oberfläche zu, auch bei den Wurzeln und den Zweigen! Das Dickenwachstum erfolgt durch das Kambium, eine feine, aktive Zellschicht zwischen Holz und Rinde. Diese Zellen vermehren sich sowohl nach innen (Holz) als auch gegen aussen (Rinde). Darum besitzt auch die Rinde Jahrringe (→ 47, 48, 139, 215).
8 In welcher Jahreszeit wachsen die Bäume am meisten?
Die Jahrringe bestehen aus Frühholz (Anfangszone) mit einer hellen Farbe, das von April bis Juni gebildet wird, und Spätholz (Endzone) mit dunkler Farbe, das von Juli bis Oktober entsteht. Vergleicht die Breite von Früh- und Spätholz oder messt die Länge der neuen Triebe Ende Juni und Ende Oktober! Der Baum wächst im Frühling schnell. Während des Sommers festigt er die neuen Triebe und den neuen Jahrring. Im Winter befindet er sich im Ruhezustand.

9 Wo fliesst der Saft hindurch?
Von den Wurzeln steigt der rohe Saft im Splintholz, der äusseren und noch lebenden Holzschicht, aufwärts in den Baum, wobei vor allem die jüngsten Jahrringe benützt werden.
Der in den Blättern gebildete aufbereitete Saft wird durch den Bast, die innere Schicht der Rinde, in alle lebenden Teile des Baumes, bis hinunter zu den Wurzeln, transportiert (→ 4, 43, 47, Rätsel B).

Splintholz und Kernholz
Das Splintholz, das aus den frischen Jahrringen besteht, enthält Reservestoffe sowie die Leitgefässe, durch welche das Wasser und die Nährstoffe bis zu den Blättern geführt werden. Das Kernholz in der Mitte des Stammes dagegen ist völlig verschlossen. Am Stammquerschnitt gewisser Laubbaumarten (Eiche, Esche, Robinie, Ulme, Edelkastanie) sind die Leitgefässe von blossem Auge sichtbar.
Bei der Föhre, Lärche, Eiche, Edelkastanie und dem Nussbaum ist das Kernholz gefärbt und unterscheidet sich sichtbar vom Splintholz. Wenn das Splintholz der Luft ausgesetzt ist, wird es manchmal von Pilzen besiedelt, die von den darin enthaltenen Nährstoffen profitieren und dem Splintholz eine schwärzliche Farbe verleihen.

Der Saft wird gepumpt und angesaugt
Die enormen Kräfte, welche die Wassersäulen bis in eine Höhe von 50, ja sogar 100 Meter hinaufpumpen, resultieren aus verschiedenen Vorgängen. Während die Wurzeln mithelfen, die Säfte einige Meter weit durch die Leitgefässe zu drücken, ist es vor allem der Unterdruck infolge der Verdunstung in den Blättern, welcher den Saft, unter anderem in Verbindung mit den Kapillarkräften, nach oben saugt.
10 Ist es wahr, dass man den Fluss des Saftes im Stamm hören kann?
Versucht es … Die Autoren des Buches haben es bisher nicht fertig gebracht, auch mit einem Stethoskop nicht. Einige behaupten, es sei möglich. Dagegen können die Naturforscher das im Holz erzeugte Bruchgeräusch hören, wenn eine zur Baumkrone aufsteigende feine Wassersäule infolge des enormen, im Leitgefäss herrschenden Drucks unterbrochen wird (→ 7).
11 Schlafen die Bäume?
Während der Nacht ist die Fotosynthese eingestellt, weil dazu Licht erforderlich ist. Die Bäume setzen die Atmung fort, indem sie Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben. Die am Tag erzeugte Nahrung wird überall im Baum verteilt und gelagert, so «verdaut» dieser während der Nacht das, was er am Tag aufgenommen hat. Wenn man den Stammumfang auf den Zehntelmillimeter genau misst, kann dieses nächtliche Wachstum festgestellt werden. Am Morgen beginnt wieder der Assimilationsvorgang (→ 7).
12 Warum sind diese Jahrringe so breit?
Schaut, ob sich diese Jahrringe nicht an der Stelle befinden, wo der Stamm in den Wurzelstock übergeht und sich verbreitert, um so die Stabilität des Baumes zu verbessern. Vielleicht ist es auch eine Frage des Alters: Wenn ein Baum unter guten Bedingungen gewachsen ist, sind die zur Zeit der Jugend gebildeten Jahrringe im Zentrum des Stammes breiter. Es kann sich auch um Reaktionsholz handeln, das ein Baum bildet, wenn sein Gewicht nicht regelmässig auf den ganzen Stamm verteilt ist.


Reaktionsholz
Bei einem geneigten Baum ist der Druck im Innern des Stammes nicht gleichmässig verteilt. Auf der Unterseite wirkt ein gewaltiger Druck, auf der oberen Hälfte dagegen wirkt ein ebenso starker Zug. Um dem besser widerstehen zu können und den aufrechten Wuchs wieder zu erlangen, produzieren die Nadelbäume dort, wo der Druck wirkt, mehr Holz und verbreitern sich somit auf der Druckseite, während die Laubbäume genau dasselbe auf der Zugseite tun.
13 Weisen schmale Jahrringe auf eine schlechte Gesundheit hin?
Nicht unbedingt. Es ist ähnlich wie bei den Menschen: Ein geringes Gewicht ist nicht unbedingt ein Zeichen von Krankheit. Dagegen deutet eine geringere Breite der Jahrringe, wie ein Gewichtsverlust, oft auf ein Problem hin.
Ein einzelner schmaler Jahrring lässt sich durch ein trockenes oder kaltes Jahr, einen Frühlingsfrost oder Parasitenbefall erklären. Zahlreiche schmale Jahrringe sind ein Hinweis auf ein raues Klima, Lichtmangel, fortgeschrittenes Alter des Baumes, mageren oder trockenen Boden, Luftverschmutzung (→ 282, 286).

14 Warum sind die Jahrringe im Zentrum so nahe beieinander?
Im Schatten grosser Bäume bleiben Tanne und Buche schwächlich und wachsen weder in die Länge noch in die Dicke. Es sind natürliche Bonsais, die auch nach 50 Jahren weniger als einen Meter hoch sind und erst richtig zu wachsen anfangen, wenn ihr Nachbarbaum umstürzt oder gefällt wird, so dass eine Lücke entsteht, durch die Licht einfallen kann (→ 198, 287).

15 Was ist im Innern des Stammes zu sehen?

Das Innere des Stammes ist wie ein Archiv des Baumes. Es enthält die Geheimnisse seiner Jugend. Der in Rundholzstücke oder Bretter zerschnittene Stamm offenbart Spuren einst sichtbarer Dinge, die im Verlauf des Wachstums überdeckt wurden: Äste, Verletzungen, Rindenstücke (→ Rätsel C, D). Bäume an Weiderändern enthalten oft Drahtreste. Stämme aus ehemaligen Schlachtfeldern sind mit Metallsplittern durchsetzt und müssen auch heute noch in der Sägerei durch Metalldetektoren geprüft werden, damit die Sägeblätter nicht zerstört werden. Bäume aus der Umgebung von Waffenplätzen stellen ähnliche Probleme.

Spuren früherer Verletzungen, Rindenstücke
Die Stellen, wo die Rinde früher verletzt wurde (beim Holzen, durch Wildfrass oder durch das Aneinanderreiben zweier Stämme), bleiben im Holz sichtbar. Man kann an den Jahrringen erkennen, wie der Baum Jahr um Jahr die Wunde überdeckt hat (→ 50).
Ausfallende und verwachsene Äste (Knorren, «Knörze»)
Wenn ein Stamm aufgesägt oder gehobelt wird, erscheinen die alten Äste im Innern als Knorren. Wenn ein Knorren ausgetrocknet ist, spricht der Schreiner von einem ausfallenden Ast. Wenn er im Stamm gut eingelegt ist, handelt es sich um einen verwachsenen Ast (→ 264).

Harzgallen
Harz ist nicht gleich Saft. Das in einem speziellen Leitungsnetz im Holz und in der Rinde der meisten Nadelbaumarten enthaltene Harz überdeckt nackte Stellen, ertränkt Parasiten, lagert Abfallstoffe ein. Die Weisstanne besitzt kein Harz im Holz, sondern nur in der Rinde. Die Eibe hat überhaupt kein Harz.

Ein Wort zum Bernstein
Bernstein ist ein fossiles Harz, das von verschiedenen Nadelbäumen stammt, darunter Föhren, Zedern und Araukarien. Allein im Baltikum hat man dank der im Harz eingeschlossenen Nadeln acht Föhrenarten entdeckt, die sich von den heutigen Arten unterscheiden. Die Bernsteinwälder reichen 40 bis 50 Millionen Jahre zurück (→ 216).

Klangholz: ein Holz ohne Fehler
Geigenbauer wählen Holz mit regelmässigen Jahrringen, ohne eingewachsene Äste, ohne Harztaschen, ohne Drehwuchs, ohne Verletzungen … deshalb ist es so schwierig, Fichten-Klangholz zu finden. Es wird nicht nur für Geigendecken verwendet, sondern auch für Gitarren, Klaviere, Flügel, Harfen, Cembalos u. a. Man findet Klangholz ausschliesslich im Gebirge – nur dort können Bäume über lange Zeiträume regelmässig wachsen.
16 Warum sind die unteren Äste meist abgestorben?
Der Baum stösst die Äste ab, welche mehr «konsumieren als produzieren». Dies ist der Fall, wenn die Blätter oder Nadeln infolge Lichtmangels nicht genug Zucker produzieren (→ 93). Wenn diese Äste vom Baum nicht mehr ernährt werden, fallen die Blätter ab und die Äste trocknen aus.
17 Warum neigt sich dieser Baum dermassen?
Ein Baum ist geneigt, wenn er umgedrückt wurde, als er jung war (Schneedruck, Nachbarbaum, der sich auf ihn abstützte, vorherrschender Wind). Falls mehrere Bäume geneigt sind, ist oft ein Erdrutsch die Ursache. Gewisse Bäume wachsen schräg, weil sie dem Licht zustreben (Laubbäume, Föhre).

18 Warum hat dieser Baum mehrere Wipfel?
Dass die Bäume im Allgemeinen nur einen Wipfel haben, kommt daher, dass der Trieb an der Spitze ein «dominantes» Hormon produziert, das seitliche Äste nicht in die Höhe wachsen lässt. Dieses Phänomen ist besonders bei Nadelbäumen deutlich sichtbar. Bei sehr alten Bäumen ist diese Kontrolle nicht mehr so ausgeprägt. Wenn der Wipfel abbricht, vermögen untere Äste manchmal die Unterdrückung durch das Hormon zu durchbrechen und wachsen in die Höhe.

19 Warum ist dieser Baum abgewinkelt gewachsen?
Ein seitlicher Ast hat die Rolle des Stammes übernommen, weil der Wipfel durch Schneedruck, Wind oder Rindenfrass von Nagetieren zerstört wurde. Wenn zwei Äste die Ablösung übernehmen, spricht man von einem Harfenbaum, weil die Form an die beiden Arme des Instruments erinnert.

20 Woher stammt diese Beule am Stamm?
Solche Beulen, die je nach Ursache als Auswüchse, Maserknollen oder Krebsgeschwülste bezeichnet werden, lassen sich oft durch das Eindringen eines fremden Organismus (Pilz, Virus) erklären. Um sich dagegen zu wehren, produziert der Baum zusätzliches Gewebe.


Manchmal eine Zierde, oft aber problematisch
Auswüchse und Maserknollen sind aus gesundem Holz gewachsen und werden gerne für dekorative Objekte benutzt (Maserung). Krebsgeschwulst oder eine flaschenförmige Stammbasis hingegen weisen auf aufgerissenes Holz oder Fäulnis hin. Bei der Weisstanne sind Krebsgeschwülste an Ästen (Hexenbesen → 66) oder am Stamm (Rädertanne) häufig anzutreffen. Letzteres kann sogar zum Bruch des Stammes führen.

Aufblähungen an der Basis der Stämme
Unregelmässigkeiten im Wachstum finden sich häufig auch an der Basis von Laubbäumen: Mehrere zusammengewachsene Stämme deuten auf Stockausschläge hin, die gross geworden sind und mehr und mehr eingeengt wurden (→ 275). Wenn nur ein Stockausschlag überlebt hat, ist der Stamm an der Basis aufgebläht oder verwachsen.
21 Was hat diesen Stamm spiralförmig gedreht?
Er muss durch eine andere Pflanze umschlungen gewesen sein. Vielleicht findet ihr in der Umgebung ein Geissblatt. Der Stamm konnte nur zwischen den eingeschnürten Stellen wachsen (→ 150).

Der Baum im Wald Alter und Grösse der Bäume
Während wir Menschen ein Alter von einigen Jahrzehnten erreichen, geht dasjenige der Bäume in die Jahrhunderte. Mit zehn oder zwanzig Jahren stecken sie noch in der «Kindheit» und erreichen die «Jugendzeit» in den fünfziger Jahren. Eine Eiche, eine Lärche oder eine Tanne ist mit 120 Jahren «im besten Alter» und kann dies noch weitere hundert Jahre sein. Man kann bei Tannen, Eichen, Kastanien oder Eiben kaum von alten Bäumen sprechen, bevor sie nicht einige hundert Jahre alt sind und sich Zeichen des Absterbens erkennen lassen. Baumarten wie die Birke und die Schwarzerle haben im Vergleich geradezu ein kurzes Leben, werden sie doch «nur» hundert Jahre alt.