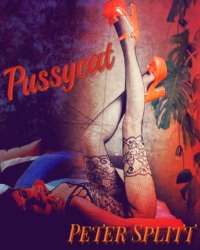Buch lesen: "Pussycat"
Peter Splitt
Pussycat
Ein erotischer Krimi aus der Zeit des kalten Krieges
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
August 1968
Oktober 2002
Oktober 1973
September 1976
Oktober 2002
Oktober 1976
Kapitel 2
Oktober 2002
Juli 1977
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Oktober 2002
März 1979
Oktober 2002
März 1979
Kapitel 6
März 1980
April 1980
Mai 1980
Juli 1980
Dezember 1980
Kapitel 7
April 1981
August 1981
September 1981
Oktober 2002
Kapitel 8
Oktober 1982
Kapitel 9
Kapitel 10
Oktober 2002
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Epilog
Kapitel 1
Impressum neobooks
Prolog
Oktober 2002
Das gleichmäßige Brummen der Triebwerke versetzte mich in eine Art Dämmerzustand. Ich lehnte den Kopf gegen das heruntergezogene Plastikrollo des ovalen Jet-Fensters und versuchte, mich zu entspannen. Ich wollte nach New York, wo ein Flieger nach Deutschland auf mich wartete. Nach vielen Jahren würde ich zum ersten Mal mein Heimatland wiedersehen. Was für ein komisches Gefühl, jetzt zurückzukehren. Wie würde es dort aussehen? Was hatte sich verändert?
Es war auch viele Jahre her, seit ich Paul zum letzten Mal begegnet war. Ich vermisste ihn noch immer. Selbst nach all den Jahren. Wo mochte er sein? Lebte er noch? Ging es ihm gut?
Ich erinnerte mich daran, wie wir uns das erste Mal geliebt hatten. Es war ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Wann immer ich daran dachte, spürte ich dieses innere Kribbeln, spürte seinen Mund auf meinen Brüsten, fühlte, wie sich seine Hände auf meinen Körper legten und sich seine Männlichkeit an mich schmiegte. Dabei blickte er direkt in mein Gesicht. Ich wusste, ich konnte, wenn ich wollte, einen richtigen Schlafzimmerblick aufsetzen, nämlich dann, wenn ich meine Augenlider bis über die obere Hälfte der Iris fallen ließ. Auch deswegen durfte ich seit meinem zwölften Lebensjahr keinem Mann mehr in die Augen sehen. Tat ich es doch, so maß er mit Sicherheit meinen noch so belanglosen Worten irgendeine sexuelle Bedeutung bei. Meine Gedanken waren immer noch bei Paul. Er knöpfte mir die Bluse auf, bevor er mich auf das große Doppelbett zog. Seltsamerweise spürte ich keine Spur von Verlegenheit, keine Scham, nur ein unbändiges Verlangen. Meine Brüste bebten, als sie freikamen. Pauls Hände berührten sie sanft. Daraufhin richteten sich meine Brustwarzen steil auf. Sein Körper reagierte umgehend. Ich sah die Erregung in seinen Augen, während er mich beobachtete. Eilig wollte er sich seiner Jeans entledigen, doch ich kam ihm zuvor, kniete mich neben ihn, schob seine Hände beiseite und begann, den Reißverschluss seiner Hose zu öffnen. Meine Finger berührten jede neue freigelegte Stelle seines Körpers. Ich spürte sein Schaudern, hörte, wie er etwas Unzusammenhängendes vor sich hin murmelte. In diesem Augenblick begehrte ich ihn wie noch niemals einen Mann zuvor. Stolz wie eine Venus baute ich mich vor ihm auf. Im Lichtschein der großen Stehlampe wirkte meine Haut makellos fein, ließ an Marmor denken. Ich spürte, wie sich Pauls Herz überschlug. Sein Atem passte sich der heftigen Bewegung meines Brustkorbes an. Unser Verlangen nacheinander wuchs mit jeder Berührung. Die Küsse wurden fordernder, die Zärtlichkeiten dringlicher. Unsere zunehmende Erregung parfümierte die Atmosphäre. Suchend, verführend, ließ ich die Lippen über seinen Körper gleiten, bis ich fühlte, wie seine Haut glühte. Danach rollte ich mich mit einer nie für möglich gehaltenen Kraft auf ihn. Bei diesem ersten Mal brauchte sich niemand von uns beiden großartig anzustrengen. Unsere Körper verstanden sich blind. Ich empfand es als äußerst angenehm, dass ich mich nicht um seine Lust kümmern musste. Sein Gesichtsausdruck gab mir zu verstehen, wie sehr seine Erregung von meinem Verlangen dirigiert wurde. Ich hörte meinen Namen, der sich von seinen Lippen losriss. Die dann folgende Vereinigung befreite mich von der Welt um mich herum, während ich meinen Körper fester und fester auf seinem bewegte. Doch dabei blieb es nicht. Nach unserem ersten Höhepunkt liebten wir uns ein zweites Mal. Diesmal kam Paul über mich, meine Lustschreie hallten in dem Gästeschlafzimmer wider. Was die anderen Mitbewohner in diesem Augenblick von uns dachten, war mir vollkommen egal. Es zählte nur dieses großartige Gefühl. Irgendwann ließen wir voneinander ab. Wir waren völlig erschöpft. Paul hob den Kopf und sah, wie mir die Müdigkeit die Augen verschleierte.
„Du wirst jetzt schlafen, Katharina!“ Es war eine Anordnung, die er mit einem Kuss bestätigte.
Oktober 2002
Dies war heute auf den Tag genau vor zwanzig Jahren geschehen, und trotzdem kam es mir so vor, als wäre es erst gestern gewesen. Mit meinen vierundvierzig Jahren war ich noch nicht alt, aber auch nicht mehr so jung und knackig wie damals. Der Zahn der Zeit und ein reichlich turbulentes Leben hatten ihre Spuren hinterlassen. Mein Haar trug ich jetzt kürzer, meine Figur war runder und irgendwie üppiger geworden. Auch Fältchen und Krähenfüße hatten sich eingestellt, obwohl ich sie mit Make-up zu überdecken versuchte. Ich wusste, meine Augen hatten den Glanz der Jugend verloren, aber trotzdem fühlte ich mich noch immer als eine attraktive Frau.
„Bitte anschnallen, wir fliegen jetzt hinaus auf den Atlantischen Ozean, und es könnte zu Turbulenzen kommen“, ertönte eine verzerrte männliche Stimme durch die Bordlautsprecher. Das Geräusch ließ mich zunächst zusammenzucken, allerdings fing ich mich schnell wieder und versuchte, mich zu beruhigen. Hier oben über den Wolken war ich allein mit meinen Erinnerungen, nahm diesen Moment der trügerischen Geborgenheit in mich auf und wollte ihn so lang wie möglich festhalten.
Doch dann, so plötzlich, wie er gekommen war, ging der Moment vorbei und ich spürte, wie eine nicht für möglich gehaltene Nervosität von mir Besitz ergriff, mich nicht mehr loslassen wollte. Allein bei den neuen Gedanken, die sich mir aufdrängten, spürte ich eine tiefe innere Unruhe aufkommen. Trotzdem schaffte ich es, der jungen Stewardess in dem dunkelblau-roten Outfit zuzulächeln, als sich diese nach meinem Getränkewunsch erkundigte. Meine Stimme zitterte in keinster Weise. Ich hatte gelernt, damit umzugehen, auch wenn es mir noch so schwerfiel. Es war so manches, was ich jetzt tun musste, von dem ich vorher geglaubt hatte, niemals dazu fähig zu sein. Diese ständigen Veränderungen, die mein bewegtes Leben mir abverlangte, sowie die vielen Schicksalsschläge, die ich wie selbstverständlich hinnahm, hatten mich letztendlich am Leben gehalten.
Die silberne Boeing 737 flog über Rhode Island hinweg und nahm Kurs auf New York. Ich traute mich zum ersten Mal, das Plastikrollo nach oben zu schieben. Die riesige Stadt versank unter mir im bleichen Dunst der Ferne, als die Maschine eine Schleife zog und langsam ihre Flughöhe verringerte. In etwas weniger als zwanzig Minuten würde sie auf dem internationalen Flughafen John F. Kennedy landen, und danach würde ich mit etwas Glück an Bord einer Lufthansa-Maschine die USA verlassen können. Das heißt, für den Fall, dass man mich nicht an der Ausreise hinderte. Bis dahin verblieben noch ein paar lange Stunden, in denen ich mich weiter lächelnd und unschuldig locker geben musste. Ich blickte hinunter auf das Land, in das ich voller Hoffnung auf eine sichere Zukunft gekommen war. Das war vor siebzehn Jahren gewesen – nachdem ich alle verraten hatte.
Wie immer war die Ankunftshalle brechend voll. Besonders lästig war die erneute Einreiseprozedur, bei der ich mein Gepäck identifizieren und wieder aufgeben musste. Ich folgte den Schildern bis zur Gepäckentnahme. An dem Rollband schnappte ich mir meinen Koffer, passierte die Einreisekontrolle und steuerte auf den Flugschalter zu. Dabei sah ich nervös auf meine Armbanduhr. Bis zum abermaligen Einchecken blieben mir noch drei Stunden. Eine verdammt lange Zeit, wenn man warten musste und der Kloß im Hals immer größer wurde. Einige Polizisten in Uniform standen herum, nahmen aber keine Notiz von mir. Aber ich wusste, dass sie da waren. Die Leute vom Geheimdienst. Irgendwo warteten sie. Ich spürte, wie ich immer nervöser wurde. Einer stand in der Nähe des Flugschalters. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Ausgerechnet dort, wo man meine Bordkarte für den Weiterflug hinterlegt hatte – und wo ich unbedingt hin musste. Der Mann wirkte teilnahmslos, seine Augen jedoch waren starr auf die Menschenmenge gerichtet. Sie überflogen jeden, der sich dem Flugschalter näherte.
Ich setzte mir die Sonnenbrille auf, obwohl das völlig verrückt war. Ich hatte mich betont lässig gekleidet. Alles hatte den Anschein, als würde ich nur eine kurze Reise unternehmen. Ich spürte einen Schubser. Jemand drückte mich von hinten vorwärts. Jetzt war ich an der Reihe, stand direkt vor dem Flugschalter. Eine freundliche Dame lächelte mich an. Ich lächelte zurück. Alles lief glatt. Problemlos bekam ich meine Bordkarte ausgehändigt. Sie stellte meinen Koffer auf die Waage.
„Möchten Sie Ihr Gepäck direkt bis Hannover durch buchen?“, fragte sie mit überlauter Stimme.
Verdammt! Musste sie so schreien, ausgerechnet jetzt?
Aber es war zu spät. Der unauffällig wirkende Beamte blickte zu mir hinüber und bewegte sich auf den Ausgang mit dem Schild Embarkation zu. „Madam, Ihre Bordkarte bitte“, sagte er höflich, aber bestimmt.
Ich hoffte, er würde nicht das Zittern bemerken, das durch meinen Körper ging. Gehorsam reichte ich ihm die Karte und machte auf lockere Konversation mit einem Nebenmann.
„Sie kommen aus Philadelphia und fliegen weiter nach Frankfurt?“, fragte der Beamte weiter.
Jetzt kam es.
„So können Sie aber nicht abfliegen“, sagte er, genau wie ich es befürchtet hatte. Der Mann mit dem kurzen Haarschnitt und dem dunklen Schnauzbart sah mich zunächst ernst an, dann aber huschte doch ein Lächeln über sein Gesicht.
„Sehen Sie, Madam. Sie haben die Ausreisesteuer noch nicht bezahlt. Dies ist ein internationaler Flug, und da werden fünfzig Dollar fällig. Die müssen sie noch begleichen. Ohne die Steuermarke auf der Bordkarte kann ich Sie leider nicht ausreisen lassen.“
Mir fiel ein Stein vom Herzen. Hatte ich richtig gehört? Diese verfluchte Ausreisesteuer! Daran hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht.
Ich schenkte ihm ein strahlendes Lächeln und griff nach dem Pappstreifen. „Wird sofort erledigt, Mister.“
Das ‚Mister‘ schien ihm zu gefallen. Ich tauchte in die Menschenmenge ein und ging zu einem der Bankschalter, wo man ein paar Devisen tauschen – und eben auch jene lästige Steuer entrichten konnte. Als ich dem Beamten kurz darauf den Karton mit der Steuermarke in die Hand drückte und ihm zunickte, grinste er breit und riss gleichzeitig den Kontrollabschnitt meiner Bordkarte ab. Danach entließ er mich in den Abflugbereich.
Nach zwei Stunden Wartezeit wurde meine Maschine nach Deutschland aufgerufen. Gate 29, Lufthansa-Flug LH 329 nach Frankfurt am Main.
Ich ging durch die Gangway und betrat den großen Airbus. Glücklicherweise befand sich mein Platz im vorderen Drittel der Maschine. Somit würde ich in Frankfurt als einer der ersten Passagiere aussteigen können. Langsam schob ich mich vorwärts und wartete geduldig, bis mir die Mitreisenden, die noch in aller Ruhe ihre Kleinigkeiten im Gepäckfach verstauten, Platz boten.
Reihe fünf – Fensterplatz, endlich!
Beim Hinsetzen blickte ich mich verstohlen um. Der Mann, mit dem ich es bereits im Flughafengebäude zu tun hatte, stand zwischen den Sitzen und beobachtete die einsteigenden Passagiere. Diese Wachmänner waren wirklich überall. Ein Seufzer stieg in mir hoch, doch ich wusste ihn zu unterdrücken. Ich lehnte die Stirn an das Fenster und glaubte, in der Ferne das Empire State Building erkennen zu können. Ein Sonnenstrahl blitzte in das ovale Fenster, worauf ich hastig das Plastikrollo nach unten zog. Erst als die Motoren brummten und endlich die Türen geschlossen wurden, fühlte ich mich einigermaßen sicher. Die Maschine fuhr auf das Rollfeld und reihte sich in die Schlange wartender Flugzeuge ein. Auf einmal knackte der Lautsprecher. Eine angenehme männliche Stimme meldete sich.
„Guten Tag, liebe Fluggäste. Mein Name ist Rheinhard. Ich bin der Co-Pilot auf Ihrem Flug nach Frankfurt. Leider wird sich der Abflug wegen des hohen Flugaufkommens um fünfzehn Minuten verspäten. Ich bitte um Ihr Verständnis und wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Ich melde mich nach dem Start wieder, wenn wir unsere Flughöhe erreicht haben.“
Es knackte ein weiteres Mal, dann verstummte der Lautsprecher. Die kleine Verzögerung war nicht weiter schlimm. Ich hatte alle Zeit der Welt, fragte mich, was mich in Deutschland erwarten würde. Siebzehn Jahre lautete die magische Zahl. Siebzehn verdammt lange Jahre war ich nicht mehr in Deutschland gewesen. In der Zwischenzeit war die Mauer gefallen. Ich hatte davon gelesen, hatte gebannt die Berichte im Fernsehen verfolgt. Für mich war der Zusammenbruch der DDR eine Sensation gewesen. Aber ich hatte auch die Anzeichen von Resignation gespürt. Wofür hatte ich all die Jahre gekämpft, meine Energie und meinen Körper eingesetzt?
Der Zweck meiner Agententätigkeit hatte darin bestanden, die Ideale, für die ich lebte, zu verteidigen. Sollten sie heute nicht mehr bestehen, dann wäre ich gescheitert. Aber falls es sie noch gab, hätte ich gewonnen. Oder hatten die anderen bloß verloren? Vielleicht fingen die Schwierigkeiten auch gerade erst an, nachdem sie die Fesseln des ideologischen Konflikts abgestreift hatten.
Wenn ich überhaupt etwas bedauerte, dann, auf welche Art und Weise ich meine Zeit und Fähigkeiten vergeudet hatte. All die Sackgassen, die falschen Freunde, die vertane Energie. Aber der Job hatte irgendwie zu mir gepasst. Wahrscheinlich war Mutter daran schuld. Oder war es dieses Buch gewesen, worin ich als Kind immer geblättert hatte? Ich wusste es nicht. Meine Vergangenheit lag viel zu weit zurück, und doch hatte sie mich diesmal eingeholt. Durch die Nachricht von Vaters Tod. Von einem Mann, den ich niemals richtig gekannt hatte.
Ich bildete mir ein, seine Stimme zu hören. Es war eine Stimme, die mir fremd war. Oder besser gesagt, ich konnte mich nicht mehr an sie erinnern, auch wenn mir die Worte vertraut vorkamen: „Komm zu mir Mariechen, komm …“
Ich stellte ihn mir vor, wie er auf der geräumigen Holzveranda unseres Hauses in einem alten Schaukelstuhl saß und gemütlich eine Pfeife rauchte. Damals hätte meine Welt noch in Ordnung sein können, aber sie war es nicht. Immerhin hatte ich noch geglaubt, dass mir niemals etwas wirklich Schlimmes widerfahren könnte. Hatte mich Vater hochgehoben, auf seine Knie gesetzt und mir dann eine nicht enden wollende Geschichte erzählt? Ich wusste es nicht, doch die Vorstellung trieb mir Tränen in die Augen, meiner Kehle entwich ein kaum hörbares Schluchzen. Aber ich wollte mir nichts anmerken lassen, wollte nicht, dass jemand erfuhr, dass ich im Begriff war, dieses Land zu verlassen, um in meine alte Heimat zurückzukehren. Das galt besonders für den finster dreinschauenden Typen in der vordersten Reihe, der direkt an der Trennwand zur Businessklasse saß. Wachsam wie ein Fuchs waren seine Augen beim Einsteigen über die Gesichter der Mitreisenden gewandert. Dabei hatte er keine Miene verzogen und versucht, mit eiskaltem Blick jede verdächtige Regung zu registrieren. Und genau daran glaubte ich, ihn erkannt zu haben. An dem ruhelos lauernden Ausdruck in den Augen. Bestimmt war er ein Mitglied der National Security, oder was vielleicht noch schlimmer war, vom amerikanischen Geheimdienst CIA, und die hatten mich mit Sicherheit noch auf ihrer Liste.
Tief unter mir glitt der Atlantische Ozean vorüber. Mir fielen die Augen zu, aber schlafen konnte ich nicht. Wie sollte ich auch, entfernte ich mich doch immer mehr von jenem Land, in dem ich in Frieden und Freiheit gelebt hatte. Fast unmerklich lichteten sich draußen die Wolken, und ein sanfter Lichtstrahl beförderte die tosende Gicht des Meers aus einem tiefen Schatten. Kleine Inseln leuchteten wie grüne Punkte in einem endlosen Blau, aber diese Schönheit der Natur nahm ich kaum wahr. Stattdessen befand ich mich in einem Zustand der Schwerelosigkeit. Ohne ein Gewicht, das mich am Boden hielt, pendelte ich zwischen gestern und morgen hin und her, losgelöst von einem Leben, an das ich mich so sehr gewöhnt hatte. Ich wusste, ich tat es für meinen Vater, den ich kaum gekannt hatte. Ich erinnerte mich nicht einmal mehr an sein Gesicht. War es leicht von der Sonne gebräunt gewesen? Hatte er intelligente Augen, einen sanften Mund, vielleicht ein Bärtchen gehabt?
Ich hatte versucht, die Fassung zu bewahren, als der Brief von seinem Tod gekommen war. Der Brief, von einem gewissen Notar Lehmann aus Göttingen aufgesetzt, hatte mich über Umwege erreicht. So einfach kam niemand an meine Adresse heran. Danach hatte ich zum ersten Mal mit Tante Ingeborg telefoniert. Obwohl ich mich bei dem Telefonat sehr bemüht hatte, meine Emotionen unter Kontrolle zu halten, musste sie sofort gespürt haben, wie nervös ich gewesen war. Beinahe vermochte ich mir das Telefongespräch nicht mehr ins Gedächtnis zurückzurufen, denn zu sehr hatte die Nachricht von Vaters Tod meine Gefühle und Sehnsüchte im Keim erstickt. Etwas begann an meinem Inneren zu nagen. Etwas, dass mich nicht mehr loslassen wollte.
Nach gut zehn Stunden Flugzeit verlor der Airbus A 320 der Lufthansa langsam an Höhe und war im Begriff, sich dem Rhein-Main-Flughafen von Frankfurt zu nähern. Ich drückte meine Nase gegen das ovale Fenster und beobachtete die Umgebung des Flughafens in der grellen Herbstsonne. Die Umstände, die zu meiner Reise geführt hatten, kamen mir jetzt fantastisch vor, und doch freute ich mich irgendwie auf die Rückkehr in meine Heimat. Die Räder des enormen Jets berührten den Boden und verursachten eine Erschütterung in der Kabine. Einige der Passagiere applaudierten, froh, wieder festen Boden unter ihren Füßen zu wissen. Das Flugzeug blieb nach einem letzten Rütteln endlich stehen, der Lärm der Motoren verstummte. Eine allgemeine Mobilität machte sich unter den Passagieren breit, als sie auf das Verlassen der Maschine vorbereitet wurden. Ich blieb noch sitzen und beobachtete die Wolken über dem Himmel der Main-Metropole. Fast kam es mir so vor, als wollten sie sagen: „Herzlich willkommen daheim in Deutschland.“
Letztendlich erhob ich mich aber doch, verließ den Flieger durch die Vordertür und folgte der Menge auf dem schmalen Gang hinüber zur Abfertigung meines Inlandsfluges nach Hannover. Die Menschenmenge sammelte sich um mich herum, aber niemand schien etwas anderes zu sein als einfach ein Reisender ohne Eile.
August 1968
August 1968
Das große Tor öffnete sich, und ich stand einfach nur da, mit einem alten Koffer in den Händen. Umgeben von hohen Mauern und Stacheldraht, dachte ich: Dies ist ein Gefängnis für Kinder, hier komme ich so schnell nicht wieder raus.
Ich trat zögerlich einen Schritt nach vorn. Jemand kam mir entgegen, schickte mich auf den Flur. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Meine fragile Blase verlangte dringend nach einer Toilette, aber hier war keine. Endlich kam eine Erzieherin. Sie trug eine Uniform. Ich wollte sie fragen, wo sich die Toilette befand, bekam aber keine Antwort. Stattdessen schrie mich die streng dreinblickende Dame an und meinte, ich solle mich an eine Wand stellen. Eingeschüchtert, wie ich war, tat ich, was sie verlangte. Dabei kniff ich die Beine zusammen und stammelte einen undeutlichen Satz vor mich hin. „Aber ich wollte doch nur … ich meine, ich muss dringend auf die Toilette.“
Statt zu antworten, schlug die Erzieherin zu. Mit einem Bambusstock auf meinen Rücken. Ich klappte zusammen. Die Erzieherin hob abermals den Stock und schlug mich erneut. Und ein drittes Mal. Ich zitterte am ganzen Leib. Dabei spürte ich, dass ich nicht mehr einhalten konnte. Meine Notdurft lief in die Hose und auf den gebohnerten Fußboden. Dafür hagelte es weitere Schläge. Und damit war noch lange nicht Schluss. Die Erzieherin zog eine Schere aus der linken Uniformtasche, drückte mich brutal nach unten und schnitt mir die Haare ab. In Sekundenschnelle lagen meine schönen blonden Locken auf dem Boden – in meinem eigenen Urin. Und der Albtraum ging weiter. Ein männlicher Erzieher brachte mich in den Waschraum. So lief das hier. Die männlichen Erzieher kümmerten sich um die Mädchen und die weiblichen um die Jungs. Das war eine Frage der Würde. Sie sollte uns Neuankömmlingen genommen werden.
Der Waschraum war feucht und kalt. Ich fror und musste mich auch noch vor dem fremden Mann entkleiden. Ich wäre am liebsten vor Scham im Boden versunken. Der Mann schmierte mich mit einem groben Scheuermittel ein und steckte mich unter die kalte Dusche. Anschließend rieb und tastete er meinen kleinen, jungen Körper ab, ehe er mich in eine Zelle steckte. Ich fühlte mich hundeelend und trotz der Behandlung mit dem Scheuermittel schmutzig. Mein Körper brannte und schmerzte, und ich war allein. Alleingelassen von meiner Mutter, von meiner Schwester, von der ganzen Welt. Dazu befand ich mich in einer Hölle, die sich Spezialheim nannte. Was hatte ich nur verbrochen, dass man mich derart bestrafte?
Nach einer Ewigkeit öffnete sich die Tür.
Vielleicht brachte man mir endlich etwas zu essen?
Weit gefehlt.
Vor mir stand derselbe Mann, der mich vorhin gesäubert und abgetastet hatte. „Meldung machen!“, verlangte er von mir.
Ich verstand nicht sofort, was er wollte. „Wie, Meldung machen?“, fragte ich vorsichtig.
„Ich denke, du solltest bereits wissen, was das ist“, antwortete der Mann barsch.
„Ich weiß nur, dass ich wissen wollte, wo sich die Toilette befindet und dafür Schläge bekommen habe“, erwiderte ich kleinlaut.
Die Antwort darauf kam prompt und beinhart.
„ Hier wird nicht gefragt! Du hast zu warten, bis du Anweisungen von den Erziehern bekommst! Du gehörst zum ‚Strandgut der Gesellschaft‘. Du bist hier, um zu lernen, Anweisungen zu befolgen, dich ein- und unterzuordnen!“
Ich sank auf die harte Matratze und fing an zu weinen.
Wo war ich? Was passierte mit mir?
Bald darauf wusste ich es. Ich war in einer Disziplinierungseinrichtung gelandet, in der man mich fertigmachen und meinen Widerstand brechen wollte. Sowohl psychisch als auch körperlich. Und das alles zum Zweck der Umerziehung zu einer ‚sozialistischen Persönlichkeit‘.
Ich betrat den Gang, fragte mich, ob es nicht besser wäre, umzukehren. Der Gang war dunkel und roch nach Feuchtigkeit. Linker Hand befand sich der sogenannte Empfang. Hier hatte ich damals Meldung machen müssen, nachdem mich der Erzieher unsanft von der Matratze gestoßen hatte. Hier waren meine Daten aufgenommen worden.
Die Tür war morsch und stand halb offen. Ich stieß mit meiner Stiefelette dagegen. Sie öffnete sich sofort. Im Inneren des Raumes lag ein umgekippter Stuhl. Sein Metallrahmen war verrostet. Das Holzregal, in dem damals die Akten standen, lag zertrümmert und in allen Einzelteilen verteilt auf dem Boden. Daneben befanden sich mehrere vergilbte Blätter. Ich bückte mich und hob eins davon auf. Es war eine Seite aus einer alten Personalakte. Auf der Vorderseite stand der Name Magdalena Zorn mit Schreibmaschine geschrieben. Ich kannte keine Magdalena Zorn. Vielleicht war das auch nur ein Deckname. Ein Pseudonym für all die vielen Leidensgenossen, die man hier eingesperrt hatte.
Was wohl mit meiner Akte geschehen sein mag?
Ich wusste es nicht.
Natürlich lief ich davon. Einmal, als der Wäschewagen kam, gelang es mir, durch das geöffnete Tor zu verschwinden. Erst danach wurde mir bewusst, dass ich keinen einzigen Ort, keine einzige Person kannte, zu der ich gehen konnte. So versteckte ich mich eine Zeit lang in einer alten Scheune. Aber Hunger und Durst ließen nicht lang auf sich warten. Ich verließ mein Versteck und versuchte, auf den Hinterhof einer Bäckerei zu gelangen. Dabei schnappten sie mich und brachten mich in ein noch stärker gesichertes Heim. Hier gab es keine Schule, sondern nur Akkordarbeit nach Norm, und nach der Arbeit militärischen Drill auf dem Hof bis zum Zusammenbrechen. Noch schlimmer waren die Demütigungen durch Erzieher und höherrangige jugendliche Insassen. Ich hielt es nicht mehr aus, versuchte erneut, zu fliehen, doch der Versuch misslang. Jemand hatte meine Fluchtpläne verraten. Dafür bekam ich die schlimmste Strafe, die es gab: tagelange Einzelhaft in dem sogenannten Fuchsbau, einer winzigen, fensterlosen Zelle ohne Behälter für die Notdurft.