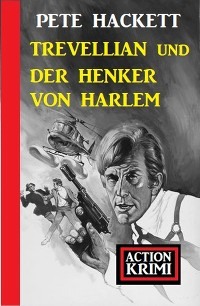Buch lesen: "Trevellian und der Henker von Harlem: Action Krimi"
Pete Hackett
UUID: 94a2f213-35fc-496c-811d-54289a08a6c9
Dieses eBook wurde mit StreetLib Write (https://writeapp.io) erstellt.
Inhaltsverzeichnis
Trevellian und der Henker von Harlem: Action Krimi
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Trevellian und der Henker von Harlem: Action Krimi
Krimi von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 128 Taschenbuchseiten.
Wer tötet Rauschgifthändler mitten in New York? Die FBI-Agents Trevellian und Tucker setzen sich auf die Spur der „Initiative rauschgiftgefährdeter Jugendlicher“, die offenbar Recht und Urteilsvollstreckung in die eigene Hand nimmt. So gute Absichten auch dahinterstehen mögen, Mord geht gar nicht! Das FBI muss Lynchjustiz verhindern.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
© Roman by Author /COVER FIRUZ ASKIN
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
postmaster@alfredbek ker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1
Es war ein regnerischer und kalter Oktobertag, als Benny Miller auf der Treppe einer Kellerwohnung in East Harlem, genauer in der East 123rd Street, an einer Überdosis Heroin starb.
Als seine Fixer-Freunde merkten, was Sache war, nahmen sie Reißaus.
Benny starb qualvoll. Das Rauschgift in seinem Körper warf ihn hin und her und schüttelte ihn. Er bäumte sich auf, erbrach sich, bekam keine Luft mehr. Der Tod kam nur langsam. Es war ein fürchterlicher Tod.
Benny war noch keine 18 Jahre alt.
Das Rauschgift hatte er von einem Dealer in Harlem gekauft, mit Geld, das er bei einem Überfall auf einen kleinen Milchladen erbeutet hatte. Es war mit Mehl gestrecktes Heroin …
Man sprach vom goldenen Schuss, den sich Benny gesetzt hatte.
Im Endeffekt aber war Benny Miller gestorben, weil sich ein skrupelloser Mafiaboss dem lukrativen Geschäft mit der tödlichen Sucht verschrieben hatte.
Es ließ sich sehr gut leben davon.
Der Name des Mafioso war Iwan Tschertschenkow.
Die Russenmafia begann sich mehr und mehr in Manhattan zu etablieren …
2
Es war Nacht in Harlem. Vor einer schummrigen Bar stand Bob Franklin, genannt „das Wiesel“. Das Wiesel war von schwarzer Hautfarbe und knapp 25 Jahre alt.
Es war nasskalt. Bob Franklin fröstelte. Eng zog er sich die imprägnierte Jacke um den Leib. Auf seinem Kopf saß eine rote Strickmütze mit einem schwarzen Streifen. Der Bursche trat auf der Stelle.
Bob Franklin wartete auf Kunden. In seinen Taschen trug er genau abgewogene Portionen Heroin, aber auch etwas Haschisch und ein paar LSD-Trips.
Das Wiesel hasste diesen Job, aber er übte ihn aus, weil er Kohle machen konnte, ohne sich die Finger zu beschmutzen oder sich den Rücken krumm zu arbeiten.
Ein Ford Mustang älterer Bauart schälte sich aus der Dunkelheit einer Seitenstraße. Mit blubberndem Motor rollte er langsam näher. Die beiden Scheinwerfer schnitten in die Finsternis wie grell-gelbe Lichtfinger. Der Asphalt schimmerte feucht. Hier und dort waren vom immer wieder einsetzenden Nieselregen kleine Pfützen zurückgeblieben. In den Rinnsteinen hatte sich abgefallenes, vertrocknetes Laub gesammelt. Ein kalter Wind zerrte an Bob Franklins gelber Regenjacke.
Bob Franklin hatte den Kopf zwischen die Schultern gezogen. Er starrte dem Wagen entgegen. Auf der anderen Straßenseite marschierte eine Gruppe lärmender Jugendlicher vorbei. Hinter Franklin war der gedämpfte Lärm aus der Bar zu vernehmen. Wenn der Lärmpegel manchmal etwas zurückging, waren Fetzen von Soulmusik aus der Jukebox zu hören. Die rot leuchtende Neonschrift über der Tür des zwielichtigen Etablissements fiel auf Franklins Rücken und warf seinen Schatten lang in die Straße.
Der Ford hielt an. Er schaukelte ein wenig und ächzte in der Federung. Das Seitenfenster wurde heruntergekurbelt. Bob Franklin konnte undeutlich ein Gesicht wahrnehmen. Es war der Beifahrer. Franklin trat einen halben Schritt näher.
„Hi, Bob“, kam es aus dem Auto.
„Hi, Serikow“, versetzte Franklin. „Was gibt‘s?“
„Läuft das Geschäft?“
„Noch nicht so gut. Aber das kommt noch. Jetzt tanzen und schmusen sie noch da drin.“ Bob Franklin wies mit dem Daumen über seine Schulter. „Aber bald werden Sie mehr wollen. Dann brauchen sie ihre Trips …“
Er grinste. Auf seinem großen, weißen Gebiss spiegelte sich das Licht der Straßenlaterne auf der anderen Straßenseite.
„Der Chef will dich seh‘n. Steig hinten ein.“
Auf der anderen Straßenseite verschwanden die Jugendlichen in einer stockfinsteren Gasse. Es gab dort keine Straßenbeleuchtung. Das hier war die finsterste Gegend Harlems. Und die kriminellste …
Franklins Grinsen gefror. „Er selbst?“, entfuhr es ihm überrascht. „Sonst schickt er doch nur jemanden von euch, wenn‘s was zu reden gibt.“
„Nun, heute will er persönlich mit dir sprechen.“
„Was will er denn? Hab mein Zeug immer ordentlich verkauft und abgerechnet.“
Bob Franklin schien nervös zu werden. Er kaute auf seiner Unterlippe herum, schaute sich gehetzt um. „Der Platz hier ist gut, Leute. Wenn ich jetzt verschwinde, dann …“
„Steig ein!“, kam es schroff und ungeduldig aus dem Ford.
Franklin hüpfte von einem Bein auf das andere, als hätten sich unvermittelt seine Schuhsohlen stark erhitzt. „Ich …“ Er brach ab. Jedes weitere Wort wäre vergeudet gewesen. Franklin wusste, was die Stunde geschlagen hatte. Er entschloss sich jäh. „Zur Hölle mit euch. Ihr könnt mich mal!“
Mit dem letzten Wort warf Bob Franklin sich herum und ergriff die Flucht.
Die Türen des Ford flogen auf. Fahrer und Beifahrer nahmen fluchend die Verfolgung des Schwarzen auf.
Doch Bob Franklin wurde nicht umsonst „das Wiesel“ genannt. Er gewann zusehends an Vorsprung. Manchmal warf er einen schnellen Blick über die Schulter nach hinten. Dann schnellte er plötzlich nach rechts und verschwand zwischen den Häusern. Er flitzte die Gasse hinunter, als säße ihm der Leibhaftige im Nacken. Der Weg war leicht abschüssig. Er rannte um sein Leben. Denn keiner der kleinen Dealer wie er, die die zweifelhafte Ehre bekommen hatten, den Boss persönlich zu Gesicht zu bekommen, ist je wieder lebend aufgetaucht. Man fischte sie aus dem East River oder fand sie außerhalb der Stadt auf einer Müllhalde.
Sie waren zum Tode verurteilt und zu ihrer Hinrichtung gebracht worden. Gnade kannte das Syndikat nicht.
Hinter Bob Franklin hämmerten die Absätze seiner Verfolger auf den Betonplatten des Gehsteiges. Wenn er zurückschaute, konnte er sie schemenhaft wahrnehmen.
Die Angst peitschte Bob Franklin vorwärts. Sie verlieh ihm Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. Aber sie machte ihn auch unachtsam.
Es war eben sein Pech, dass im Pflaster des Gehsteiges an verschiedenen Stellen Betonplatten fehlten. In eines dieser Löcher trat Franklin. Rasender Schmerz von seinem Knöchel zuckte hinauf bis unter seine Gehirnschale, er strauchelte, ruderte mit den Armen, konnte seinen Sturmlauf nicht mehr abbremsen und krachte der Länge nach auf den steinharten Boden. Sein Mund klaffte auf, unwillkürlich brüllte er Angst und Schmerz hinaus.
Franklin kam nicht mehr hoch. Er lag auf allen vieren, als ihn seine beiden Häscher erreichten. Seine Hände waren vom Sturz aufgeschürft, seine Knie aufgeschlagen. Er blickte an den beiden Kerlen in die Höhe, und sie kamen ihm aus dieser Perspektive unheimlich groß und wuchtig und ausgesprochen bedrohlich vor. Die Dunkelheit hier in der Gasse verhüllte ihre Gesichter. In der Hand des einen glaubte Bob Franklin eine schwere Pistole wahrzunehmen.
Das Wiesel erschauderte. Seine Zähne schlugen aufeinander.
„Was wollt ihr denn von mir?“, keuchte es entsetzt.
Der eine der beiden versetzte ihm einen leichten Tritt. „Das haben wir dir doch gesagt, Nigger! Wir sollen dich zum Chef chauffieren.“
Der Bursche sprach einen harten Akzent, was verriet, dass er kein gebürtiger Amerikaner war.
„Steh auf. Und jetzt keine Mätzchen mehr, mein Freund, sonst holt dich der Teufel.“
Er half Franklin auf die Beine. Dabei fasste er ihn nicht mit Samthandschuhen an. Er packte das Wiesel einfach beim Genick und zerrte es brutal in die Höhe.
Franklin zitterte. Seine Knie waren butterweich. Er musste zweimal ansetzen, dann entrang es sich ihm: „Bitte, Leute, lasst mich laufen. Sagt dem Boss, ihr habt mich nicht erwischt. Erzählt ihm …“ Er verschluckte sich und musste husten. Wie ein Erstickender japste er nach Luft.
„Du kackst dir ja richtig in die Hose, Nigger“, stieß einer der beiden verächtlich hervor. „Als ich dich vor wenigen Tagen sah, da warst du richtig cool drauf. Hast du etwa ein schlechtes Gewissen?“
„Ich … Ihr … Schlechtes Gewissen – nein. Ich war immer einer der besten Verkäufer und …“
„Bis jetzt, Franklin“, kam es sanft. „Aber dann hast du angefangen, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Du hast guten Stoff abgezwackt und die Portionen, die du verkauft hast, mit Mehl gestreckt. Ein Junkie ist daran verreckt. Und wahrscheinlich war das nicht der letzte. Das können wir uns nicht leisten, Franklin. Damit ruinierst du uns das Geschäft.“
„O mein Gott“, schrie das Wiesel. „Niemals habe ich so was getan. Ihr müsst mir glauben. Ich käme niemals auf die Idee, den Boss zu betrügen. Wie kommt er darauf, dass ich …“
„Frag ihn selbst, Franklin. Und erzähl ihm dann deine Story. Aber jetzt schwing die Hufe! Hurtig, hurtig, mein schwarzer Freund. Oder müssen wir dir ein Feuer unter den schwarzen Arsch schüren?“
Bob Franklin taumelte vorwärts. Seine Beine vermochten ihn kaum zu tragen. Er hatte Angst, jämmerliche, hündische Angst – Todesangst. Denn er ahnte, was ihm bevorstand.
Sie bugsierten ihn in den Ford. Er musste auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Hinter ihn setzte sich der Kerl mit der Pistole. Er drohte: „Mach nur keine Zicken, Wiesel. Der Chef hat sicher nichts dagegen, wenn wir dich ihm tot vor die Füße legen.“
Bob Franklin wurde von einer Woge des Grauens durchlaufen. Er spürte Gänsehaut. Und es war nicht nur die Kälte, die von außen kam, die ihn frösteln ließ.
3
Sie brachten Bob Franklin nach Midtown, in die Nähe der St. Patricks Cathedral, und hier wurden ihm die Augen verbunden. Von nun an merkte er nur noch, dass es kreuz und quer durch New York ging. Einmal vernahm er das Heulen einer Schiffssirene, er wusste aber nicht, ob der Kahn auf dem East River oder auf dem Hudson River fuhr.
Endlich hielt der Wagen. Der Motor wurde abgestellt. Franklin wurde die Augenbinde abgenommen. Sie befanden sich in der tintigen Finsternis eines Hinterhofes. Ringsum sah Franklin nur mehrstöckige Wohn- und Geschäftshäuser.
„Aussteigen!“, wurde er angeherrscht.
In seinen Eingeweiden rumorte die Angst. Im Fegefeuer seiner Empfindungen konnte er keinen klaren Gedanken fassen. Mechanisch langte er nach dem Türgriff. Die Tür schwang auf. Die Innenbeleuchtung des Wagens ging an. Franklins Mund war trocken wie Wüstenstaub, sein Hals wie zugeschnürt.
Der Bursche, der im Fond gesessen hatte, nahm ihn draußen in Empfang. Franklin spürte den unerbittlich harten Druck einer Kanone auf seiner Niere.
Der Fahrer schob seine riesenhafte Gestalt aus dem Auto. Seine Tür schlug zu.
„Marsch!“, kommandierte der Mister mit dem Schießeisen. Im Vorbeigehen warf er die Tür der Beifahrerseite ebenfalls zu. Nach einigen Schritten flammte Licht auf. Ein Bewegungsmelder hatte die Treppenhausbeleuchtung und das mit dieser gekoppelte Hoflicht eingeschaltet. Geblendet schloss Franklin die Augen.
Derjenige, der den Ford gesteuert hatte, öffnete die Haustür. Der andere verstärkte seinen Druck mit der Beretta auf Franklins Nierengegend. Franklins Zähne schlugen zusammen wie im Fieber. Sein Herz raste. So konnte nur einem Mann zumute sein, wenn er in die Gaskammer oder zum elektrischen Suhl geführt wurde.
Sie dirigierten ihn in den Keller hinunter. Es gab dort einen erleuchteten Flur, von dessen beiden Seiten einige Türen in irgend welche Räume führten. Die Wände waren schmutzig und mit allen möglichen Sprüchen und Parolen beschmiert. Die Schritte seiner Begleiter hallten in dem leeren Korridor. Schließlich wurde Franklin in einen Raum auf der linken Seite gedrängt.
Und hier empfing ihn grelles Neonlicht. Ein Tisch stand da, vier Stühle, an einer Wand sah Franklin einen alten Rollschrank mit abgerissener Jalousie. Die Fächer waren leer. Daneben befand sich eine alte Anrichte.
Er wurde wortlos auf einen der Stühle gedrückt. Einer der beiden Kerle, die ihm Furcht einflößten, holte aus der Anrichte eine dünne, aber widerstandsfähige Schnur und fesselte Franklin auf dem Stuhl fest. Er knebelte ihn. Als es Franklin von dem Knebel hob und ihm weit die Augen aus den Höhlen traten, lachten sie schallend.
„Lass dir die Zeit nicht lang werden, Nigger“, knurrte der mit der Beretta ohne jede weitere Gemütsregung, dann drehten sie das Licht aus und verschwanden. Über Franklin schlug absolute Finsternis zusammen. Er hörte, wie sich auf der anderen Seite der Tür der Schlüssel knirschend drehte, dann wurde er abgezogen.
Franklin begann, an seinen Fesseln zu zerren. Der Knebel erstickte ihn fast. Aber die Fesseln hielten, und der Knebel ließ sich nicht herausstoßen.
4
Ein Mann näherte sich dem „Maxim“. Das Maxim war ein Junkie-Treff mitten in Harlem. Es ging auf Mitternacht zu. Ein Schwarzer in Jeans und Turnschuhen und einem gestrickten, abenteuerlich farbigen Mantel stand etwas abseits, ein ganzes Stück vom Rand des Lichtscheins entfernt, in einer Gruppe von Jugendlichen. Es waren Burschen und Girls. Hauptsächlich Schwarze.
Der Mann trug seinen Hut tief in der Stirn, die Hände hatte er tief in den Taschen seines Trenchcoats vergraben. Die Enden des Gürtels waren nicht zusammengebunden, sondern hingen lose an den Seiten des Mannes nach unten.
Er durchquerte den flackernden Lichtschein. Er hatte ein schmales, kantiges Gesicht, seine Lippen waren zusammengepresst, in den Mundwinkeln hatten sich dunkle Kerben gebildet. Er war Mitte 50, und er war weiß.
Ohne im Schritt zu stocken näherte er sich der Gruppe um den Burschen mit dem schreiend-farbigen Wollmantel, der in diesem Moment von einem der Jungs einige Dollarscheine entgegennahm und sie schnell in der Manteltasche verschwinden ließ. Er griff unter den Mantel, da sah er den Ankömmling. Seine Hand fiel nach unten. Misstrauisch fixierte er den Weißen.
Der blieb zwei Schritte vor der Gruppe stehen. Mit klarer, präziser Stimme sagte er: „Kinder, lasst die Finger vom Rauschgift. Jagt den dreckigen Dealer im bunten Mantel zum Teufel und kehrt um auf eurem sicheren Weg in die Hölle. Dort werdet ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit landen, wenn ihr das Teufelszeug nehmt.“
Einige der jungen Leute lachten.
Der Schwarze im Wollmantel drängte sich mit tänzelnden Schritten durch sie hindurch, umrundete den Weißen einmal, dann grinste er ihm ins Gesicht: „Wer bist du denn, Opa? Ein Prediger, ein selbsternannter Apostel, der irgend welche verirrten Schäfchen auf den Pfad der Tugend zurückbringen möchte?“
„Ich gehöre der Initiative rauschgiftgefährdete Jugendliche an, einer Selbsthilfeorganisation, die verirrte Schäfchen, wie du es so schön ausgedrückt hast, und ihre verzweifelten Eltern betreut, ihnen hilft und …“
„Aaah, ein Samariter bist du also. Heh, Opa, willst du dir damit den Weg in den Himmel freischaufeln? Oder machst du dich nur wichtig? – Verschwinde, bevor dich Floyd Tanner in den Arsch tritt. Du bist hier im verkehrten Film.“
„Wer ist Floyd Tanner?“, fragte der Mann im Hut furchtlos.
„Na, wer wohl, Opa? Ich bin das. Heh, Mann, ich werde dich mit einem fetten Tritt nach Hause schicken.“
Er fing wieder an, um den Mann im Trenchcoat herumzutänzeln. Er gehörte zur ganz besonders coolen Sorte. Die Jugendlichen amüsierten sich, stießen sich an und machten zotige Bemerkungen. Sie verhöhnten den Weißen.
Dieser drehte sich auf der Stelle. Er ließ Floyd Tanner nicht aus den Augen. Floyd Tanner fintete, hüpfte und zog eine aus seiner Sicht recht beeindruckende Show ab.
Der Mann im Trenchcoat aber zeigte nicht die Spur einer Gemütsregung. Er stieß rasselnd hervor: „Ihr Dealer seid schlimmer als die Pest im Mittelalter. Noch schlimmer aber sind die, die hinter euch stehen. Sie verdienen sich eine goldene Nase, und ihr kleinen Lichter seid nur ihr williges Werkzeug. Ihr geht über Leichen, euch ist nichts heilig. Aber die Strafe wird euch alle treffen. Ob Drahtzieher oder Straßenverkäufer wie dich. Denk über meine Worte nach, Junge, ehe es für dich zu spät ist.“
„Kleine Lichter – williges Werkzeug – Strafe“, echote der Neger. „Bist du‘n Bulle, weil du von Strafe redest? Ein verdammter Policeman? Ein predigender Cop? – Heh, Mann, verdufte, ehe ich wirklich zornig werde.“
Der Mann im Trenchcoat beachtete ihn nicht weiter. Sein Blick heftete sich auf die Gruppe der Jugendlichen. „Lasst die Finger von dem Teufelszeug, Leute. Ich weiß, wovon ich rede. Es reißt euch in den Abgrund. Und von dort gibt es kaum mehr ein Zurück. Die Nervenheilanstalt oder der Tod warten auf euch.“
Er machte abrupt auf dem Absatz kehrt und marschierte davon.
Floyd Tanner rief lachend: „Ihr lasst euch doch von dem Schwätzer nicht ins Boxhorn jagen, Leute. Also kommt her, damit wir das Geschäft abschließen. Der gute Floyd Tanner hilft euch, den Tiefen des Lebens zu entfliehen und himmelhochjauchzende Sphären zu erklimmen.“
Etwa drei Stunden nach Mitternacht hatte Tanner seinen Stoff verkauft. Er machte sich auf den Heimweg. Er tanzte, sang vor sich hin, steppte um eine Straßenlaterne herum und war voll überschäumender Zufriedenheit. In seiner Manteltasche knisterte ein dicker Packen Dollarscheine. Zehn Prozent gehörten ihm.
Tanner erstarrte jedoch, als hinter einem parkenden Lastwagen der Mann im Trenchcoat hervortrat. Der Schwarze erkannte ihn sofort. Er wollte etwas sagen, spürte die Bedrohung die von dem anderen ausging, aber da erklang schon die Stimme des Weißen. Sie klang fast traurig:
„Ich warnte dich doch, mein Junge. Sagte ich nicht, die Strafe wird euch alle treffen. Du hättest wirklich über meine Worte nachdenken sollen. Jetzt ist es zu spät.“
Der Mann zog seine Rechte aus der Manteltasche.
Seine Faust umspannte eine schwere Pistole.
Eine jähe Blutleere im Gehirn ließ Floyd Tanner wanken. Er streckte dem Mann seine Hände entgegen, als hätte er damit die Kugel abwehren können.
Aber die Kugel traf ihn mitten in die Brust. Tanner hörte noch den verschwimmenden Knall, dann erloschen in seinem Kopf die Lichter. Tot fiel er neben dem Lastwagen auf den Gehsteig.
Der Mann im Trenchcoat verschwand wie ein Schatten in einer Gasse.