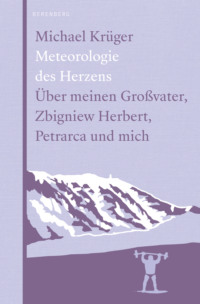Buch lesen: "Meteorologie des Herzens"


Michael Krüger
Meteorologie
des Herzens
Über meinen Großvater,
Zbigniew Herbert,
Petrarca und mich
Mit einem Nachwort von Matthias Bormuth

Wo ich geboren wurde
Es gibt noch eine andere Welt
Gespräch mit Matthias Bormuth
Ein Ich das querliegt zur Welt
Zur Frühgeschichte des Petrarca-Preises
Es gibt keine glückliche Insel
Zbigniew Herbert In Erinnerungen und Briefen
Nachwort
Wo ich geboren wurde
1.
Mein Großvater konnte über hundert Vögel
an ihren Stimmen erkennen, nicht gerechnet
die Dialekte, die in den Hecken gesprochen wurden,
dunklen Schulen hinter dem Hof,
wo die Braunkehlchen Aufsicht hatten.
Mein Großvater war Spezialist für Kartoffeln.
Mit den Händen grub er sie aus, zerbrach sie
mit den Daumen, die weiß wurden,
und ließ mich an der Bruchstelle lecken.
Mehlig, gut für Schweine und Menschen.
Auch nach der Enteignung wollte er unbedingt
an Gott glauben, weshalb ich die Kartoffeln
ausbuddeln mußte aus seinem ehemaligen Acker.
Wie auf holländischen Bildern zogen
schwere Wolken über den sächsischen Himmel,
sie kamen aus Rußland und Polen
und fuhren nach Westen, ihre Fracht wurde leichter,
durchsichtiger und feiner, bis sie in Frankreich
als Seide verkauft wurde. Im Westen, sagte er,
finden Verwandlungen statt, wir werden verwandelt.
Im Dorf fehlten einige seiner Freunde,
die mußten in Rußland die Wolken beladen.
2.
Meine Großmutter benutzte die Brennschere,
um ihre dünnen Haare zu wellen. Man muß
dem Herrgott ordentlich frisiert gegenübertreten.
Der kam meistens nachts, wenn ich schon
schlafen sollte, setzte sich auf den Bettrand
und unterhielt sich mit ihr auf sächsisch.
Beide flüsterten, als hätten sie ein Geheimnis.
Manchmal waren sie freundlich zueinander,
dann wieder zankte sie mit ihm wie
mit dem Großvater, wenn der sein Glasauge
neben den Teller legte. Wenn man es falsch herum
einsetzt, kann man nach innen sehen,
in den Kopf hinein, wo die Gedanken leben,
sagte er und stopfte seine Pfeife mit Eigenbau,
der neben dem Tisch an der Wand hing, labbrige Blätter,
von einem Faden durchzogen. Die Ärmel der Joppe
des Großvaters waren von Brandlöchern genarbt.
Wie deine Lunge, sagte die Großmutter, beides
aus braunem Stoff. So vergingen die Tage.
Abends gab es Kartoffeln mit Sauce oder ohne.
Wenn auf dem Hof geschlachtet wurde, fand ich
Wellfleisch auf meinem Teller, aber ich durfte nicht
fragen,, wie es zu uns gefunden hatte.
Wellfleisch kann fliegen, damit war alles gesagt.
Ich stellte mir Gott als einen Menschen vor,
der alles mit sich machen ließ.
3.
Mein Großvater las nicht mehr. Alle Bücher stehen
in meinem Kopf, sagte er, aber ganz durcheinander.
Dafür erzählte er gerne, am liebsten vom König,
der sich angeblich für ihn interessiert hatte.
Auf der Jagd sollte er ihm einen Hasen
vor die Flinte treiben, aber der Großvater hatte
das Tier unter seinem Mantel versteckt.
Ich kann noch heute das Hasenherz schlagen hören,
rief er und faßte sich an die Stelle, wo seine Uhr
hing. Hasen haben ein schlechtes Herz,
damit kann man keinen Staat machen. Vom Staat
war nicht viel zu erwarten. Wenn die Großmutter
nicht im Zimmer war, hörten wir Radio, messerscharfe
Stimmen, die den Rauch seiner Pfeife zittern ließen.
Saubande, sagte mein Großvater, der sonst nie
fluchte. In der Nähe von Beromünster war die Musik
zu Hause, da fahren wir eines Tages hin, sagte er,
und hören Bach und Tschaikowsky. Dann schlief er ein.
Das Lid über seinem Glasauge war nie ganz geschlossen.
4.
Als ich mein Dorf kürzlich besuchte,
fiel mir alles wieder ein, nur ungeordnet:
der Kunsthonig und der schwarze Sirup, der sämig
durch die Löcher im Brot tropfte, die fauchenden Feuer
über Meuselwitz, die kyrillischen Gewehre im Steinbruch
von Keyna, der Kohlenstaub, Warmbier, der ängstliche Gott,
der schnatternde Alarmruf des Wiedehopfs,
die puckernden Flüsse auf dem Handrücken des Großvaters,
der blaue Teppich unter den Pflaumenbäumen,
die Eselsohren in der Bibel, die fromme Armut,
das Glück. Auch die Toten redeten mit, von fern her
angereist in altmodischen Kleidern, die Frauen
mit Haarnetzen, die Männer in gewendeter Uniform,
mit Schußlöchern auf der eingefallenen Brust.
Und in der Mitte mein Großvater, ein Auge auf die Welt
und eines nach innen gerichtet, vor sich ein Teller
Kartoffeln, mehlig und buttergelb, gut für Schweine
und Menschen und mich.
5.
Das alles bin ich, der Mann mit dem Hasenherz.
Nicht mehr, eher weniger.
Es gibt noch eine andere Welt
Gespräch mit Matthias Bormuth
MATTHIAS BORMUTH: Herr Krüger, Sie haben einmal von sich gesagt: »Ich bin ein Schriftsteller, der einfachen Verhältnissen entstammt und das Verlegen der Bücher auch als Handwerk betrachtet.« Diese Selbstbeschreibung verdankt sich nicht zuletzt den ersten Lebensjahren, die Sie bei Ihren Großeltern verbrachten.
MICHAEL KRÜGER: Das Bestellen eines Ackers und die Leitung eines Verlages haben vieles gemeinsam. Auch der Bauer träumt natürlich davon, zweimal im Jahr ernten zu dürfen, im Frühling und im Herbst. Mein Großvater mütterlicherseits war Landwirt, der in der Nähe von Zeitz einen größeren Hof, ein Rittergut, bewirtschaftete. Dort kam ich im Dezember 1943 zur Welt. Mein Vater, damals Postbeamter im besetzten Polen, meinte ohne jede Illusion: »Irgendwann wird Berlin bombardiert, so dass das Kind auf dem Land erst einmal gut aufgehoben ist.« Die drei älteren Geschwister blieben in der Stadt.
MB Wie verlief Ihr Leben mit den Großeltern?
MK Als sich die Amerikaner bald nach Kriegsende aus Sachsen zurückzogen, wurde der Großvater von heute auf morgen von der nun russischen Besatzung ohne Gerichtsurteil enteignet und erhielt eine Dachkammer als letztes Refugium. Er konnte von Glück sagen, dass er nicht erschossen wurde! Im Zusammenleben habe ich, ohne es wirklich begreifen zu können, erstmals gespürt, dass ein Mensch regelrecht schrumpft, wenn man ihm seinen Lebens- und Gestaltungsraum nimmt.
MB Was passierte mit dem Hof?
MK Das Gut verfiel, weil der neue Verwalter ohne Kenntnisse war, die man für die Bearbeitung der relativ kargen Böden im Schlagschatten des Harzes benötigte. Er gehörte zu den politisch opportunen Leuten, die natürlich wussten, dass sie nichts wussten, und deshalb besonders arrogant auftraten.
MB Es fehlte eine kundige Hand zur Bewirtschaftung?
MK Für den Großvater bestand die größte Demütigung nicht in der Enteignung, sondern in der Erfahrung, dass alle seine Fertigkeiten nun brachlagen und er verurteilt war, vom Fenster seines Dachzimmers aus zuzusehen, wie die Sache schiefging. Als er sah, wie der ehemalige Verwalter vom Hof ging, fiel seine große, knochige Hand in den Schoß. Von nun an umgab meinen Großvater eine tiefe Traurigkeit, die ihn nicht mehr verließ. Die Erfahrung der großen Ungerechtigkeit war die stärkste Lektion, die ich aus dieser Zeit bewahrt habe. Man darf nicht ohne Begründung jemandem etwas wegnehmen, vom dem her er lebt. Es gab kein Maß, das die Enteignung gerechtfertigt hätte. Sie war Ausdruck politischer Willkür, die auf ganz andere Weise zuvor schon geherrscht hatte.
MB Als kleines Kind erlebten Sie diese ersten Lebensjahre mit den Großeltern allerdings ganz anders.
MK Es herrschte in unserem gemeinsamen Leben eine ursprüngliche, liebevolle Atmosphäre. Mit dem Großvater ging ich gerne über das Land. Er erklärte mir die verschiedenen Vögel an ihren Stimmen, und er führte mich in die weitere Fauna und Flora ein. Die Natur war etwas Elementares, uns Beglückendes, auch wenn wir ein beengtes, ärmliches Leben führten. Für mich sind bis heute Spaziergänge durch den Wald notwendig, um mich als Person ganz zu fühlen.
MB Neben dem Erleben der Ungerechtigkeit und den Natureindrücken erfuhren Sie im Leben mit dem Großvater eine dritte Dimension, es war das Erlebnis der Frömmigkeit.
MK Eine der seltsamsten Erfahrungen war das Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld – ein Kind versteht nicht, was damit gemeint ist. Welche Schuld? Damals gab es, vor allem auf dem Lande, noch ein protestantisches Leben im Zyklus des Kirchenjahres. Der Glauben hatte seinen Ort in der kleinen Dorfkirche, schlug sich in Predigt und Musik nieder. Die Frömmigkeit litt unter der geschichtlichen Katastrophe ungeheuer. Für die Großmutter brach eine Welt zusammen. Ihr Gottvertrauen hatte einen schweren Schlag erlitten. Ihr war nicht nur der äußere Besitz genommen worden, sondern auch ihr treusorgender Gott: »Du warst da, und jetzt bist du plötzlich unsichtbar. Du warst anwesend, und plötzlich bist du abwesend. Wir sperren die Tür auf, aber du kommst nicht. Wir decken für dich am Tisch den vierten Teller, aber du kommst nicht zum Essen. Und du suchst uns auch nicht mehr so richtig in unseren Träumen heim.« Gott war über dem ganzen Unglück in die Ferne gerückt.
MB Die Großmutter bewegte die alte Hiob-Frage, wie Gott das Leiden zulassen kann?
MK Ja, sie sprach abends in ihren Gebeten immer direkt mit Gott. Ich hörte sie beten und kriegte es mit der Angst zu tun, weil ich immer dachte, wenn sie so viel über Gott schimpft, kommt er zur Tür herein und bestraft uns. Ich fand es natürlich sehr interessant, dass es da eine höhere Instanz gab, bei der man sich beklagen konnte. Denn mit den politischen Instanzen konnte man nicht offen sprechen, ohne etwas befürchten zu müssen.
MB Ihre fromme Großmutter zweifelte an Gott, der nicht sichtbar ist und die Ungerechtigkeit zulässt.
MK Aber bei prinzipieller Anerkenntnis seiner Existenz. Und das war für mich die besondere Qualität ihres Glaubens.
MB Verhielt sich dies bei Ihrem Großvater ähnlich?
MK Mein Großvater war ein gebrochener Mann. Er sprach nicht über diese Dinge. Er schwieg. Es war eine unvorstellbare Traurigkeit in ihm. Das einzige, was der Großvater noch hatte, waren seine starken Hände. Die Hände, die etwas griffen, ergriffen, wie er auch mich an die Hand nahm. Alles andere befand sich in Auflösung. Er konnte sich nicht mit der Veränderung abfinden.
MB Während Sie mit dem Blick des Kindes eine ursprüngliche Geborgenheit erlebten, begegnete den Großeltern die Welt als eine Katastrophe.
MK Es war ihnen auf verschiedene Weise der Glauben an eine natürliche und göttliche Ordnung der Dinge verlorengegangen, in der alles seinen Platz hatte und sich einfügte. Zudem war es nicht möglich, die Verluste politisch einzuklagen, da sie im Osten Deutschlands zu den unerwünschten Grundbesitzern zählten. Ich habe davon profitiert: Ich wurde von ihnen so geliebt, als hätte ich persönlich die Liebe in die Welt gebracht.
MB Wann endete diese persönliche Idylle bei den Großeltern?
MK Ich kam zur Familie nach Berlin, als die Einschulung anstand. Meine drei Geschwister waren sieben, fünf und zwei Jahre älter. Wir lebten zuerst in der Nähe des Olympiastadions in Charlottenburg. Meine Mutter sagte immer noch Reichssportfeld. Die Stadt lag in weiten Teilen noch in Trümmern, was für uns Kinder durchaus auch interessant war. Man konnte Altmetall sammeln und verkaufen.
MB Erlebten Sie auch die Blockade Berlins?
MK Ja, ich erinnere mich, dass wir auf dem Schulhof, wenn Flugzeuge über uns hinwegflogen, sagten: Da wird unser Essen gebracht! Unser Essen hieß nach den Gebern Schwedenspeise. Alles war äußerst knapp. Allerdings besaßen wir einen eigenen Garten, den meine Mutter als Tochter aus landwirtschaftlichem Haus mit allem bepflanzte, was zu haben war. Es gab eigene Erdbeeren, Tomaten und Kartoffeln bis hin zu Salat und anderem Gemüse. Wir wurden von unserer Mutter angehalten, Pferdeäpfel zu sammeln. So rannten wir öfter den alten Zugpferden hinterher und riefen: »Bitte, scheißt endlich, damit wir die Äpfel sammeln können!« Die wurden dann im Garten sorgfältig als Düngemittel verteilt. Meine Mutter ging sogar so weit, zu überlegen, ob wir die eigenen Exkremente sammeln sollten, um den Kreislauf perfekt zu machen. Manchen Sommer mussten wir abwechselnd auf einer Luftmatratze im Garten übernachten, weil meine Mutter befürchtete, die Nachbarn könnten uns die Erdbeeren klauen. Sie war stolz, selbst auf dem winzigen Flecken die Früchte noch zu mehren.
MB Wie verstanden Sie sich mit den drei älteren Geschwistern?
MK Wir hatten untereinander ein sehr gutes, an sich liebevolles Verhältnis. Und trotzdem ging jeder seine eigenen Wege. Ich war zum Beispiel nicht für die Schule zu begeistern. Ich ließ sie einfach über mich ergehen und legte als sehr junger Mensch, noch nicht achtzehn Jahre alt, das Abitur mit Hängen und Würgen ab. Erst kurz zuvor hatte ich begonnen, überhaupt etwas zu lernen. Das gefiel meinem Vater wenig, hatte er doch in Koblenz eine gediegene humanistische Bildung erhalten. In seiner Schulzeit war er mit dem späteren Claudel-Übersetzer Edwin Maria Landau befreundet, mit dem späteren Soziologen René König, mit Joseph Breitbach oder dem späteren Plotin-Herausgeber Hans-Rudolf Schwyzer. Später erfuhr ich, dass er unter anderem bei Carl Schmitt gehört hatte. Er war ein interessierter Mensch. Wenn diese Freunde kamen und wir ihr Gespräch nicht verstehen sollten, sprachen sie Latein miteinander. Bei ihm wirkte nichts aufgesetzt; alles beruhte auf einer Erziehung, deren hohe Qualität nicht mit der unseren zu vergleichen war. Von seinem Bildungsgang aus bestand ein enormer Kontrast zu meinem dürftigen Versuch, durch die Schule zu kommen.
MB Spielte die jüngste Geschichte im Verhältnis zum Vater auch eine Rolle? Sprachen Sie mit ihm über den Krieg, dessen zerstörerische Kraft Ihnen nun in den Trümmern vor Augen stand?
MK Es wurde zu Hause nur sehr ungern über Vergangenes gesprochen. Mein Vater gehörte zu den Menschen, die als Beamte nach Krieg und Entnazifizierung schnell wieder Karriere machten. Mein ältester Bruder, der immerhin sieben Jahre älter war, fragte stärker nach. Er war aufmüpfiger und drängte meinen Vater zu Berichten. In einem Schrank, im hintersten Winkel, lag noch ein Helm mit Hakenkreuz. Wir erfuhren nie, ob mein Vater ihn getragen hatte oder nicht. Ich kenne kein einziges Bild, das ihn als Soldaten zeigt.
MB Was war seine Aufgabe gewesen?
MK Er sollte nach der Besetzung Polens den dortigen Postverkehr aufrechterhalten, was ihm sicher gut gelang; aber zu welchen Kosten und Opfern, das wissen wir eben nicht.
MB Wie sah seine Aufgabe in Berlin aus? Kam sein kulturelles Interesse dort zum Tragen?
MK Meine Eltern gingen regelmäßig ins Theater, besonders gerne ins Schillertheater, damals wohl die beste Bühne des Landes. Film war nicht so sehr ihre Sache, aber dafür gingen sie regelmäßig zum Filmball, in Smoking und Abendkleid, und am nächsten Morgen wurde erzählt, mit welchem verzehrenden Blick er Ruth Leuwerik angeschaut hatte. Überhaupt die Bälle! Filmball, Juristenball, Postball – alles gesellschaftliche Ereignisse erster Ordnung. Als wollte man die zwanziger Jahre auf bürgerlicher Ebene fortsetzen. Als ob nichts gewesen wäre. Auch schrieb mein Vater Aufsätze, die sich beispielsweise mit der Entwicklung des Postwesens durch Thurn und Taxis und den Geschwindigkeiten im Verkehr beschäftigten. So hielt er einmal einen sehr guten Vortrag über die Frage, wie Kleist an die Stätte am Wannsee gekommen war, an der er sich mit seiner Gefährtin das Leben nahm. Er hat alles genau rekonstruiert, sogar die Zeiten gestoppt, die man für die einzelnen Strecken benötigte. Auch las er viel neben seiner Aufgabe, für das geteilte Berlin den Postverkehr ordentlich zu regeln. Und er hat die grafisch ausgezeichneten Berliner Sondermarken gewissermaßen erfunden, die er von den Professoren der Hochschule für bildende Künste gestalten ließ.
MB Mit anderen Worten: Ihr Vater war im apolitischen Sinne ein beeindruckender Humanist, der die alten Sprachen beherrschte und kulturellen Geschmack besaß, sich aber im Politischen pragmatisch den Erfordernissen der Zeit beugte, sei es vor oder nach 1945. Ihre Schilderung lässt mich auch an das berühmte Buch denken, das Alexander Mitscherlich zu Anfang der 1960er Jahre veröffentlichten: »Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft«. Es hat den Ausfall der Väter-Generation im Umgang mit der eigenen Historie zum Thema. Wird darin auch Ihr Blick auf den eigenen Vater getroffen?
MK Das Buch hat er selbstverständlich gelesen! Diese spezifische Vaterlosigkeit haben wir vier Geschwister stark gespürt. Denn es gab auch entsetzliche Streitereien mit den Eltern, die dazu führten, dass meine Mutter weinend aufstand und ins Schlafzimmer ging, während mein Vater auf den Tisch haute, weil wir natürlich frech einforderten: »Es kann doch nicht sein, dass alles wie eine Infektionskrankheit über Deutschland kam.« Diese Fragen wurden selbstverständlich lauter, je älter die 1960er Jahre wurden. Ich entsinne mich, dass eine Tante von mir aus Zeitz zu Besuch war, unvergesslich deshalb, weil sie sogenannte Duftkerzen mitbrachte, die die gesamte Wohnung verpesteten. Beim ersten Schluck Kaffee – Bohnenkaffee! – sagte sie: Tchibo, ist dieser Kaffee nicht auch jüdisch? Alle glotzten bedröppelt in ihre Tassen, und dann ging das Geschrei los. Das »Hitler-hat-aber-auch-die-Autobahnen-gebaut«-Argument kam nach meiner Erinnerung ziemlich häufig vor.
MB Welche Bedeutung besaß der Frankfurter Auschwitz-Prozess für Ihre Diskussionen? War er ein Ferment der Aufklärung?
MK Ja, sowohl der Eichmann-Prozess wie der Auschwitz-Prozess waren Augenöffner. Fritz Bauer war ein Held. Wir lasen die Berichte in den Zeitungen, vor allem im Tagesspiegel. Auch hörten wir die skandalösen Einzelheiten von den Prozessen über das Radio. Den Kontrast bildete die Schule. Wir konnten in keiner Weise erwarten, dass unsere Lehrer uns in irgendeiner Weise über sich selber, ihre Generation, aufklärten. Das kam nicht vor. Warum sollten die Lehrer bekennen, wenn zum Beispiel im Justizministerium mehr als die Hälfte der Beamten ausgesprochene Nazis waren, »furchtbare Juristen«? Man musste also Leute suchen, mit denen man sprechen konnte. Einer von ihnen war der Bruder des Schriftstellers und Theologen Jochen Klepper. Dieser hatte sich mit seiner jüdischen Frau und der Tochter das Leben genommen, als ihnen im Krieg die Ausreise verweigert worden war. Es geschah nahe unseres Hauses in Nikolassee, wohin wir umgezogen waren. Sein Bruder Erhard hatte als Homosexueller das Dritte Reich am Rande überlebt. Er sprach davon, dass die ganze Generation vernichtet worden sei, und schimpfte, wie recht es ihnen geschehe, da sie alle Nazis gewesen seien.
MB Was heißt vernichtet?
MK Zerstört in ihren Seelen, so dass man nichts mehr von ihnen erwarten könne. Auch Jochen Klepper war ja ein sehr komplexer Fall: Er war Mitglied der Reichsschrifttumskammer, Soldat, Pietist, seine Frau hat sich während der Nazizeit taufen lassen – es war alles sehr kompliziert. Aber da es nicht zur Sprache kam, zur Sprache kommen durfte, blieb alles im Halbdunkel.
MB Der Bruder von Jochen Klepper bestätigte mit seinen drastischen Worten Mitscherlichs These?
MK Aber in meiner Umgebung stand er mit diesen Überzeugungen ziemlich allein da. Er war Künstler, schwul und konnte die Klappe nicht halten – meine Mutter hat es nicht gerne gesehen, dass ich ihn häufig besuchte. Von ihm erfuhr ich aber, wer – und aus welchen Gründen – das Land verlassen musste. Der erste Jude, den wir kennenlernten, war der Leiter der jüdischen Gemeinde in Berlin, Heinz Galinski. Er hatte mit meinem Vater zu tun, als die Synagoge in der Fasanenstraße gebaut wurde. Ein sehr sympathischer Mann, der später auch bei uns zu Hause war. Man spürte immer noch einen manifesten Antisemitismus, ein Schweigen über die Vernichtung der zwanzigtausend jüdischen Mitbürger allein in Charlottenburg. Das Haus der Wannseekonferenz, in der sie 1942 beschlossen wurde, lag direkt gegenüber meiner Schule am Wannsee. Jenseits der ungefähren Zahlen, wie viele Menschen umgekommen seien, sprachen wir nie über die geschichtlichen Hintergründe. Auch unterschied man deutlich zwischen Ost-Juden und assimilierten West-Juden, unseren ehemaligen Mitbürgern, also Einstein und anderen, gegen die man nun wirklich nichts habe. Dass die bessere Hälfte des deutschen Geistes das Land auf diese und jene Weise verlassen hatte, darüber kein Wort.
MB Hatten Sie in den Jahren auch Hannah Arendts Bericht »Eichmann in Jerusalem« wahrgenommen?
MK In den Kreisen meines ältesten Bruders wurden der Prozess und Arendts Buch stark diskutiert. Ich las es erst Jahre später, erinnere aber gut die Bilder des Prozesses, die ich noch nachzeichnen könnte. Sie füllten Zeitungen. Man diskutierte, wie ein solch kleines abgemagertes Männchen, das immer nur sagte, er habe es getan, weil es ihm befohlen wurde, eine solche Maschinerie in Gang gesetzt haben konnte. Wie kann das sein? Man sah seine erschrockenen, großen, aufgelösten Augen.
MB Die von Arendt apostrophierte »Banalität des Bösen« stand Ihnen in der Physiognomie von Eichmann vor Augen? War das ein Schock?
MK Offen gesagt: Der Schock hält bis heute an. Ich kann es noch immer nicht verstehen, dass einer, der sich für etwas Besseres hält, den anderen vergast. Wie soll man das begreifen? Sicher nicht, indem man sich an den widerwärtigen Carl Schmitt hält und sein »Der Führer schützt das Recht«. Es hat grausamere Nationen in der Geschichte gegeben als die Deutschen – die Russen, Spanier, Belgier, Franzosen und Engländer, um ein paar zu nennen, waren viel schneller bereit, den anderen ins Jenseits zu befördern –, aber so vulgär und niedrig wie wir hat sich kaum einer verhalten.
MB Was bedeutete das für die Familie?
MK Schwierig war vor allem, dass die Frage, inwieweit die eigene Familie Teil dieser Sache war, völlig im Dunkeln blieb. Warum konnte mein Vater nicht sagen: »Ich war in der Partei. Ich habe folgende Parteinummer gehabt. Ich musste als Postbeamter folgende Dinge tun.« Er hat nie etwas gesagt, und ich weiß es bis heute nicht. Einmal gab es den Fall eines hohen Postbeamten, der ein großer Nazi gewesen war, so dass wir unseren Vater fragten, ob er ihn gekannt und mit ihm zusammengearbeitet habe. Eine Antwort erhielten wir nicht.
MB Man könnte sagen: Die väterliche Welt stand für Ungerechtigkeit, während jene des Großvaters, aus der Sie kamen, Unrecht erlitten hatte. Das Schweigen beider war eine Folge der Zerstörungen, die die Generation des Vaters in den Jahren des Nationalsozialismus angerichtet hatte. Ihr Großvater erfuhr sie anschließend in der sozialistischen Form des Totalitarismus, die Hannah Arendt beschreibt.
MK Gott sei Dank gab es die DDR. Sie war das große Glück Westdeutschlands, da man sagen konnte, ihre Strukturen seien die Fortsetzung der Nazizeit, während man selbst sich ganz amerikanisch frei fühlen durfte.
MB Das heißt: Die Ungerechtigkeiten im Osten wirkten wie ein Blitzableiter, der alle kritischen Energien anzog, während man die eigene Geschichte nicht in den Blick nehmen musste.
MK Ich erinnere mich noch ganz genau, ich war zehn Jahre alt, als ich einmal, meine Zähne putzend, unter meinem Vater stand, der sich oben rasierte und dabei pfiff. Auf meine Frage, warum er so fröhlich sei, sagte er den berühmten Satz: »Stalin ist tot.« Stalin war die große Projektionsfläche für alles Böse im Osten. Er war sehr wichtig für die Psyche der Westdeutschen, da man sagen konnte, es gab einen noch größeren Massenmörder als Hitler. Zugleich war es beliebt, das Desaster des 20. Jahrhunderts auf Hitler zu laden, der die Massen verführt habe; andererseits seien es nur wenige Leute gewesen, die die Verbrechen begangen hätten. Solche Gedanken mussten genügen, bis aus anderen Ländern neue schlechte Nachrichten kamen, auf die man sich stürzen konnte.
MB Was haben Sie dabei vor Augen?
MK Die Berichte über den Kolonialismus etwa, den England, Frankreich und Belgien zu verantworten hatten, wirkten entlastend. Man lenkte gerne von sich ab, wenn man zum Beispiel über die Greuel im Algerienkrieg sprach. Plötzlich waren alle beteiligt, die Engländer, die Franzosen, massiv Russland – eine allgemeine zivilisatorische Katastrophe. Der ganze zivilisatorische Sumpf begann zu brodeln. Uns stellte sich die Frage, die kaum zu beantworten war, ob der Mensch unter bestimmten sozialen und politischen Verhältnissen nicht nur dazu neigt, andere Menschen zu demütigen, sondern auch willens ist, sie umzubringen. Ich erinnere noch, wie ich das erste Mal Adornos Minima Moralia und seine Dialektik der Aufklärung las, Werke, die diese Möglichkeiten erhellten.
MB Die Lektüren waren große Bildungsereignisse, die nicht ohne die eigene deutsche Geschichte zu denken waren.
MK Absolut. Die Bücher wirkten irritierend; es gab keine akademische Einordnung, sondern ich las, und das Gelesene ging unmittelbar in mich ein als Problem des Menschen, der offensichtlich nicht in der Lage ist, friedlich mit anderen zusammenzuleben. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das immer etwas stattdessen macht, wie Odo Marquard richtig bemerkt hat.
MB Kant würde vom »radikal Bösen« im Menschen sprechen, das seine Aggressivität speist. Hannah Arendt tat dies lange auch, bis sie angesichts der Figur Eichmanns in Jerusalem für sich entdeckte, dass gerade die bequeme Gedankenlosigkeit, die »Banalität des Bösen«, furchtbare Konsequenzen zeitigen kann. Dies sind die Abgründe, die sich in der Normalität des Menschen verbergen.
MK Wenn aber das »radikal Böse« mit der »Banalität des Bösen« sich zusammentut, dann entsteht ein Drittes. Man müsste Shakespeare sein, um es angemessen zu beschreiben. Richard III. ist zu wenig.
MB Und wenn ich es richtig verstehe, bestand das Dilemma für Sie darin, dass selbst in einer von Humanismus geprägten Familie das Schweigen über die Geschichte herrschte?
MK Hinzu kam noch eine große Ernüchterung. Wenn man in einem intellektuellen Milieu aufwächst, denkt man immer, Ideen müssten sich schnell verbreiten und sich in einem Spektrum des Guten auswirken, als könnten alle in Windeseile begreifen, was auf dem Spiel steht. Umso erschrockener ist man, dass die meisten Menschen sich überhaupt nicht fragen, ob zum Beispiel die Bergpredigt ein Leitfaden für das Zusammenleben der Menschen sein könnte, ob ein Spruch des Bundesverfassungsgerichtes tatsächlich Verbindlichkeit hat oder ob ein großes literarisches Werk wie Thomas Manns Zauberberg zur Grundausstattung des Menschen gehört. Vielleicht drei Prozent der Bevölkerung würden das unterschreiben. Deshalb ist das Geschwätz über Leitkultur so unerträglich.
MB Anders gesagt: Trotz aller Gespräche hat die Aufklärung, das heißt die Wirksamkeit der Ideen, klare Grenzen.
MK Es klingt einfach, ist aber schwer zu begreifen, dass trotz der raschen Zirkulation von Büchern und Ideen und der rasanten Zunahme von Universitäten und Hochschulen sich das Niveau aufgeklärten Lebens kaum erhöht.
MB Sie selbst haben es nach der Schulzeit vermieden, an die Universität zu gehen. Sie absolvierten eine Buchhändler- und Druckerlehre und besuchten nur abends Vorlesungen. Was war der Grund für Ihre Scheu, sich ganz dem Wissen und Nachdenken zu widmen?
MK Das ist für mich nach wie vor ein Rätsel. Ich habe oft darunter gelitten, kein regelrechtes Studium absolviert zu haben. Aber aus einem tieferen Instinkt heraus kam ich zu dem Entschluss: »Nein, ich studiere nicht.« Um meinem Vater zu gefallen, schrieb ich mich gleichwohl ein, konnte aber nur Vorlesungen besuchen, die nach Feierabend stattfanden. So hörte ich beispielsweise Peter Szondi über Hölderlin und Wilhelm Emrich, der über Kafka, Rilke und Goethe sprach.
MB Gab es in diesen Jahren ein entscheidendes Bildungserlebnis, einen Turning Point, der Ihnen im Gedächtnis haften blieb?
MK Zweifelsohne war es die Arbeit von Walter Höllerer und ganz speziell die von ihm initiierte Serie Ein Gedicht und sein Autor. Ich hörte dort unter anderem zum ersten Mal die Dichter Tadeusz Różewicz, Yves Bonnefoy, Zbigniew Herbert, Lawrence Ferlinghetti, Lars Gustafsson, Francis Ponge, Miroslav Holub, Allen Ginsberg und andere. Es ging ein Vorhang auf, und die Welt öffnete sich. Höllerer, der an der Technischen Universität lehrte, schuf mit dem Literarischen Colloquium eine feste Institution im Berliner Kulturleben. Er war ein geistiger Magnet, obwohl er aus Sulzbach-Rosenberg kam.
MB Was war das Besondere an diesen literarischen Welten, die Sie jenseits der Universität kennenlernten?
MK Sie waren zuerst einmal außerdeutsch. Mein Urerlebnis war eine Reise nach Frankreich, die ich im Alter von dreizehn Jahren mit der christlichen Jungenschaft gemacht hatte. Ich weiß noch genau, wie ich müde, in Lederhose mit Tornister und dem alten, zur Wurst gedrehten Militärzelt in das unzerstörte Paris kam. Als ich Knirps alleine auf der Place de l’Opéra stand, zu der mich ein freundlicher Autofahrer extra gebracht hatte, kamen mir die Tränen. Um mich herum die atemberaubende Architektur und der helle Glanz einer unendlich großen Welt, in der die Leute nach der Abendvorstellung noch vor den Lokalen saßen und den Sommer genossen. Ich ging zu den Gittern vor dem Bureau du Tourisme, wo wir uns treffen sollten, breitete meinen Schlafsack aus und legte mich neben die Clochards. Mir schoss es durch den Kopf: Es gibt noch eine andere Welt jenseits des spießigen Berlin, die ist größer, hat mehr Ideen und Lebensart. Es gibt mehr als unsere kleine Wohnung, mehr als unsere Schule, mehr als unsere Erziehung, mehr als unsere Sprache. Und gleichzeitig wunderten wir uns in den folgenden Tagen als junge Deutsche, dass wir überhaupt dort sein durften und nicht mit einem Tritt über die Grenze zurückgekegelt wurden, nachdem wir innerhalb von siebzig Jahren drei große Kriege angezettelt hatten. Lieber sollte Paris brennen, als in die Hände der compatriots d’Hegel zu fallen, hatte Flaubert notiert.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.