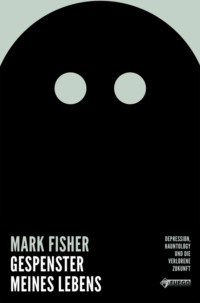Buch lesen: "Gespenster meines Lebens"
Mark Fisher
Gespenster meines Lebens
Depression, Hauntology und die verlorene Zukunft
Aus dem Englischen von Thomas Atzert
FUEGO
– Über dieses Buch –
»Es gibt keine Zukunft mehr, sie ist uns abhanden gekommen. Heute ist es einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus.«
Mark Fisher
Mark Fisher zeigt in seinen Essays, dass uns Gespenster einer Zukunft heimsuchen, die sich nicht einstellen will. Er weist auf die Sackgassen hin, in der sich die Pop-Kultur befindet. Spuren dieser verlorenen Zukunft findet er bei David Peace, Goldie, John Le Carré, Christopher Nolan, Joy Division, Ghost Box, Burial und vielen anderen.
»In Gespenster meines Lebens gelingt es Mark Fisher eindringlich wie keinem anderen die Verbindungen zwischen Pop, Politik und Alltagsleben unter dem affektiven Regime des digitalen Kapitalismus zu erkunden. Zu den bewundernswerten Qualitäten von Fishers Essays gehören die engagierte Klarheit, mit der er seine Gedanken ausbreitet, die daraus sprechenden hohen Erwartungen an die Macht der populären Kunst, zu provozieren, aufzuklären und zu vermitteln, sowie seine hartnäckige Weigerung, klein beizugeben.«
Simon Reynolds
Zöe, meiner Frau, und George, meinem Sohn
00: VERLORENE ZUKUNFT
»Das allmähliche Aufkündigen der Zukunft«
Zeit gibt es hier keine, jetzt nicht mehr.
Die letzte Folge der britischen Fernsehserie Sapphire and Steel endete mit Bildern, die geradezu dafür gemacht schienen, in meinem jugendlichen Kopf noch eine ganze Weile herumzuspuken. Sapphire und Steel, die beiden Titelhelden, gespielt von Joanna Lumley und David McCallum, finden sich in etwas wieder, was wie ein Tankstellencafé aus den 1940ern wirkt. Im Radio läuft ruhiger Big-Band-Jazz im Stil Glenn Millers. Ein weiteres Paar, ein Mann und eine Frau, deren Kleidung das Flair der vierziger Jahre verstärkt, sitzen an einem Nachbartisch. Die Frau, nunmehr im Stehen, sagt: »Das ist die Falle. Hier ist nirgendwo – auf immer und ewig.« Sie und ihr Begleiter verschwinden daraufhin, ihre gespenstischen Konturen verblassen, danach nichts mehr. Sapphire und Steel geraten in Panik. Sie betrachten die spärliche Einrichtung des Cafés, auf der Suche nach etwas, das ihnen zur Flucht dienen könnte. Es gibt nichts. Schließlich reißen sie die Vorhänge zurück, doch draußen ist nur schwarze Leere, in der Sterne funkeln. Einer Raumkapsel gleich treibt, so scheint es, das Café durch die Tiefen des Alls.1
Sehe ich mir heute diese ganz außergewöhnliche Schlusssequenz an, lassen mich die Bilder, das Café und wie es da im Weltall treibt, irgendwie an eine Kombination aus Edward Hopper und René Magritte denken. Solche Bezüge waren mir damals freilich unbekannt; und als ich später dann mit Hopper und Magritte in Berührung kam, erinnerten sie mich umgekehrt tatsächlich zunächst an Sapphire and Steel. Damals, im August 1982, war ich gerade fünfzehn geworden. Es sollten mehr als zwanzig Jahre vergehen, bevor ich die Bilder wiedersah. Doch dank VHS, DVD und YouTube scheint inzwischen praktisch alles jederzeit verfügbar. Unter den Bedingungen digitaler Erinnerung geht der Verlust selbst verloren.
Der Abstand von dreißig Jahren lässt Sapphire and Steel in noch stärkerem Maße seltsam und fremd erscheinen. Es war Science Fiction ohne das genreübliche Drumherum, ohne Raumschiffe, Laserwaffen oder anthropomorphe Gegner: Es gab lediglich das zerfasernde Gefüge im Korridor der Zeit, in dem unheilbringende Wesen herumgeistern und sich dabei der Schwachstellen und Risse im chronologischen Kontinuum bedienen. Von Sapphire und Steel wissen wir nur, dass sie »Ermittler« besonderer Art waren, vermutlich nicht menschlich, ausgesandt von einer mysteriösen »Behörde«, um jene Störungen in der Zeit zu beheben. »Ausgangspunkt von Sapphire and Steel«, erklärt Peter J. Hammond, der Schöpfer der Serie, »war mein Wunsch, eine Detektivgeschichte zu schreiben, in der ›Zeit‹ eine wichtige Rolle spielen sollte. Mich hat das Phänomen Zeit immer schon interessiert, insbesondere auch die Vorstellungswelten von J. B. Priestley oder H. G. Wells, aber ich wollte mich dem Thema anders nähern. Statt also die Protagonisten rückwärts oder vorwärts durch die Zeit reisen zu lassen, sollte es um Brüche in der Zeit gehen, und nachdem diese Prämisse feststand, merkte ich, wieviel Potential darin steckte, zwei Agenten zu zeigen, deren Aufgabe es war, Brüche in der Zeit zu beheben.«2
Hammond hatte zuvor als Drehbuchautor für Krimiserien wie The Gentle Touch (dt. Auf die sanfte Tour) und Hunter’s Walk gearbeitet und darüber hinaus auch für Fantasy-Kinderserien wie Ace of Wands und Dramarama geschrieben. Mit Sapphire and Steel erzielte er als Autor einen Erfolg, an den anzuknüpfen ihm später nicht noch einmal gelingen sollte. Die Voraussetzungen für derartige phantastische Geschichten im öffentlichen Fernsehen schwanden in den 1980er Jahren, als die britischen Medien sich zunehmend dem Diktat einer neoliberalen »Besatzungsmacht« beugten, wie Denis Potter, selbst Fernsehautor, es einmal formulierte. Heutzutage jedenfalls scheint kaum noch vorstellbar, auch das eine Folge jener neoliberalen Okkupation, wie solch eine Serie es jemals zur besten Sendezeit ins Fernsehen schaffen konnte – und das ausgerechnet auf ITV, dem damals einzigen kommerziellen Sender des Landes. Tatsächlich gab es seinerzeit in Britannien überhaupt nur drei Fernsehkanäle: BBC 1, BBC 2 und eben ITV; erst einige Monate nach dem Ende der Serie sollte Channel 4 auf Sendung gehen.
Gemessen an Erwartungen, wie Star Wars sie geweckt hatte, kam Sapphire and Steel recht billig und verspielt daher. Selbst 1982 sahen die Chroma-Key-Tricks wenig überzeugend aus, und der Umstand, dass es nur minimalistische Kulissen und eine recht überschaubare Besetzung gab (tatsächlich wirkten bei den meisten »Aufträgen« neben Lumley und McCallum nur eine Hand voll anderer mit), erweckte eher den Eindruck einer Theaterproduktion. Dennoch entstand keine plumpe Vertrautheit, wie man sie aus dem zeitgenössischen Wohnküchennaturalismus kannte. Sapphire and Steel hatte mehr mit der rätselhaften und bedrückenden Atmosphäre gemein, wie sie Stücke Harold Pinters schaffen, die in den siebziger Jahren des Öfteren im Programm der BBC auftauchten.
Aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts betrachtet, wirken eine ganze Reihe von Dingen an der Serie bemerkenswert. Erstens die kompromisslose Weigerung, dem Publikum »entgegenzukommen«, wie wir das gewöhnlich erwarten. Zum Teil sind die Gründe konzeptioneller Art: Sapphire and Steel bleibt kryptisch, die Geschichten und die Hintergründe werden niemals vollständig offengelegt, geschweige denn erklärt. Die Serie steht weniger Star Wars als den BBC-Adaptionen von John Le Carrés Smiley-Romanen nahe – Tinker Tailor Soldier Spy (dt. Dame, König, As, Spion) war als Miniserie 1979 auf Sendung, die erste Folge der Nachfolgeproduktion Smiley’s People (dt. Agent in eigener Sache) lief einen Monat nach dem Ende von Sapphire and Steel. Doch auch die emotionale Grundhaltung des Ganzen ist bemerkenswert: Beiden Protagonisten und der Serie insgesamt fehlt vollkommen die Wärme und die ironische Art, die heute in Unterhaltungsformaten als selbstverständlich gelten. McCallums Steel begegnet anderen, deren Wege er wider Willen kreuzt, mit technokratischer Teilnahmslosigkeit, und obwohl er stets seine Aufgabe im Auge behält, ist er leicht reizbar, ungeduldig und häufig genervt von der Art und Weise, wie Menschen durch ihr Leben stolpern. Lumleys Sapphire wirkt sympathischer, auch wenn man dabei das Gefühl nicht los wird, ihre offenkundige Zuneigung Menschen gegenüber habe etwas von der gutmütigen Begeisterung vieler Halter für ihre Vierbeiner. Die emotionale Kälte, die Sapphire and Steel von Anfang an auszeichnet, bekommt zudem mit dem letzten Auftrag eine eindeutig pessimistische Färbung. Die Le-Carré-Parallelen verdichten sich in dem dunklen Verdacht, die Protagonisten seien, ganz wie in Tinker Tailor Soldier Spy, von der eigenen Seite verraten worden.
Ein weiteres Element ist die beiläufige Musik Cyril Ornadels. Wie Nick Edwards feststellt, sorgen »Ornadels für ein kleines Ensemble (vorwiegend aus Holzblasinstrumenten) arrangierte Kompositionen, die großzügig mit elektronischen Effekten (wie Ringmodulationen oder Echo/Hall) arbeiten, um die Dramatik und das nur angedeutete Ungeheuerliche zu intensivieren, für weitaus mehr Schauer und sind atmosphärisch dichter als alles, was heutzutage im medialen Mainstream zu finden sein dürfte«.3
Sapphire and Steel verfolgte nicht zuletzt die Absicht, Geistergeschichten aus einem viktorianischen Umfeld herauszulösen und auf heutige belebte oder auch gerade verlassene Schauplätze zu verlagern. Ihr erwähnter letzter Auftrag führt die beiden Agenten zu einer kleinen Tankstelle. An den Fenstern und Wänden der Werkstatt und des angrenzenden Cafés prangen Firmenlogos: Access, 7 Up, Castrol GTX, LV. Dieser »Zwischenort« ist ein Paradebespiel dessen, was der Anthropologe Marc Augé 1992 in seiner gleichnamigen Studie Non-lieux, »Nicht-Orte«, nennen sollte – typische Orte des Transits wie Einkaufszentren oder Flughäfen, wie sie die Räumlichkeit des Spätkapitalismus zunehmend bestimmen.4 Tatsächlich ist die provinzielle Tankstelle in Sapphire and Steel auf eine eigenartige Weise anheimelnd, verglichen jedenfalls mit den typischen geklonten Monstren, die sich in den darauffolgenden dreißig Jahren an den Autobahnen breit machten.
Die Aufgabe, die auf Sapphire und Steel bei ihrem letzten Auftrag wartet, ist wie immer ein Problem in der Ordnung der Zeit. An der Tankstelle gibt es Echos aus der Vergangenheit: Ständig tauchen Bilder und Personen aus den Jahren 1925 und 1948 wieder auf, sodass, wie Silver, ein Agentenkollege der beiden Protagonisten, es formuliert, »die Zeiten sich auf eine Art vermischen, zusammenstoßen und durcheinandergeraten, die keinerlei Sinn ergibt«. Anachronismen und das Ineinanderrutschen einzelner, diskreter Zeitabschnitte markieren in der gesamten Serie symptomatisch den Zusammenbruch zeitlicher Ordnung. Bereits bei einem der vorhergehenden Aufträge bemängelte Steel nicht zuletzt die menschliche Angewohnheit, Gegenstände aus unterschiedlichen Epochen wahllos zusammenzustellen, löse solche zeitlichen Anomalien aus. Beim letzten Auftrag nun schlägt die anachronistische Störung in Stasis um: Die Zeit kommt zum Stillstand. Die Tankstelle befindet sich »in einem Loch, in einem Vakuum«. Noch immer »fahren Autos, doch sie fahren nirgendwohin«: Die Verkehrsgeräusche verschmelzen zu einem Brummen in einer akustischen Endlosschleife. »Zeit gibt es hier keine, jetzt nicht mehr«, stellt Silver fest. Die ganze Szenerie wirkt wie eine Eins-zu-eins-Übertragung eines Passus aus Harold Pinters Stück No Man’s Land: »Sie sind im Niemandsland. Das sich nie regt, sich nie ändert, nie älter wird, doch ewig bleibt, eisig und stumm.«5 Hammond berichtet, dass er eigentlich nicht beabsichtigt hatte, die Serie hier enden zu lassen. Er hatte gedacht, dass sie, nach einer Pause, irgendwann eine Fortsetzung finden würde. Doch es kam zu keiner Fortsetzung – jedenfalls nicht im Fernsehen. 2004 kehrten Sapphire und Steel in einer Hörspielreihe mit neuen Abenteuern zurück, doch weder Hammond noch McCallum oder Lumley wirkten dabei mit, und auch die Zielgruppe war inzwischen keineswegs mehr die Fernsehöffentlichkeit, sondern jene Art Nischenpublikum, wie die digitale Kultur es typischerweise bedient. In einem endlosen Schwebezustand, ohne Hoffnung auf einen Ausweg und ohne dass eine umfassende Erklärung für ihre missliche Lage – so wenig wie für ihre Herkunft – gegeben würde, erscheint das Gefangensein Sapphires und Steels in diesem Café im Nirgendwo wie der Vorgeschmack eines verallgemeinerten Zustands, in dem das Leben weitergeht, doch die Zeit irgendwie zum Stillstand gekommen ist.
Das allmähliche Aufkündigen der Zukunft
Ich möchte in diesem Buch die Behauptung untermauern, dass die Kultur des 21. Jahrhunderts durch einen die Zeit suspendierenden Stillstand und eine Unbeweglichkeit gekennzeichnet ist, wie Sapphire und Steel ihnen bei ihrem letzten Auftrag begegnen. Doch diese Stasis ist verborgen (und begraben) unter einer oberflächlichen Gier nach »Neuheit« und ständiger Bewegung. Das Durcheinandergeraten der Zeit, das Ineinanderfließen verschiedener Zeiten ist keiner Erwähnung mehr wert; es hat sich so verallgemeinert, dass wir es nicht einmal mehr bemerken.
In seinem Buch After the Future beschreibt Franco Berardi (Bifo), wie »das allmähliche Aufkündigen der Zukunft in den 1970ern und 1980ern an Fahrt aufnahm«, und er präzisiert:
»Dabei steht ›Zukunft‹ nicht einfach für die Richtung der Zeit. Eher denke ich an psychologische Dispositionen in einer kulturellen Situation, die durch fortschreitende Modernisierung charakterisiert zu sein scheint, oder auch an die im Verlauf des langen Aufstiegs der Moderne fabrizierten kulturellen Erwartungen, die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg einen Höhepunkt erreichten. In derartige Erwartungen schreibt sich der konzeptionelle Bezugsrahmen einer unendlich voranschreitenden Entwicklung ein, wenn auch unterschiedlich ausgeformt: als hegelmarxistische Mythologie der Aufhebung, auf der die neue Totalität des Kommunismus gründet, als bourgeoise Mythologie einer linearen Entwicklung von Wohlstand und Demokratie, als technokratische Mythologie von der Allmacht der Wissenschaft etc.
Meine Generation wuchs in der Blütezeit einer solchen mythologischen Temporalisierung auf, und es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, das wieder los zu werden und die Wirklichkeit nicht durch die Brille einer solchen Zeitwahrnehmung zu betrachten. Ich werde wohl niemals im Leben in der Lage sein, mich an diese neue Realität zu gewöhnen, ganz gleich, wie evident, unmissverständlich oder auch dramatisch die gesellschaftliche Konstellation dies nahelegt.«6
Bifo gehört der Generation vor mir an, doch stehen wir, was den Bruch in der Wahrnehmung der Zeit anbelangt, beide auf derselben Seite. Wie er werde ich wohl niemals wirklich imstande sein, mich auf die Paradoxien dieser neuen Situation einzustellen. Nun liegt die Versuchung ziemlich nahe, von hier aus in ein nur allzu vertrautes Narrativ zu verfallen, nämlich den Alten anzulasten, mit dem Neuen nicht zurechtzukommen und lediglich zu beklagen, zu ihrer Zeit sei es besser gewesen. Doch gerade dieses Bild – einschließlich der Annahme, die Jungen stünden automatisch an der Spitze des kulturellen Wandels – ist heute überholt.
Es ist weniger das Besorgnis erregende oder Unverständnis auslösende »Neue« als vielmehr gerade das schiere Fortbestehen identifizierbarer Formen, das all jene verstört, deren Erwartungen in früheren Zeiten geprägt wurden. Nirgendwo wird dies deutlicher als in der populären Musikkultur. Die Veränderungen und Umbrüche im Pop dienten vielen von uns, die in den Sechzigern, Siebzigern oder Achtzigern aufwuchsen, als Maßstab und Gradmesser für einen sich vollziehenden kulturellen Wandel – wie auch für den Lauf der Zeit im Allgemeinen. Doch die Musik des beginnenden 21. Jahrhunderts löst gerade dies nicht mehr aus; der »Zukunftsschock« ist verschwunden. Ein einfaches Gedankenexperiment illustriert dies schlagend: Stellen wir uns vor, ein beliebiges in letzter Zeit veröffentlichtes Stück würde durch die Zeit zurückgebeamt, meinetwegen ins Jahr 1995, und liefe dort im Radio. Beim Publikum hielte sich die Überraschung in Grenzen. Ein Schock für die Hörerinnen und Hörer von 1995 wäre im Gegenteil wohl eher die Vertrautheit des Sounds: Sollte die Musik sich tatsächlich in den kommenden zwei Jahrzehnten so wenig verändern? Der Gegensatz zu den raschen Stilwechseln der 1960er bis 1990er Jahre ist unverkennbar: Ein 93er Jungle-Track beispielsweise hätte sich für Leute im Jahr 1989 so unerhört neu angehört, dass damit alles, was für sie Musik war oder hätte sein können, in Frage gestellt gewesen wäre. Beherrschte die experimentelle Popkultur im 20. Jahrhundert ein rekombinatorisches Delirium, getragen von der Emphase unbegrenzt verfügbarer Neuheit, so lastet auf dem 21. Jahrhundert der Alp der Endlichkeit und Erschöpfung. So fühlt sich keine Zukunft an. Oder vielmehr: Es fühlt sich an, als hätte das 21. Jahrhundert noch nicht einmal begonnen. Wir sitzen in der Falle des 20. Jahrhunderts, so wie Sapphire und Steel damals in ihrem Tankstellencafé.
Das allmähliche Aufkündigen der Zukunft ist von einer Deflation der Erwartungen begleitet. Es wird heute nur wenige geben, die überzeugt sind, in nächster Zeit sei mit der Veröffentlichung eines Albums vergleichbarer Größe wie meinetwegen Funhouse von den Stooges oder wie There’s a Riot Goin’ On von Sly and the Family Stone zu rechnen. Und noch weniger erwarten wir einen epochalen Bruch, wie ihn vielleicht die Beatles oder Disco brachten. Das Gefühl, zu spät dran zu sein, den Goldrausch verpasst zu haben, ist heute omnipräsent, auch wenn es allenthalben bestritten wird. Nun wird, wer die Ödnis der Gegenwart mit dem fruchtbaren Boden vergangener Zeiten vergleicht, gern und schnell der »Nostalgie« beschuldigt, doch setzen heutige Künstler in einer Weise auf längst etablierte Stilmittel, die zumindest nahelegt, eine Art formaler Nostalgie halte die Gegenwart in ihrem Griff – mehr dazu gleich.
Nicht, dass gar nichts passiert wäre in diesen Jahren des allmählichen Aufkündigens der Zukunft. Ganz im Gegenteil: Jene drei Jahrzehnte waren Zeiten massiven Wandels und traumatischer Veränderungen. In Großbritannien markierte die Wahl Margaret Thatchers zur Premierministerin das Ende der mitunter schwierigen Kompromisse, die den sozialen »Konsens« der Nachkriegszeit kennzeichneten. Thatchers neoliberales politisches Programm wurde begleitet und verstärkt durch eine transnationale Restrukturierung der kapitalistischen Ökonomie. Der Übergang zum sogenannten Postfordismus – mitsamt Globalisierung, einer Allgegenwart von Computern und der Prekarisierung der Lohnarbeit – führte zu einer totalen Umwälzung der Art und Weise, wie Arbeit und Freizeit organisiert waren. In den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren schließlich verwandelten Internet und Mobilkommunikation die Struktur unserer Alltagserfahrungen grundlegend, teilweise bis zur Unkenntlichkeit. Immer deutlicher wird spürbar, vielleicht gerade aufgrund dieser ganzen Entwicklungen, dass Kunst und Kultur die Fähigkeit verloren haben, unsere Gegenwart zu fassen und zu artikulieren. Natürlich könnte es auch sein, dass es in einem gewissen, letztlich entscheidenden Sinn gar keine Gegenwart mehr gibt, die sich fassen und artikulieren ließe.
Betrachten wir nur das Schicksal der sogenannten futuristischen Musik. Im Popmusikbereich hat »futuristisch« schon lange aufgehört, sich auf eine zu erwartende, andersgeartete Zukunft zu beziehen; stattdessen bezeichnet das Konzept etablierte Stilmittel, ähnlich der Verwendung einer bestimmten Typographie. Als »futuristisch« gilt uns immer noch etwas in der Art der Musik von Kraftwerk, auch wenn deren Musik heute ebenso betagt ist wie es Glenn Millers Big-Band-Jazz in den frühen 1970ern war, als die deutsche Gruppe erstmals mit Synthesizern experimentierte.
Wo gibt es für das 21. Jahrhundert etwas Kraftwerk Vergleichbares? Entsprang die Musik von Kraftwerk einem Moment der Unzufriedenheit dem Etablierten gegenüber, so charakterisiert die Gegenwart ein seltsames Arrangement mit der Vergangenheit. Mehr noch, die Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Gegenwart selbst bricht gerade zusammen. 1981 schienen die sechziger Jahre weit ferner als heute. Seither ist in der Kultur die Zeit kollabiert, und lineare Entwicklung wich einer merkwürdigen Simultaneität.
Zwei Beispiele mögen genügen, diese seltsame Zeitlichkeit zu illustrieren. Als ich das Video zur 2005er Single »I Bet You Look Good On The Dancefloor« von den Arctic Monkeys zum ersten Mal sah, glaubte ich ernsthaft, es sei irgendein verschollenes Stück aus der Zeit um 1980. Alles in dem Video – Licht, Kleidung, Haarschnitte – erweckte den Eindruck, es handle sich um einen Ausschnitt aus The Old Grey Whistle Test, der »seriösen« Rockmusik-Show jener Zeit auf BBC 2. Zudem gab es zwischen Look und Sound keinerlei Diskrepanz. Zumindest beim oberflächlichen Hören hätte das Ganze genauso gut von einer Post-Punk-Gruppe aus den frühen Achtzigern stammen können. Analog zum oben beschriebenen Gedankenexperiment ist »I Bet You Look Good On The Dancefloor« deshalb durchaus als ein Beitrag in The Old Grey Whistle Test vorstellbar, ohne das Publikum von 1980 zu verwirren. Und den Verweis auf »1984« im Chorus hätten damalige Hörerinnen und Hörer – wie ich auch – ebenso gut auf die Zukunft beziehen können.
Das Ganze ist allemal frappierend. Drehen wir die Zeit von 1980 aus 25 Jahre zurück, gelangen wir zu den Anfängen des Rock’n’Roll. Doch Musik, die an Buddy Holly oder Elvis erinnerte, hätte in den Achtzigern unzeitgemäß geklungen. Natürlich erschienen damals solche Stücke, aber sie galten als Retro und wurden entsprechend vermarktet. Wenn die Arctic Monkeys 2005 nicht als Retro-Gruppe angesehen wurden, so nicht zuletzt deshalb, weil es kein »Jetzt« gab, von dem sich ihre Rückwendung abhob. In den 1990ern war es möglich, etwas wie das Revival des Britpop durch den Vergleich mit experimentellen Strömungen im britischen Dance Underground oder im US-amerikanischen R&B einzuordnen. Doch 2005 hatte die Innovationsrate auf beiden Gebieten immens nachgelassen. Auch wenn die britische Dance-Szene sehr viel lebendiger als Rock bleibt, beschränkt sich der Wandel auf verschwindend geringe, inkrementelle und überwiegend nur von Eingeweihten wahrnehmbare Veränderungen – es gibt keinen der Umbrüche, wie sie in den Neunzigern zu hören waren, als Rave von Jungle und Jungle von Garage abgelöst wurde. Während ich diese Zeilen schreibe, erinnert eine der dominanten Strömungen im Pop – der globalisierte Club-Sound, der R&B verdrängt hat – überdeutlich an Euro-Trance, einen besonders langweiligen europäischen Cocktail aus den 1990ern, zusammengerührt aus den fadesten Bestandteilen von House und Techno.
Zweites Beispiel. Zum ersten Mal hörte ich »Valerie« in der Version von Amy Winehouse, als ich durch ein Einkaufszentrum lief, im Übrigen vielleicht der perfekte Ort für das Stück. Bis dahin hatte für mich festgestanden, dass die Zutons, eine Indie-Rock-Band, »Valerie« erstmals aufgenommen hatten; doch der antiquierte Sixties-Soul-Sound der nun gehörten Aufnahme und auch der Gesang (den ich beim flüchtigen Hören zunächst nicht als den von Amy Winehouse identifizierte) erschütterten vorübergehend meine Überzeugung: Handelte es sich bei der Aufnahme der Zutons nicht um ein Cover dieser offenbar »älteren« Nummer, die ich bislang nur noch nicht gehört hatte? Natürlich dauerte es nicht lange zu erkennen, dass der Sixties-Soul-Sound lediglich eine Simulation war und hier der Zutons-Song gecovert wurde, arrangiert in dem aufgemotzten Retro-Stil, auf den sich Mark Ronson, der Produzent des Albums, spezialisiert hatte.
Ronsons Produktionen illustrieren beinahe mustergültig, was Fredric Jameson die »Nostalgie-Welle« nennt. Jameson identifizierte diese Tendenz bereits Anfang der 1980er Jahre in bemerkenswert vorausschauenden Essays zur Postmoderne.7 »Valerie« oder die Arctic Monkeys sind für das postmoderne Retro so typisch durch die Art und Weise, wie der Anachronismus umgesetzt wird. Sie klingen »historisch« genug, um die Performance beim ersten Hören als einer nachgemachten Vergangenheit zugehörig durchgehen zu lassen, doch gleichzeitig stimmt irgendwas nicht. Diskrepanzen in der Textur – Ergebnis moderner Studio- und Aufnahmetechniken – verweisen darauf, dass sie weder der Gegenwart noch der Vergangenheit angehören, sondern einer vermeintlich »zeitlosen« Epoche, ewigen Sechzigern oder ewigen Achtzigern. Deren »klassischer« Sound kann dank neuer Technologie immer wieder aufpoliert werden und lässt dabei die Zwänge seines historischen Entstehungszusammenhangs ganz hinter sich.
Wenn Jameson eine Nostalgiewelle diagnostiziert, so bezeichnet dies – und es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein – kein psychologisches Phänomen. Tatsächlich schließt Jamesons theoretischer Ansatz das Psychologische sogar eher aus, da die Nostalgiewelle, die er vor Augen hat, in dem Moment ins Rollen kommt, da ein historisches Verständnis von Zeit zusammenbricht. Eine Gestalt, die in der Lage ist, echte Sehnsucht nach der Vergangenheit zu zeigen und auszudrücken, gehört hingegen geradezu paradigmatisch zur Moderne – zu denken wäre etwa an die überragende Art, in der Marcel Proust oder James Joyce das Einholen verlorener Zeit zum Gegenstand machen. Jamesons Nostalgiewelle ist daher eher im Sinn einer formalen Hinwendung zu Techniken und Formen der Vergangenheit zu verstehen, eine Konsequenz der Absage an die mit der Moderne verbundene Anforderung, zeitgenössische Erfahrung zum Maßstab der Innovation kultureller Formen zu machen. Jamesons Beispiel ist der heute halb vergessene Film Body Heat (dt. Heißblütig – Kaltblütig) von Lawrence Kasdan aus dem Jahr 1981, der, obwohl die Handlung »eigentlich« in den Achtzigern situiert ist, den Eindruck erweckt, als spiele er in den dreißiger Jahren. Body Heat sei, so Jameson,
»technisch gesehen kein Nostalgiefilm, da der Ort der Handlung eine zeitgenössische Kleinstadt in Florida ist, nicht weit von Miami. Tatsächlich aber bleibt diese Zeitgenossenschaft sehr unklar. […] Technisch gesehen […] sind die Objekte (die Autos beispielsweise) Produkte der 1980er Jahre, doch alles in dem Film ist darauf angelegt, diese unmittelbaren zeitgenössischen Bezüge zu verschleiern und es so zu ermöglichen, ihn zugleich als einen Nostalgiefilm zu rezipieren – als eine Erzählung, die in einer undefinierten nostalgischen Vergangenheit angesiedelt ist, den ›ewigen‹ dreißiger Jahren etwa, außerhalb der Geschichte. Äußerst symptomatisch scheint mir, dass der Stil von Nostalgiefilmen heute auch Produktionen besetzt und kolonisiert, die in der Jetztzeit spielen, ganz so als ob wir, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage wären, uns auf unsere eigene Gegenwart zu konzentrieren, als ob uns die Fähigkeit abhandengekommen wäre, unsere Gegenwartserfahrung ästhetisch darzustellen. Doch wenn das zutrifft, ist es zugleich ein schreckliches Armutszeugnis für den Konsumkapitalismus – oder zumindest ein alarmierendes und pathologisches Symptom einer Gesellschaft, die außerstande ist, sich mit Zeit und Geschichte auseinanderzusetzen.«8
Die Weigerung, sich explizit auf die Vergangenheit zu beziehen, verhindert, dass Body Heat tatsächlich zu einem in einer früheren Zeit situierten Nostalgiefilm wird. Das Ergebnis ist ein Anachronismus besonderer Art, und paradoxerweise charakterisieren das »Verschleiern des Zeitgenössischen« und das »Schwinden von Historizität« zunehmend unsere kulturelle Erfahrung.9 Als ein weiteres Beispiel der von ihm beschriebenen Nostalgiewelle führt Jameson Star Wars an:
»Eine der prägenden kulturellen Erfahrungen der Generationen, die zwischen den 1930er und den 1950er Jahren aufwuchsen, waren Samstagnachmittagsserien in der Art von Buck Rogers: Da gab es außerirdische Schurken, wahre amerikanische Helden, Protagonistinnen in Not, Todesstrahlen und Weltuntergangsszenarien, und am Ende den Cliffhanger, dessen wundersamer Ausgang erst am Samstag darauf zu bestaunen war. Star Wars bringt diese Erfahrung in der Form eines Pastiche wieder zurück – ohne solche Serien zu parodieren, schließlich sind sie seit langem ausgestorben. Star Wars ist daher keine sinnfreie Satire auf jene toten Formen, sondern befriedigt vielmehr ein tiefes (und vielleicht sogar unterdrücktes?) Verlangen, sie zurückzuholen; so entsteht ein komplexes Objekt, bei dem auf einer ersten Ebene Kinder und Jugendliche die Abenteuer als solche rezipieren können, während das erwachsene Publikum ein tieferes und im eigentlichen Sinn nostalgisches Verlangen zu befriedigen in der Lage ist: das Begehren, in jene alten Zeiten zurückzukehren und die Erfahrung jener überaus merkwürdigen ästhetischen Artefakte noch einmal zu durchleben.«10
Es ist in diesem Fall keine Sehnsucht nach einer bestimmten Zeit oder Epoche (und falls doch, so allenfalls indirekt): Die Nostalgie, die Jameson hier beschreibt, ist die nach einer Form. Der postmoderne Anachronismus findet in Star Wars in besonderer Weise seinen Niederschlag, nicht zuletzt durch die Art, wie hier Technologie eingesetzt wird, um die Archaik der Form zu bemänteln. Die eigenen Ursprünge in verstaubten Abenteuerserien werden eskamotiert, und dank nie dagewesener, mithilfe modernster Technologie geschaffener Special Effects kann Star Wars als »neu« erscheinen. Baut Kraftwerk in geradezu paradigmatisch moderner Weise auf Technologie, um neue Formen hervortreten zu lassen, so dient der Einsatz von Technologie im Nostalgiemodus lediglich dem Zweck, das Alte aufzupolieren. Das Ziel lautet, das Verschwinden der Zukunft als ihr Gegenteil zu maskieren.
Die Zukunft verschwand nicht über Nacht. Bifos Formel vom »allmählichen Aufkündigen der Zukunft« ist so treffend, weil sie das sukzessive, doch zugleich unaufhaltsame Erodieren von Zukunft im Verlauf der vergangenen rund drei Jahrzehnte zu fassen erlaubt. Die späten 1970er und frühen 1980er waren zweifellos der Moment, als die gegenwärtige Krise kultureller Zeitlichkeit zum ersten Mal zu spüren war, doch sollte es noch bis ins erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts dauern, bis der von Simon Reynolds als »Dyschronie« bezeichnete Zustand endemisch wurde. Diese Dyschronie, diese temporale Disjunktion, sollte sich unheimlich anfühlen, doch die Prädominanz dessen, was Reynolds »Retromanie«11 nennt, führt dazu, dass dieser Zustand jedwede Dimension des Unheimlichen verloren hat: Der Anachronismus wird nunmehr als selbstverständlich hingenommen. Die von Jameson beschrieben Postmoderne mit ihren Vorlieben für Retrospektive und Pastiche wurde naturalisiert. Nehmen wir nur die erstaunlichen Erfolge von Adele: Obgleich ihre Musik nicht als Retro daherkommt, gibt es an den Stücken nichts für das 21. Jahrhundert Charakteristisches. Wie so viele Produktionen in der zeitgenössischen Popkultur vermitteln Adeles Alben ein vages doch bleibendes Gefühl von Vergangenheit, ohne an einen spezifischen historischen Moment zu erinnern.