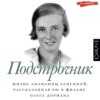Buch lesen: «Lehren der Liebe»
Lehren der Liebe im Lied der Lieder
Über die bildlichen Entsprechungen und unter Berücksichtigung der Hinweise der alten Sprache des Hohelieds sind die Mehrfachaussagen zu erfahren. Wohl wurde der Text schon vor ewig langer Zeit „richtig“ übersetzt. Ihn zu durchdenken und seine Aufgaben zu lösen, blieb dabei verborgen.
Magda Heigl, im Frühling 2021
Copyright, alle Rechte vorbehalten
Auszüge nach Absprache MagdaHeigl@web.de
Inhaltsverzeichnis
Hohelied Kapitel 4
Hohelied Kapitel 4, Vers 1
Hohelied Kapitel 4, Vers 2
Hohelied Kapitel 4, Vers 3
Hohelied Kapitel 4, Vers 4
Hohelied Kapitel 4, Vers 5
Hohelied Kapitel 4, Vers 6
Hohelied Kapitel 4, Vers 7
Hohelied Kapitel 4, Vers 8
Hohelied Kapitel 4, Vers 9
Hohelied Kapitel 4, Vers 10
Hohelied Kapitel 4, Vers 11
Hohelied Kapitel 4, Vers 12
Hohelied Kapitel 4, Vers 13
Hohelied Kapitel 4, Vers 14
Hohelied Kapitel 4, Vers 15
Hohelied Kapitel 4, Vers 16
Wortliste
Hohelied Kapitel 4
Die Körpersprache „sagt“ mehr als ein akustisches Wort. Nicht jede Sprache hat den gleichen Wortschatz. Es konnte im Lied der Lieder die Körpersprache, ausgedrückt durch beschreibende Szenen, viele Idee für die philosophischen Regeln liefern.
All die Jahrhunderte, seit der Zeit von Papst Gregor dem Großen, der sich noch mit den hebräischen anderen Wortbedeutung in seiner Literatur abgab, waren keine Analysen aus dem früheren Christentum mehr als Lehrstoff zum „Üben“ alter Lesart. Papst Gregor schrieb an die 30 Bände über „Moral bei Hiob“. Was hat er so vervielfacht zu erzählen gehabt, bei grad 30 Bibelseiten?
Es geht nicht darum viel zu schreiben. Nur die Methodik soll klar werden, der Kern der Aussagen im Mittelpunkt stehen. Die Leute fanden keinen Übergang von dem „Bild“ das sie sahen zu dem Text, den sie lasen. Es verschob sich die Zielrichtung von einer Lehre über die Liebe hin zu einer Poesie über ein Liebespaar. Die Schiefentwicklung der „wörtlichen Aussage“ brachte viele Ungereimtheiten.
Es wirkt das „Eingeübte“ mit liebender Tat besser als nur das nachgeplapperte Wort. Ich hoffe, dass nun mehr aus dem „Liebeslied“ entsteht, der Text zum selber nachdenken, die Moral zum Überlegen und das Fördern der Liebe.
In den philosophisch ausgearbeiteten „Bildern“, kamen Themen wie Sympathie entwickeln, dann auch richtig reagieren, die richtigen Sehnsüchte setzen. Das Ende oder die Zusammenfassung vom 3. Kapitel wäre nicht schwer zu verstehen:
Seid friedfertig, richtig gut – und das Herz blüht auf!
Wie viel Gedanken wurden schon über das Hohelieds publiziert. Lediglich Kunst sei es, wie andere Lieder auch. Dagegen spricht, dass die vielen Kulturen, die mit diesem Lied in Berührung kamen (als es noch verstanden wurde) bessere Informationen über ein Zusammenleben bekamen.
Hohelied Kapitel 4, Vers 1
Lutherbibel: Siehe meine Freundin, du bist schön! Siehe schön bist du! Deine Augen sind wie Taubenaugen zwischen deinen Zöpfen. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die gelagert sind am Berge Gilead herab.
הִנָּ֨ךְ יָפָ֤ה רַעְיָתִי֙ הִנָּ֣ךְ יָפָ֔ה עֵינַ֣יִךְ יֹונִ֔ים מִבַּ֖עַד לְצַמָּתֵ֑ךְ שַׂעְרֵךְ֙ כְּעֵ֣דֶר הָֽעִזִּ֔ים שֶׁגָּלְשׁ֖וּ מֵהַ֥ר גִּלְעָֽד׃
hinach japhah ra'jati hinach japhah 'enajich jonim
miba'ad letsamatech
sa'rech k-eder ha'izim shegalshu mehar gilead:
Sicherlich, jede Frau liebt es, gelobt zu werden und ist offen für Komplimente. Allerdings riecht „frau“ den Braten, wenn ein Mann mit lauter Loberei ankommt, die nicht lauter ist, sondern sie oft nur zweckgebunden vorschiebt. Doch wir Frauen wissen das bereits: Gäbe es keine die arbeitet, sehe es traurig aus in der Welt.
Unterschiedlich sind die Anreden zu Mann oder Frau. In der Dichtung verwischen sie in manchen Stellen, womit die Gleichheit der Geschlechter wiederhergestellt wurde. Trickreich wurde formuliert. Zuweilen wechseln die Wörter zwischen Hauptwort und Verb, das nicht durch Groß- oder Kleinschreibung erkenntlich ist. Es entsteht ein anderer Satz als der übersetzte. Zu lesen ist von einem weiblichen Schönheitswahn. Wer ist die angesprochene „Schönheit“ und wie heißt sie?
Abschnitt 1:
הִנָּ֨ךְ יָפָ֤ה רַעְיָתִי֙ [hinach japhah ra'jati] Siehe meine Freundin, du bist schön!
In der hebräischen Sprache kommen viele beschreibende Worte vor, meist als philosophische Begriffe. Über verschiedene Kulthandlungen wurde die Philosophie „gezeigt“, aber im Laufe der Zeit wurde der Sinn vergessen. Die Zeremonie bestand in Äußerlichkeiten, zwecks Gewinn und „Pflichterfüllung“. Im Herzen war weniger. Liebsein wurde so kaum eingeübt. Dann wurde, wie von den Propheten und Jesus vorausgesagt, der Tempel zerstört, und nie wieder aufgebaut.
Es ist die Rede von רעיתי [ra'jati] von der Freundin / Freundschaft. Da ist nicht nur der Standpunkt רע als Freundschaft. Die Wurzel kann verzweigen mit רעה oder רעע. Das wäre dann Übel. Da würde „schön“ nicht passen. Es ist so, dass bei falschen Ansichten die Sicht das Problem ist. Ein Säufer sieht Sucht als wichtig an, findet es schön, während sein Leben entgleist. י פה (nichts ist da) statt schön יפה.
Abschnitt 2:
הִנָּ֣ךְ יָפָ֔ה עֵינַ֣יִךְ יֹונִ֔ים [hinach japhah 'enajich jonim]
Siehe schön bist du! Deine Augen sind wie Taubenaugen
Es wird erneut betont, auf was bei der „Schönheit“ zu achten sei. הנך ist da wirklich Zustimmung zu dir, ja, doch הן [hen]. Was ist, wenn so geteilt wird: ה נך und die anderen vielleicht geschlagen werden. Das wäre bei einem Verb in Hiphil 1. Person Mehrzahl mit Wurzel נכה. Anmut, Schönheit ist חן [chén]. Da fehlt nur ein Stückchen von dem Buchstaben. Der Vers beschreibt malerisch die „Taubenaugen“. Vom anderen Standpunkt aus, ist das „Auge“ עין gleich lautend wie עין Blickweise. Dann ist „Taube“ [jona] nicht nur ein Federvieh, das im alten Tempel geopfert wurde. Es wird zum Verb, beschreibt ein Reifen (ausgären wie beim Wein). Der schäumt, wenn er jung ist. Wird er geklärt, ist kein Geflatter, sondern Haltbares.
Gehen wir zur „guten Absicht“. Schön wäre dies - auch in deiner Blickweise? Schön wär's, wenn die Ansicht ausgegoren wäre. Was sieht der andere, etwa „Haariges“?
Abschnitt 3:
מִבַּ֖עַד לְצַמָּתֵ֑ךְ [miba'ad letsamatech] zwischen deinen Zöpfen.
Es ist vom poetischen Text her nicht erkennbar, warum die Taubenaugen und die Zöpfe in andere Abschnitte getrennt wurden. Hinter oder zwischen heißt מבעד. Während oder doch ist ein anderer Wert, falls jemand bei מבעוד landet und daher mit den Worten zu rätseln anfängt. Während deiner „Zöpfe“. Was wird da verzapft. Die Verbindung kommt, weil durch derartige Hinweise in den Handschriften auf einen Wert hingewiesen wurde. Die Aussage passt: Eine aufgeschäumte Ansicht bedingt während oder doch מבעוד [mib'od].
Das zweite Wort, Zöpfe kann gelten für צמת zusammenziehen, aus לְצַמָּתֵ֑ךְ heraus geholt. Um das Wort im Lexikon zu finden, wird die Vorsilbe gekürzt und die Endung. Die zeigt an, dass zu einer Frau gesprochen wurde. Doch als „Zopf“ צמה muss erst ein Konstrukt gebildet werden, dass damit צמת entsteht. In dieser Form wiederum teilt sich [tsa met] lässt die Gedanken kommen was von welcher Seite hervorgeht.
Er hat „ihr“ zwischen die Augen geschaut, vom Schrecken überwältigt! Da würde mit harten "T" gesprochen מבעת. Wenn einer keine Brille hat, nicht gut lesen kann, sieht er מבער denkt an „dumm“, denn [ba'ar] wäre unwissend, brennt. Die gute und richtige Seite: בעד ist zugunsten.
Zwischen den einzelnen „Blickweisen“ was denn übel oder gut wäre, wo etwas schön sei oder nichts käme, gibt es viele Zöpfe zu ordnen. Nicht nur die mit Haaren.
Abschnitt 4:
שַׂעְרֵךְ֙ כְּעֵ֣דֶר הָֽעִזִּ֔ים [sa'rech k-eder ha'izim] Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen
Das gleiche Wort שער für Haar ist „Werte“. Die Werte sollten mit Ordnen der Stärken sein, nicht mit struppigem Aussehen wie eine Herde von Ziegen. Dazu ist gleich geschrieben wie Haar, ein Verb [shi'er] vermuten oder annehmen, abschätzen. Dein Vermuten wäre wie? Wer da meint, mit einer romatischeren Übersetzung wie Lockenschleier die Frau schöner werden zu lassen, findet vor lauter Haaren die Ordnung nicht.
Abschnitt 5:
שֶׁגָּלְשׁ֖וּ מֵהַ֥ר גִּלְעָֽד׃ [shegalshu mehar gilead:] die gelagert sind am Berge Gilead herab.
Normal wird Hebräisch von rechts nach links gelesen. Bei diesem geteilten Satz, bei dem ständigen Wechsel der Seite je Schriftart, steht der kleine Abschnitt links. So kommt das hebräische Satzendezeichen „:“ mal rechts, mal links daher.
Ziegen sind eigenwillig, sind schwer zu hüten, heißen עִזִּ֔ים [izim]. Als philosophischen Satz geht die Reihe mit den Stärken. Die werden vermutet. Die bleibenden Stärken bringen in die Höhe. Da rollt es ewig oder eben bis ... [gal ad], oder am Berge Gilead.
Hohelied Kapitel 4, Vers 2
Lutherbibel: Deine Zähne sind wie eine Herde Schafe mit beschnittener Wolle, die aus der Schwemme kommen, die allzumal Zwillinge haben, und es fehlt keiner unter ihnen.
שִׁנַּ֨יִךְ֙ כְּעֵ֣דֶר הַקְּצוּבֹ֔ות שֶׁעָל֖וּ מִן־הָרַחְצָ֑ה
שֶׁכֻּלָּם֙ מַתְאִימֹ֔ות וְשַׁכֻּלָ֖ה אֵ֥ין בָּהֶֽם׃
shinajich ke-eder haqtsuvot she'alu min-harachtsah
shekulam mat'imot veshakulah 'en bahen:
Ich habe leider nur noch drei Zähne, werde nicht mithalten können. Es ist nicht so, dass ich sie mir an den Texten ausgebissen habe. Ein Kriegsschaden, Bombenhagel mit Chemie, verdarb vielen meines Jahrgangs die Knochen. Gegen Kriegsende wurden sogar die jugendlichen Mädchen aus den ländlichen Regionen in die Hauptstädte gefahren, um von Hausdächern aus auf die Flugzeuge zu schießen. An Schäden litten danach geborene Kinder.
Die Texte sind für den Frieden, weil die „Zähne“, das eifrig lernen darstellen und somit völlig anders sind, als tierische Ansinnen. Da wird gemeint: „Der Starke siegt“. Ganz anders arbeitet die Natur im Zusammenspiel. Bei ihr ist es nicht wichtig, ob eine Giraffe oder eine Ameise ein Wettrennen gewinnt. Der Mensch sollte die Schöpfung bewahren. Das kann er kaum mit den Städten und allen Industriekomplexen, den Erfindungen, die der Zerstörung der Natur dienen. Nicht einmal überleben auf der Erde kann er damit.
In dem Vers wird ein seltsamer Vergleich gewählt, die Schönheit der Zähne mit den geschorenen Schafen verglichen. Aus שן dem Zahn, entsteht ein Lernen, wenn die Wurzel erkannt wird. Die ist שנה ändern oder es wäre auch wiederholen als weiteren Aspekt. Eine Verbindung zu merken geht auch mit der Verszahl, also mit der Zahl 2 [she'najim]. Darin liegt kein Zufall, sondern es gibt wiederholende, sinnvolle Ordnungssysteme.
Wir lernen, שנים heißt die Zahl, als Verb gesehen. Im Vers „2“ wird überlegt, wie ein Lernen möglich ist. Das geht nicht mit wahllosen Informationen, die auswendig gelernt werden. Es braucht eine Grundstruktur, Entscheidungshilfen für zentrales Anliegen, Nebensächlichkeiten richtig zuordnen. Gefühle und Inspiration spielen eine Rolle dabei, auch Fähigkeiten und Erinnerungen. Der Schlaf ist [sh'ena] שנה, wiederholt sich auch. Manche lernen im Schlaf.
Mit einer Reihe frisch gewaschener und geschorener Schafe werden die schönen Zähne verglichen. Verwirrend erscheint das Wort „beschnittene Wolle“. Es ist auch von keinem Bauernhof die Rede, sondern nur von עֵ֣דֶר [eder]. Das kann geordnet sein, gejätet auch vermisst heißen. Wegen sich scharen heißt es Herde.
Bei Tag und Nacht im Freien sind die braven Tiere verschmutzt. Grad nur an dem einen Tag oder am nächsten ist die Herde makellos. Das ist ein merkwürdiger malerischer Vergleich zu den Zähnen. Die müssten täglich geputzt, strahlend weiß aussehen. Vergleicht der Poet etwa ruinierte Beißer mit Flecken.
Die Zähne sind wie כְּעֵ֣דֶר הַקְּצוּבֹ֔ות [ke-eder haqtsuvot ]. Eine Herde Geschlachteter. Die hätten viel Zorn. Das müsste verkehrt sein, ist sehr heftig ausgesprochen, קצף ['qetsef] Zorn.
קצב [qtsev] etwas weicher gesprochen, ist Takt, Rhythmus. Das Wort geht auch bei scheren. So schreibt man auch Schächter. Dazu noch zuteilen, das Maß bestimmen.
Bildlich macht eine „Reihe gescherter“ nichts her und bringt auch keinen Einfall zu den Zähnen. „Gschert“ ist einer in Bayern, der sich nicht nett benimmt. Das passt aber hier nicht.
Kombiniert je Möglichkeiten ergibt sich ein (Lernen) Ändern, wo die Reihe nicht funktioniert hat, die zugemessen wurde. Wer muss ändern, wer hat geschlafen und was wäre der richtige Takt.
Abschnitt 2:
שֶׁעָל֖וּ מִן־הָרַחְצָ֑ה [she'alu min-harachtsah] die aus der Schwemme kommen
Gereinigt wird durch das Hochkommen, bzw. das Aufrollen der Möglichkeiten.
Anders gesagt, die kamen aus der Schwemme.
Abschnitt 3:
שֶׁכֻּלָּם֙ מַתְאִימֹ֔ות [shekulam mat'imot ] die allzumal Zwillinge haben
Alle betrifft dies [shequlam]. Die Zähne sind mit passendem Gegenstücken im Ober- und Unterkiefer. Die haben alle Zwillinge [mat'imot] und es fehlt keiner. Das trifft nicht bei allen zu, so überlegen wir andere Aspekte. Nichts wurde vergessen beim Lernen, oben nicht und unten auch nicht. Jeder Zahn hat seine spezielle Funktion. Die sind doppelt „trächtig“. Ein Zahn allein kann schlecht beißen. Die Argumente der Überlegungen müssen zueinander passen. Es sollte keine Lücke vorkommen.
Abschnitt 4:
שֶׁכֻּלָּם֙ מַתְאִימֹ֔ות [shekulam mat'imot ] die allzumal Zwillinge haben
Warum nur wurde der Vergleich „trächtige“ noch dazu doppelt trächtig gewählt und woher wollen die wissen, dass es keine Fehlgeburt gibt. Freilich ist einer bei der Feststellung „hervorragende Schafe“ ganz zufrieden, und über den Beweis überlegt er nicht. Das geht meist so mit der Loberei. Hauptsache die akustische Feststellung war da. Auf diese Weise kann sich jede Falschinformation verbreiten. Wer schaut schon der Geliebten in den Mund, wenn sie die „Zähne zusammenbeißt“. Mit anderen Worten, wenn es schwierig wird und nichts offen liegen kann, da alles schräg ist.
Der kostenlose Auszug ist beendet.