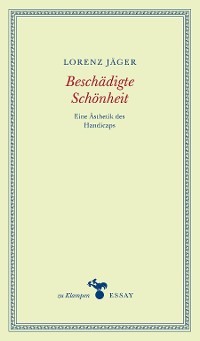Buch lesen: "Beschädigte Schönheit"
Reihe zu Klampen Essay
Herausgegeben von
Anne Hamilton
Lorenz Jäger,
Jahrgang 1951, studierte Soziologie und Germanistik. Nach der Promotion lehrte er in Japan und den Vereinigten Staaten und lebt heute in Frankfurt am Main. Er ist Redakteur im Feuilleton der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. Zuletzt sind von ihm erschienen »Prägungen« (2013), »Unterschied. Widerspruch. Krieg. Zur politischen Theologie jüdischer Intellektueller« und bei zu Klampen »Die schöne Kunst, das Schicksal zu lesen. Kleines Brevier der Astrologie« (2009).
LORENZ JÄGER
Beschädigte Schönheit
Eine Ästhetik des Handicaps

Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Widmung
Zitate
Fräulein Montag und ihre Schwestern
Voraussetzungen der Antike
Paradoxe Elogen in der Frühen Neuzeit
Exkurs über das Schielen
Ästhetische Theorien: Friedrich Schlegel und Victor Hugo
Der Roman des neunzehnten Jahrhunderts
Dekadente Übergänge: Barbey d’Aurevilly, Rollinat und Sâr Péladan
Sex
Obszönität
»Ich bin es selbst!«
Danksagung
Impressum
Fußnoten
Gumbrecht dem Freund
Tal vez los defectos hermosean.
Lope de Vega, »A una dama tuerta«
Elle est boiteuse; mais peste, qu’elle est jolie!
Charles de Brosses, »Lettres familières écrites d’Italie«
Im ganzen Gebiet der ästhetischen Wissenschaften ist die Deduktion des Interessanten vielleicht die schwerste und verwickeltste Aufgabe.
Friedrich Schlegel, »Über das Studium der griechischen Poesie«
Contrary to what might have been supposed, the Baroness did not »glide«; far from it, she walked as if the heel of one shoe were a trifle higher than the other; not that this was so; it was merely style.
Ronald Firbank, »The Artificial Princess«
Rien ne vaut le (…) d’une boiteuse.
Guillaume Apollinaire, »L’enchanteur pourrissant«
Fräulein Montag und ihre Schwestern
EINE Lehrerin des Französischen, sie war übrigens eine Deutsche und hieß Montag, ein schwaches, blasses, ein wenig hinkendes Mädchen, das bisher ein eigenes Zimmer bewohnt hatte, übersiedelte in das Zimmer des Fräulein Bürstner.
Ich muss mit einem Vorbehalt beginnen. Schon lange gelingt es mir nicht mehr, Kafka wirklich zu lesen, im Zusammenhang, ausführlich, so, wie er es verdiente. Nur vereinzelte Stellen beschäftigen mich dann doch immer wieder, und dazu gehören die wenigen Passagen über das hinkende Fräulein Montag im »Prozess«. Es spielen ja in dieses Gerichtsverfahren auch das Begehren und die Ehen hinein: Die Pension von Frau Grubach, in der Josef K., Fräulein Bürstner und eben auch das Fräulein Montag wohnen, ist eine Zone der Singles, während der erste Besuch bei Gericht den Beschuldigten gleich in eine dampfende Familienatmosphäre führt: Kindergeschrei, Essen kochen, Wäsche waschen. Wie gern hätte ich mehr über Fräulein Montag gewusst, aber hier lässt mich Kafka im Stich. Ich wünschte mir, er hätte an dieser Stelle wenigstens die knappe Notiz eingefügt, die man anderswo bei ihm findet:
»Dass Leute die hinken dem Fliegen näher zu sein glauben als Leute die gehn. Und dabei spricht sogar manches für ihre Meinung. Wofür spräche nicht manches?«1 Aber auch das bleibt unbestimmt. Montaigne hat den Hinkenden einen ganzen Essay gewidmet, in dem er den Mangel zum erotischen Triumph umdeutet, eine Passage darin ist unvergesslich: »Die Italiener haben ein Sprichwort, welches ungefähr so lautet: Der kennt nicht die Süßigkeit ganz, die Venus gewähren kann, der noch keine Hinkende erkannt hat.« Man muss nur zu Kafkas Zeitgenossen Franz Werfel gehen, dann findet man auch diese Auffassung. In Werfels Roman »Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig« gesteht der Protagonist verzweifelt seine Liebe zu einer märchenhaft benannten jungen Frau: »Die Schönheit Sinaidas war eine wesenlose Entzückung, die ihrem Kleid die süße Form gab, selbst aber Zephyr, Geist, Schwingung zu sein schien. Und doch – es war fast klar – sie hatte ein Gebrechen. Wenn auch von zarter, unauffälliger Natur. Es schien, dass sich ihr Schritt nach der einen Seite etwas neigte, kaum merklich, aber in manchen Augenblicken unverkennbar. Dieses Unregelmäßige in dem Rhythmus ihrer Erscheinung (Hinken es zu nennen wäre zu viel und zu profan), dieses zarte Gebrechen riss mich hin, brachte mich um Verstand und Bewusstsein.«2 Und später: »O Gott, ich war, ich bin verliebt in ihr leichtes Hinken, in diese süße Gebrechlichkeit.«3 Was Kafka an Fräulein Montag versäumt hatte zu empfinden und zu schildern, das übertreibt Werfel bis zur klebrigen Süße, zum Kitsch – fast möchte man sagen: Kitsch ist (diesmal jedenfalls) verdrängte Pornographie. Schlechthin zauberhaft aber ist in seinem Lakonismus der Satz von Elias Canetti: »Sie hinkt so schön, dass die Gehenden neben ihr wie Krüppel erscheinen.«4 Solcher Gedanken der Verherrlichung war Kafka nicht fähig, sein Porträt der blassen Hinkenden scheint mir tatsächlich blass, unerwartet konventionell. Der Lehrerin des Französischen blieb ich dennoch treu.
Ähnlich muss es Orson Welles empfunden haben, als er Kafkas Roman 1962 verfilmte, mit Anthony Perkins als Josef K. und Romy Schneider als Leni. Denn hier ist nun aus dem »ein wenig« hinkenden Mädchen eine schwerbehinderte Frau mit einer auffälligen Beinschiene geworden, und die Szenen, in denen sie auftritt, haben sich gegenüber der literarischen Vorlage sehr erweitert. Und sie selbst ist es, die ihre Behinderung thematisiert, als K. ihr nachts folgt oder sie – wie sie glaubt – fast verfolgt.5 Die stärkere, fast obszöne Akzentuierung mag vom Film als Gattung gefordert sein, der künstlerisch zwingend von starken Bildern her denken muss. Gedenken wir auch der Rolle, die Ginette Leclerc als hinkende Verführerin, geradezu als Vamp, in Henri-Georges Clouzots meisterhaftem Kriminalfilm »Der Rabe« (»Le Corbeau«, 1943) spielte.6 Und des Films »Die Wendeltreppe« (»The Spiral Staircase«, Regie Robert Siodmak, 1945): die junge Myrna Dell in der ebenso verführerischen Rolle einer Hinkenden, die nur in Unterwäsche zu sehen ist – vom Zuschauer und von dem Mann, der sie gleich ermorden wird. Myrna Dell erinnerte sich später:
»I was to play a cripple who gets murdered at the beginning of the picture! ›God‹, I said to Siodmak, ›couldn’t you at least take the limp away?‹ But no.«7 In Erich von Stroheims »Hochzeitsmarsch« (»The Wedding March«, 1928), spielt ZaSu Pitts die reiche hinkende Erbin Cecelia Schweisser, die Prinz Nicki (Nikolas von Wildeliebe-Rauffenburg, dessen Rolle Stroheim selber übernahm) aus finanziellen Motiven heiratet, während ihr Vater auf einen Adelstitel hofft.8 Stets gegenwärtig und auch in der Kirche während der Hochzeitszeremonie nicht endend, ist der harte Kontrast zwischen den zynischen Kommentaren der Gesellschaft und der liebenden, geradezu engelhaften Schönheit und Unschuld Cecelias. Der Filmtheoretiker Rudolf Arnheim hat bei Strohheim geradezu eine Tendenz gesehen: »His heroines are dolls of a more than American sweetness, bedecked with flowers and the bridal veil, but in their pale eyes are sleepless nights and the terrors of rape. Significantly, he frequently uses the theme of the limping woman on crutches.«9
In diesen Bildern von Fräulein Montag und ihren Schwestern, vor allem in ihren Verwandlungen, steckt eine kleine Geschichte unserer Kultur.
Voraussetzungen der Antike
DIE Menschen Homers sind aus einem homogenen Stoff. Innen und Außen fallen nicht auseinander; wie sie erscheinen, so sind sie auch. Die Antike liebte es deshalb, in körperlichen Behinderungen oder Abweichungen das moralisch Fragwürdige angezeigt zu sehen. Der hinkende, schielende und bucklige Thersites ist ein Mann des Ressentiments, der in der »Ilias« an den anderen nichts Gutes lassen will: »Alles saß nun ruhig, umher auf den Sitzen sich haltend;/Nur Thersites erhob sein zügelloses Geschrei noch:/Dessen Herz mit vielen und törichten Worten erfüllt war,/Immer verkehrt, nicht der Ordnung gemäß, mit den Fürsten zu hadern,/Wo ihm nur etwas erschien, das lächerlich vor den Argeiern/Wäre. Der hässlichste Mann vor Ilios war er gekommen:/Schielend war er, und lahm am anderen Fuß; und die Schultern/Höckerig, gegen die Brust ihm geengt; und oben erhob sich/Spitz sein Haupt, auf der Scheitel mit dünnlicher Wolle besäet./Widerlich war er vor allen des Peleus Sohn und Odysseus;/Denn sie lästert’ er stets. Doch jetzt Agamemnon dem Herrscher/Kreischt’ er hell entgegen mit Schmähungen. Rings die Achaier/Zürnten ihm heftig empört, und ärgerten sich in der Seele.« So die Schilderung Homers in der Übersetzung von Johann Heinrich Voß.
Diese Gleich-Stoffigkeit des moralischen und des physischen Menschen findet sich auch im Alten Testament (sie ist also gemeinantik), wenn es in Leviticus 21 heißt: »Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und sprich: Jemand von deinem Samen bei ihren Geschlechtern, an dem ein Gebrechen ist, soll nicht herzunahen, um das Brot seines Gottes darzubringen; denn jedermann, an dem ein Gebrechen ist, soll nicht herzunahen, es sei ein blinder Mann oder ein lahmer oder ein stumpfnasiger, oder der ein Glied zu lang hat, oder ein Mann, der einen Bruch am Fuße oder einen Bruch an der Hand hat, oder ein Höckeriger oder ein Zwerg, oder der einen Flecken an seinem Auge hat, oder der die Krätze oder Flechte, oder der zerdrückte Hoden hat. Jedermann vom Samen Aarons, des Priesters, der ein Gebrechen hat, soll nicht herzutreten, die Feueropfer Jehovas darzubringen; ein Gebrechen ist an ihm, er soll nicht herzutreten, das Brot seines Gottes darzubringen. Das Brot seines Gottes von dem Hochheiligen und von dem Heiligen mag er essen; allein zum Vorhang soll er nicht kommen, und zum Altar soll er nicht nahen, denn ein Gebrechen ist an ihm, dass er nicht meine Heiligtümer entweihe; denn ich bin der Herr, der sie heiligt.«
Andernorts ist es der hinkende Schmiedegott Hephaistos-Vulkan, paradoxerweise Gatte von Aphrodite-Venus, der Schönsten, der zum Gelächter der Götter wird. Die römische Literatur vor allem macht aus diesem Lachen ein Formgesetz ihrer Satiren. Ein Beispiel aus Martial: »Zähne kaufst Du, und Busen und Haare, Du alte Susanne?/Tausch’ doch Dein schielendes Aug’ gegen ein schönes Dir um!«1 Das »Schielen als Zeichen des Missgönnens, Beneidens ist auch aus den römischen Schriftstellern zu beweisen«, schrieb Heinrich Düntzer.2 Das war gleichsam das letzte Wort der Antike zur Sache. Die Satire war die einzige dichterische Gattung, die Rom nicht von den Griechen übernommen hatte; das Privileg der Götter, über Vulkan zu lachen, fällt nun verallgemeinernd an den römischen Bürger. Nur bei Ovid gab es die Andeutung einer anderen Auffassung. In der »Liebeskunst« lässt er auch Venus, parodierend, den hinkenden Gang des Gatten nachahmen. Die Szene spielt unmittelbar vor ihrem Ehebruch mit Mars: »Wie oft belachte sie nicht des Mannes hinkende Füße/Und die von Arbeit und Gluth harte, schwielige Hand!/Reitzend hinkte sie oft vor ihrem Mars dem Vulkan nach./Mit vieler Anmuth war ihre Schönheit gepaart.«3 Aber auch hier wird die Szene komisch und satirisch angetönt, das Gelächter färbt auf die Anmut ab.
Paradoxe Elogen in der Frühen Neuzeit
NOCH am Anfang der Frühen Neuzeit war gerade das Hinken moralisch hochgradig suspekt. Hexerei konnte sich darin andeuten, jedenfalls wird es in Hexenprozessen gelegentlich eigens erwähnt. Und die petrarkistische Liebeslyrik widmete sich den idealen Gestalten. Erst die barocke Epoche, die der Renaissance unmittelbar folgte, brachte das Venus-Vulkan-Paradoxon – die Verbindung der Schönsten mit dem Hinkenden nun in einer Person – zur kunstvollen Entfaltung.
Montaigne aber dürfte einer der ersten Autoren gewesen sein, die im Hinken eine mögliche erotische Attraktivität erkennen wollten. Man kann es aus dem Gesamtkorpus seiner »Essais« herleiten – Jean Starobinski hat darauf aufmerksam gemacht, dass mouvement, Bewegung, Montaignes Leitmetapher ist. In den »Essais« III/11 findet sich die bereits eingangs erwähnte folgenreiche Überlegung: »Der Italiener hat ein Sprichwort, welches ungefähr so lautet: Der kennt nicht die Süßigkeit ganz, die Venus gewähren kann, der noch keine Hinkende erkannt hat. Der Zufall, oder eine sonderbare Begebenheit, haben dies Sprichwort vor langer Zeit schon zu einer Volkssage gemacht, und man braucht es zugleich vom männlichen wie vom weiblichen Geschlecht.«1 Und nun sucht er nach der Ursache des Vergnügens: »Ich hätte geglaubt, die unordentliche Bewegung einer Hinkenden gäbe dem Liebeswerk ein neues Vergnügen und denen, die es versuchten, irgendeinen wollüstigen Reiz mehr«– das wäre die Erklärung gewesen, die nach Starobinski naheliegt –, aber Montaigne biegt nun ab in eine sehr simple naturalistische Richtung. In der antiken Philosophie nämlich will er eine ganz andere Deutung des Phänomens gefunden haben: »Weil die Beine und Hüften der Hinkenden wegen ihrer Unvollkommenheit die Nahrungssäfte nicht verbrauchen, die ihnen bestimmt sind, so wären daher die Teile über solchen vollständiger, genährter und rüstiger; oder auch: weil diese Gebrechen sie verhindern, sich viel zu bewegen, so verbrauchten diejenigen, die damit behaftet wären, weniger Kräfte, die sie denn reichlicher bei der Feier der Venus anwenden könnten.«2
Nun aber biegt er noch einmal ab, und die Skepsis als Lebenshaltung artikuliert sich auch hier: »Aber worüber können wir nicht vernünfteln, wenn wir diese Art zu schließen brauchen wollten? (…) Beweisen diese Beispiele nicht, was ich eingangs sagte: dass unsere Gründe oft den Wirkungen vorauslaufen und eine so unendliche Gerichtsbarkeit in Anspruch nehmen, dass sie über Undinge und Nichtigkeiten urteilen und erkennen?«3 Eine Antwort auf die Frage der hinkenden Venus wird nicht gegeben, sondern ihre Voraussetzungen werden bestritten. Den eigentlichen Kontext der berühmten Passagen erwähnt Montaigne gleich zu Beginn seines Essays: »Ich überlegte jetzt eben, wie ich oft thue, was für ein freyes und unstätes Werkzeug die menschliche Vernunft ist. Ich sehe gemeiniglich, dass die Menschen, wenn ihnen Begebenheiten erzählet werden, lieber den Grund, als die Wahrheit derselben, untersuchen. Sie gehen geschwind über die vorausgesetzten Umstände weg, und betrachten neugierig die Folgen.«4 Aber das Wort über Venus war nun einmal ausgesprochen und machte sich geltend; ganz über die Intention des Verfassers hinweg: Von tausend Autoren, die Montaigne in dieser Sache zitieren, kennt vielleicht einer die abschließende skeptische Erwägung. Rezeptionsgeschichte hat ihre eigenen Ironien.
Eine direkte Nachahmung dieser Skepsis – sichere und allgemeine Kriterien gibt es nicht – findet man bei dem Montaigne-Epigonen François de La Mothe Le Vayer (1588 bis 1672), der sich als Schriftsteller Oratius Tubero nannte: »Le marcher droict & la belle allure ont leurs charmes comme le reste de la personne; i’en ay veu d’amoureux du clocher d’vne boiteuse, & qui trouuoient qu’en elle, aussi bien qu’en cette belle Elegie d’Ouide, vn pied plus long que l’autre auoit ses graces particulieres/In pedibus vitium causa decoris erat.«5 Also: Das gerade Gehen und das schöne Aussehen haben ihren Zauber, ich habe aber auch solche gesehen, die verliebt in den besonderen Gang einer Hinkenden sind, und die bei ihr finden, wie es in der schönen Elegie von Ovid heißt, dass ein Fuß, der länger ist als der andere, seinen besonderen Reiz hat. Der Gedanke gehört ganz in die Geschichte der pyrrhonischen Skepsis: Es kann so sein, aber auch ganz anders. Sicheres Wissen ist auf diesem Gebiet nicht zu haben.
Anders aber, als es Montaigne wohl im Sinne hatte, wurde die Stelle aus den »Essais« III/11 zu einem regelrechten Topos, die skeptische Erwägung, die den Kontext abgibt, fiel weg. Aus dem Gegensatz von Venus und Vulkan wurde vor allem in der marinistischen Lyrik der Romanen, also der Franzosen, Italiener und Spanier, eine Freude an paradoxen Verbindungen. Man hat beim Marinismus von einer »Verblüffungssicht« gesprochen, vom Grotesken, vom kunstvoll gesuchten Gegensatz. Benannt wurde die Richtung nach dem italienischen Dichter Giambattista Marino (1569 bis 1625). Das Kunstwollen manifestierte sich als extreme Künstlichkeit der Bilder und Sujets. Mit gelehrten Motiven verbunden, aus den Sphären nicht nur der Mythologie, sondern auch der Kosmologie und der Jurisprudenz. Wer zählt die Gedichte, die sich nun, mit dem frühen sechzehnten Jahrhundert, der »Belle Boiteuse« widmeten, der schönen Hinkenden – und selten ohne den mythologischen Scherz, ihr Vater sei Vulkan gewesen, ihre Mutter aber Venus.
In den »Diverses Poésies« des Jean Vauquelin, Sieur de la Fresnaie (1536 bis 1607), eines Schülers von Ronsard, findet sich eine erste Umdeutung antiker Motive. Amor verfolgt Jeannette, eine Hinkende, sie wird vergebens fliehen, denn sie hinkt, und er, der Geflügelte, wird sie erreichen – und nehmen!
O Ianete, tu fuis en vain
Amour, que suiuent les plus belles:
Tu es boiteuse, il a des ailes,
Tu sera prise tout soudain. 6
Aus dem Bestand der Antike, und gegen die im Petrarkismus kanonischen Schönheitsideale, geht eine antikanonische Dichtung hervor. Sie ist fassbar in Frankreich, Spanien und in Italien. Nun wird, eigentlich erst nach 1600, der mythologische Bestand paradox zugespitzt. Es hängt dies mit einer neuen Auffassung der Rhetorik zusammen, mit der »Agudeza«, in der dem überraschenden Motiv der Vorzug vor dem Konventionellen gegeben wird. Schon Ernst Robert Curtius hat in »Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter« auf die kaum zu überschätzende Bedeutung der Agudeza-Idee hingewiesen. Bei Balthasar Gracían (1601 bis 1658) lautet die einschlägige Definition: »Son empresas del ingenio y trofeos de la sutileza los asuntos paradojos«– Unternehmungen des erfindungsreichen Geistes und Trophäen der Subtilität sind die paradoxen Angelegenheiten. Wenn also in der Antike zwar Venus und Vulkan als Paar verbunden waren, aber ihre Sphären sich nicht überschnitten, es sei denn in der Satire, so wird nun die Einheit der extremen Gegensätze gesucht.
Giovanni Leone Sempronio (1603 bis 1646), geboren in Bologna, war ein Musterdichter des neuen Stils, europaweit wurde er gefeiert. Aus seinem »Selva poetica« stammt das Sonett auf die schöne Hinkende, la bella zoppa, es galt als »modello de’ più perfetti« der Gattung.7 Wieder ist eine kunstvolle Abwandlung des Mythos zu erkennen, vielleicht die virtuoseste in der Dichtung überhaupt. Nur am Ende werden Venus und Vulkan für das Hinken in ihren Rollen ausgetauscht, vielmehr gibt Eurydike das erste Muster, als sie von der Schlange in den Fuß gebissen wird, und das zweite ist zwar wiederum Venus, aber als sie mit dem »makellosen Fuß«– auf der Suche nach ihrem geliebten Adonis – in einen Dorn getreten ist (beide Motive haben vielfache künstlerische Darstellungen gefunden).
Moue zoppa gentil piede ineguale,
Cui ciascuna ineguale è in esser bella;
E così Zoppa ancor del dio, c’ha l’ale
Può l’alate fuggir dure quadrella.
Tal forse era Euridice, ò forse tale
Era Ciprigna a l’hor, ch’à questa e a quella
Morse il candido piè serpe mortale,
Punse il candido piè spina ribella.
Consolisi Vulcan; ché, se tal’ hora
Mosse il suo zoppicar Venere a riso,
Hoggi sa zoppicar Venere ancora.
E certo questa dea, se il ver m’auuiso,
Solo il tenero piè si torse a l’hora
Ch’ella precipitò dal paradiso. 8
(»Bewege, hübsche Hinkende, deine Füße, sie sind nicht gleich, und an Schönheit ist ihnen kein anderer Fuß gleich; und so hinke auch weg vor dem Gott, der Flügel hat (also Amor, Cupido), wisse: Beflügelte fliehen seine süßen Pfeile. So war vielleicht Eurydike, so vielleicht Venus, zu jener Stunde, da der einen die tödliche Schlange in den makellosen Fuß biss, da der widerspenstige Dorn den makellosen Fuß der anderen strafte. Getröstet ist Vulkan, dessen Hinken zuweilen Venus zum Lachen brachte: Heute hinkt Venus auch. Und sicher ist’s, dass diese Göttin, meiner Ansicht nach, nur wegen dieses zarten Fußes allein, so verdreht er zu dieser Stunde ist, geschwind vom Paradies hierhereilte.« Übers. L. J.)
Von Sempronio haben wir auch ein Preisgedicht auf eine schöne Kleinwüchsige (»La bella nana«) und eine schöne Stotternde (»La bella balba«). Die Übersetzung eines Gedichts von Alessandro Adimari (1579 bis 1649) – er dichtete auch auf eine schöne Bucklige – gibt Hans Assmann Freiherr von Abschatz, ein barocker Lyriker der zweiten schlesischen Schule (1646 bis 1699). Auch Adimari wird literaturgeschichtlich dem Marinismus zugerechnet:
Die schöne Hinckende
Muss dieses Wunder-Bild/der Abgott vieler Hertzen,
Auf ungewissem Grund ungleicher Pfeiler stehn?
Was Pracht und Witz erhebt/macht Demuth noch so schön,
Was will uns denn an ihr derselben Demuth Bildniss schmertzen?
Pflegt nicht die Königin der goldnen Himmels-Kertzen,
Auch wechselweise sich zu sencken/zu erhöhn?
Der schönen Venus Wirth/Vulkan/muss hinckend gehn;
Man sieht sein schönes Feur mit falschen Springen schertzen,
Vielleicht wird sie dadurch/Verliebte/minder kühn;
Und wär auch dieses nicht/so hilft doch solcher Mangel,
Dass sie euch nicht so bald kan aus den Augen fliehn.
Das kleinste Theil der Welt sieht die zwey Himmels-Angel
In gleichem Stande ruhn; ie mehr sich einer neigt,
Jemehr sein Gegentheil dort in die Höhe steigt. 9
Als verliebt in eine schöne hinkende Deutsche, »Innamorato in bella Zoppa Tedesca«, bekennt sich Domenico Gisberti (1635 bis 1677), Sekretär und Hofdichter des bayrischen Königs. Bei jedem Tritt und Schritt für Schritt sieht er »süße Harmonie« seiner Chloris (der Flora). Es schmerzt ihn nicht, dass ihre Füße ungleich sind.10 Der Doktor Donato Antonio Cito geht nach dem gleichen Rezept vor und erhöht den Einsatz noch, indem er ein Gedicht auf eine schöne Hinkende und zugleich Blinde schreibt: Vulkan und Venus vereinen sich, und wie dem Sohn des göttlichen Paares, dem Amor, sind ihr die Augen verbunden: »La bella Zoppa, e Cieca«.11
Es ist nun schon ein literarischer Topos geworden, den man gar nicht mehr einem einzelnen zuschreibt, sondern vielen gefeierten Autoren, einer Tradition: Eine Hinkende hat Reize (appas), die man bei keiner der Geradegehenden (les droites) findet. Als intellektuell-dichterisches, hochgradig artifizielles Spiel mit dem ästhetischen Paradoxon, das insgesamt die marinistische und frühbarocke Lyrik charakterisiert, war also die erste Anerkennung der Behinderung entstanden.
Ein italienisches Gedicht aus dem Jahr 1686 gehört noch in diese Linie, es stammt aus den »Sonetti Amorosi, & Varii« von Hercole Rudio, die Sammlung ist dem Herzog Georg Wilhelm von Braunschweig gewidmet:
La bella Zoppa
Colei ch’ha torto il piè, dritto ha lo sguardo,
onde m’accende al sen fiamma immortale;
e se inetta è di piè, d’Amore ha l’ale,
e se pigra è nel moto, ha il cor gagliardo.
Più acuto a fermo passo avventa il dardo
che, in difetto del piè, col braccio assale;
e se lento ha il camin, pronto ha lo strale,
con cui m’infonde al core il foco, ond’ ardo.
Ma udite la cagion per cui più peno:
di Ciprignana e d’Amor vanto ha sovrano,
delle Grazie il suo viso è il trono ameno;
l’arco ha d’Amor nel ciglio e i dardi en mano,
gira i cieli nei rai, duo mondi ha in seno;
splende un Apollo al volto, al piè un Volcano. 12
(»Jene mit dem verdrehten Fuß hat einen geraden Blick, der in mir eine unsterbliche Flamme entzündet, Und wenn ihre Füße unbeholfen sind, so hat sie doch von Amor die Flügel, und wenn sie sich träg bewegt – ihr Herz ist energisch und wacker. Den Pfeil schleudert sie, bei defektem Fuß, mit dem Arm, und wenn der Weg auch langsam gegangen wird, so ist der Strahl doch schnell, mit dem sie mir im Herzen jenes Feuer entzündet, von dem ich brenne. Nun hört aber den Grund: Von der Cypris (Venus) hat sie die stolze Herrschaft, ihr Antlitz ist der Thron der Grazien, den lieblichen Bogen hat sie von Amor: ihre Wimpern. Zwei Welten trägt sie im Busen: Aufs Gesicht strahlt Apollon, auf den Fuß Vulkan.« Übers. L. J.)
In dem Augenblick, als die Dichter und die Philosophen das schöne Hinken entdeckt hatten, bemerkten es auch die Chronisten der europäischen Höfe. Pierre de Bourdeille, Seigneur de Brantôme, geboren um 1540, gestorben 1614, ungefähr der Generation von Montaigne angehörend, schrieb über die Königin Anne de Bretagne in seinem Buch »Vie des dames illustres«: »Sa taille estoit belle et médiocre. Il est vray qu’elle avoit un pied plus court que l’autre le moins du monde; car on s’en appercevoit peu, et malaisément le cognoissoit-on: dont pour cela sa beauté n’en estoit point gastée; car j’ay veu beaucoup de tres-belles femmes avoir cette légère défectuosité, qui estoient extresmes en beauté, comme madame la princesse de Condé, de la maison de Longuevillle. Encore dit-on que habitation de telles femmes en est fort délicieuse, pour quelque certain mouvement et agitation qui ne se rencontre pas aux autres.«13 (»Ihre Figur war schön, von mittlerer Größe. Es ist wahr: Sie hatte einen Fuß, der um eine Nuance kleiner als der andere war; denn man bemerkte es kaum, und nur schwer wusste man’s: Aber davon war ihre Schönheit in keiner Weise gemindert; denn ich sah viele sehr schöne Frauen, die diesen leichten Fehler hatte, und dabei von äußerster Schönheit waren, wie die Prinzessin Condé, aus dem Hause Longueville. Auch sagt man, dass die Umarmung solcher Frauen den höchsten Genuss gewährt, wegen gewisser Bewegungen und Erregungen, die sich bei anderen nicht finden.« Übers. L. J.) Der aufklärerisch-materialistische Philosoph La Mettrie hat in seinem Buch »Ouvrage de Pénélope ou Machiavel en Médecine« einen bösen Witz darüber gemacht (der aber nur zeigt, wie stabil die Tradition inzwischen schon geworden war): Ein Mann liest bei Brantôme von den erotischen Qualitäten der Hinkenden und beschließt daraufhin, seiner Geliebten das Bein zu brechen. Er will unbedingt mit seiner Marion die Erfahrung dieser Geschöpfe machen, denen Brantôme das Lob gesungen hat.14 Über Anne de Bretagne bemerkt ein weiterer Chronist, ihre Hofdamen hätten aus Höflichkeit auch gehinkt: »donc les dames et demoiselles devaient boiter par simple courtoisie«.15
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.