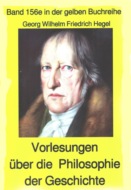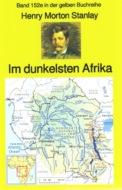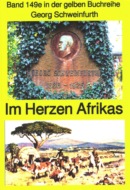Buch lesen: "Kurt Aram: Nach Sibirien mit hunderttausend Deutschen"
Kurt Aram
Kurt Aram: Nach Sibirien mit hunderttausend Deutschen
Band 160 in der gelben Buchreihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des jetzigen Herausgebers
Der Autor Kurt Aram (alias Hans Fischer)
Kurt Aram: Nach Sibirien mit hunderttausend Deutschen
Die Reise nach Tiflis
Die Kriegserklärung
In der russischen Mausefalle
An der Madatowskij-Insel
Haussuchung
Eingesperrt
Wieder unter Deutschen
Unter russischen Soldaten
Verschickt
Der Transport nach Wjatka
In Schnee und Eis
Unter russischen Rekruten
Die Befreiung
„Amerikanski“
Die Reise durch Finnland
Die gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des jetzigen Herausgebers
Vorwort des jetzigen Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.

Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.
Der in diesem Band enthaltene Text von Amalie Sieveking zeugt von der tiefen Frömmigkeit einer vom Pietismus geprägten Dame aus der gutbürgerlichen Gesellschaft Anfang des 19. Jahrhunderts und spiegelt die Denkmuster und Lebensart eines Teils der damaligen Zeit. Für uns sind diese Ansichten heute kaum nachzuvollziehen, doch sind sie ein Zeugnis damaliger diakonischer Aktivität. Hamburg, 2021 Jürgen Ruszkowski

Ruhestands-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Der Autor Kurt Aram (alias Hans Fischer)
Der Autor Kurt Aram (alias Hans Fischer)

https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/aram.html
Geboren am 28.01.1869 in Lennep; gestorben am 10.07.1934 in Berlin. Sein wirklicher Name ist Hans Fischer. Aram war ein deutscher Journalist und Schriftsteller, der unter diesem Namen schrieb. Bis zu seiner Amtsniederlegung 1900 war er unter seinem bürgerlichen Namen Pfarrer in Herborn. Er arbeitete als Redakteur beim Berliner Tageblatt, war Mitherausgeber der Literaturzeitschrift März und verfasste eine Reihe von Romanen, die allgemein zur Unterhaltungsliteratur gezählt werden.
* * *
Kurt Aram: Nach Sibirien mit hunderttausend Deutschen
Kurt Aram: Nach Sibirien mit hunderttausend Deutschen
https://www.projekt-gutenberg.org/aram/sibirien/sibirien.html


Die Reise nach Tiflis
Die Reise nach Tiflis
Am Sonnabend-Mittag, den 25. Juli, gingen wir, meine Frau und ich, in Konstantinopel an Bord der „CARINTIA“, eines kleinen schmucken Dampfers des Österreichischen Lloyd, der uns durch das Schwarze Meer nach Batum bringen sollte. Im Sommer des Jahres 1914 hatte bekanntlich die Türkei, dem Drängen Deutschlands und Russlands nachgebend, durchgreifende Reformen in Ost-Anatolien, das in der Hauptsache von armenischen Christen und von Kurden bewohnt wird, zugesagt. Drei Monate lang hatte ich diese mich interessierende Frage in Konstantinopel studiert. Zwei europäische Generalinspekteure für Ost-Anatolien, ein Norweger und ein Holländer, waren derweil von der Hohen Pforte ernannt worden. Der eine sollte seinen Sitz in Trapezunt, der andere in Wan haben. Mitte Juli waren sie mit ihrem Gefolge nach Anatolien abgereist. Am 25. Juli wollte ich ihnen nachreisen und einen Einblick in ihre Arbeit gewinnen. Da es eine ausgiebige Forschungsreise werden sollte, war am 20. Juli meine Frau aus New-York zu mir nach Konstantinopel gekommen.

Wir wollten zunächst nach Wan am Wansee reisen. Um dorthin zu gelangen, gab es zwei Wege. Entweder fuhr man zu Schiff nach Trapezunt und reiste dann zu Wagen oder zu Pferd über Erzerum nach Wan. Das dauerte von Trapezunt aus etwa dreiundzwanzig Tage, also eine sehr umständliche und sehr beschwerliche Reise. Oder aber man fuhr zu Schiff nach Batum, benutzte von dort die russische Eisenbahn über Tiflis nach Eriwan und hatte dann nur noch dreieinhalb Tage bis Wan, der Weg war also bedeutend kürzer und, da man bis auf die letzten drei Tage die russische Eisenbahn benutzen konnte, auch bedeutend bequemer. Also wählten wir natürlich ihn. Zwar war der österreichisch-serbische Konflikt schon ausgebrochen, das österreichische Ultimatum drohte und hing als schwere Wetterwolke am politischen Horizont, aber in jenen wundervollen Sommertagen dachte niemand daran, dass sich in so kurzer Zeit aus dieser Wetterwolke ein Weltbrand entzünden würde.
Kurz nach drei Uhr an jenem 25. Juli lichtete die „CARINTA“ die Anker. Eitel Sonne, blaues Meer und blauer Himmel ringsum. Vorbei am Winterpalast des Sultans, vorbei an dem Prinzenpalast, in dem Abdul Hamid gefangen saß, vorbei an Arnautikoi, der Sommerresidenz der österreichischen und amerikanischen Botschaft, wo an jenem Tag die weißen Stationäre der österreichischen, italienischen und englischen Botschaft friedlich beieinander im Wasser lagen, weiß und unschuldig wie drei Lämmlein auf der Wiese. Vorbei an Therapia, der Sommerresidenz der deutschen Botschaft, wo im Hafen die „LORELEY“ sich leise wiegte, der deutsche Stationär, auch ein weißes Lämmlein wie die anderen. Wir zogen den Hut und grüßten hinüber, denn die „LORE“ mit ihrem Kapitän war uns sehr ans Herz gewachsen. In der leichten Brise vom Schwarzen Meere her bauschte sich wohlig die deutsche Flagge. Für fünf Monate sahen wir sie damals zum letzten Mal.
An Bord der „CARINTIA“ befanden sich fast nur Mohammedaner und Armenier. Meine Frau und ich waren die einzigen Reichsdeutschen. Von Europäern gab es außer der Schiffsbesatzung nur noch ein polnisches Ehepaar aus Lemberg auf der Hochzeitsreise, das über Batum-Tiflis bis nach Täbris in Persien vordringen wollte, um einmal etwas anderes zu sehen als die meisten Hochzeitsreisenden. Er ein kleiner schüchterner Privatdozent mit mächtiger goldener Brille. Sie ein zierliches Persönchen in einem dicken Lodenkostüm, das sicherlich doppelt so schwer war wie sie selbst. Wir hatten vom ersten Augenblick an keine besonderen Sympathien füreinander. Unsere Rettung war der Kapitän, ein Riesenmensch, Montenegriner von Abstammung, aber leidenschaftlicher österreichischer Patriot, ein Labsal in all dem fremdartigen Völkergemisch um uns her, mit dem es nicht viel zu reden gab.
Als wir in das Schwarze Meer einliefen, änderte sich das bis dahin so liebliche Klima. Rau kam der Wind von Anatolien her über kahle Berge und menschenarme Ebenen.
Der Kapitän und wir redeten uns in eine immer größere Unruhe hinein. Welches war der Wortlaut des österreichischen Ultimatums, wie würde es aufgenommen werden? Aber das Schiff hatte keinen Marconi-Apparat, und an irgendwelche Telegramme war erst in Samsun zu denken. Unser cholerischer Kapitän wurde jetzt schon fuchsteufelswild bei der Vorstellung, dass es am Ende auch in Samsun keine neuen Telegramme gäbe. Wie es schon im Jahre zuvor während der Balkankriege gewesen war. Damals befuhr er dieselbe Strecke wie jetzt.
Nun, selbstverständlich erfuhren wir nichts, gar nichts in Samsun und mussten uns auf Trapezunt vertrösten. Hierhin kamen wir am 29. Juli, einem Mittwoch. Es war noch sehr früh am Morgen. Von dem Lloyd-Agenten war nichts zu sehen. Ich ließ mich an Land fahren, um den deutschen Konsul aufzusuchen. Der deutsche Konsul befand sich nicht in der Stadt, sondern irgendwo weit weg auf dem Lande und wurde für den Tag nicht mehr zurück erwartet. Hingegen gab sich ein schwarzhaariger und dunkelhäutiger Sekretär des Konsulats alle Mühe, mir auf Französisch klar zu machen, dass nicht die geringste Gefahr eines Weltkrieges bestände. Er wisse das ganz genau, und er machte allerhand dunkle Andeutungen über derweil eingelaufene Depeschen.
Als ich auf das Schiff zurückkehrte, nahm mich der Kapitän beiseite. Er war sehr erregt und sagte, es gehe das Gerücht um, die Österreicher beschössen schon Belgrad.
Um Mitternacht lagen wir stundenlang wartend bei Risa, dem letzten türkischen Hafenstädtchen nahe der russischen Grenze. Aber Nachrichten, die der Kapitän erhoffte, kamen nicht; und so musste er nach Batum weiterdampfen, wo wir in der Frühe des 30. Juli in den Hafen einliefen.
Der Hafen war wie ausgestorben. Hafenarbeiterstreik. Nur Polizei, Gendarmerie und russische Zollbeamte.
Endlich konnten wir an Land gehen. Wir taten es zögernd und ungern. Ich kannte Batum schon von früheren Reisen, ich kannte auch Russland ganz gut. Ich litt also keineswegs an den leichten Beklemmungen, wie sie manchen befallen, der zum ersten Mal den Boden eines ihm völlig fremden Landes betritt, und nun gar russischen Boden. Aber die unheimliche Ruhe im Hafen, die Erregung des Kapitäns, all seine kaum verschleierten Hoffnungen, dass es nun endlich losgehe – wir zögerten in der Tat, das Schiff zu verlassen. Am Ende wären wir auch geblieben und am anderen Tag wenigstens bis nach Trapezunt zurückgefahren, um dann doch die Reise über Erzerum zu wagen, worüber wir uns schon mit dem Kapitän unterhalten hatten, hätte er nicht, uns die Hand schüttelnd, den Witz gemacht: „Geben Sie nur acht, dass Sie nicht doch noch nach Sibirien kommen.“ Wir lachten. So schlimm würde es schon nicht werden.
Nicht weit von der „CARINTIA“ lag denselben Morgen am Batumer Kai noch ein großer Passagierdampfer der Hamburg-Amerika-Linie. Seinen Namen weiß ich nicht mehr. Wohl aber, dass er als erster Hamburger Dampfer zum ersten Male die neue Strecke Hamburg – New-York – Konstantinopel – Batum zurückgelegt hatte.
Wir fuhren in das erstbeste Hotel, um uns ein wenig zu erfrischen und mit dem nächsten Zug nach Tiflis weiter zu fahren. Der nächste Zug ging erst am Abend. Es hieß, er würde somit Militär besetzt sein, dass wir kaum noch einen Platz finden würden.
Schon am Nachmittag begaben wir uns zur Bahn und erwischten gerade noch ein freies Halbcoupé. Das polnische Ehepaar, das erst kurz vor Abfahrt erschien, musste sich mit Stehplätzen im Gang begnügen.
Ein Riesenzug, vollgestopft von oben bis unten mit russischer Infanterie. Da ich russische Verhältnisse kannte, machte es mich besonders stutzig, dass nicht nur die Fahrkarten, sondern auch die Pässe abverlangt wurden, was sonst auf russischen Eisenbahnen nicht geschieht. Und zwar besichtigten die Papiere nicht nur der Schaffner und der Zugführer, sondern auch ein Infanterieoberstleutnant, der das Halbcoupé neben uns innehatte ... Sehr merkwürdig und ungewöhnlich ... Bald bot sich Gelegenheit, mit unserem Nachbar in Uniform ein Gespräch zu versuchen. Leider sprach er keine europäische Sprache oder tat wenigstens so. Da meine Kenntnis des Russischen mehr als unvollkommen ist, war nicht viel aus ihm herauszubringen. Nur so viel verstand ich, dass er mir klar zu machen suchte, der Militärtransport geschähe der Streiks wegen, und dass ein Offizier die Kontrolle über die Bahnzüge ausübe, sei seit der Revolution von 1904/05 allgemein ... Hm ...
Der Offizier benahm sich überaus höflich und liebenswürdig, und als wir in der Frühe des 31. Juli in Tiflis ankamen und am Bahnhof wegen Streiks der Kutscher und Trambahnangestellten kein Vehikel aufzutreiben war, das uns in das gut eine halbe Stunde entfernte Hotel bringen sollte, gab der Oberstleutnant keine Ruhe, bis er doch noch einen Wagen für uns aufgetrieben hatte. Das polnische Ehepaar nahmen wir mit und fuhren zum Hotel London, das von einer Mainzerin, Frau Richter, geführt wird. Wer je im Kaukasus war, kennt dies Haus und seine Besitzerin, die sehr energische, überaus auf Reinlichkeit bedachte alte Dame, die, früh verwitwet, seit dreißig Jahren dies beste Hotel der kaukasischen Hauptstadt führte und jedem Deutschen, der zu ihr kam, wie eine Mutter war. Das klingt wie eine Art Grabrede und ist es auch. Denn die Russen haben inzwischen ihre beiden Söhne nach Sibirien verschickt, ihr selbst das Hotel ruiniert und sie dann, als alles ruiniert war, einfach nach Deutschland ausgewiesen.
An jenem letzten Freitag des Juli 1914 war freilich noch kein Gedanke an derlei. Das Hotel war voll besetzt mit hohen russischen Offizieren, so dass wir kaum noch Unterkunft finden konnten.
Ich gab sofort meine Pässe dem Portier und schärfte ihm ein, alles zu tun, damit ich die Pässe womöglich morgen wieder in Händen hätte. Er meinte aber gleich, es würde damit wohl bis Montag dauern. Ich musste die Pässe, da ich russisches Gebiet ja schon am Montag wieder verlassen wollte, abvisieren lassen, um ungestörten Austritt aus dem Lande zu erhalten. Zwar hätte ich das auch noch in Eriwan besorgen lassen können, aber hier, in der Hauptstadt, würden die Formalitäten sicher schneller erledigt als in einer kleineren Stadt.
Von Deutschen waren damals in dem Hotel die beiden Söhne der Frau Richter mit ihren Frauen, die Hotelbesitzerin selbst und ein bayrischer Ingenieur mit seiner jungen Frau, einer Wienerin. Er war erst vor wenigen Wochen nach dem Kaukasus gekommen, um in einer Kupferhütte bei Batum, die der Firma Siemens gehört, tätig zu sein. Zu diesen Deutschen kamen nun meine Frau und ich.
An Europäern gab es dann noch zwei Engländer und einen amerikanischen Missionar, der mit seiner Tochter gerade aus Persien angekommen war. Zwei Tage später gesellte sich zu uns noch ein junges holländisches Ehepaar, das im Kaukasus Hochtouren machen wollte.
Alle übrigen Hotelgäste waren russische Offiziere, unter denen sich zahlreiche Balten befanden, die bei den Tifliser Dragonern standen.
Natürlich war auch hier der österreichisch-serbische Konflikt das Tagesgespräch. Bei den Deutschen, bei den Russen, bei den Engländern. Aber auch der schwärzeste Pessimist ahnte nicht, was schon am Montag Wirklichkeit sein sollte.
Sonnabend, den 1. August, ging ich auf das deutsche Konsulat. Leider war der deutsche Konsul überhaupt nicht in Tiflis, sondern schon seit Wochen auf Heimatsurlaub in Deutschland. An seiner Stelle führte die Geschäfte ein Herr Lortz, Sekretär des Konsulats, unter tätiger Unterstützung des österreichischen Konsuls Dr. Corossacz, eines geborenen Ungarn. Der deutsche Sekretär erwies sich als so überarbeitet und aufgeregt, dass ich ihn nicht weiter stören wollte und zum österreichischen Konsulat ging. Der österreichische Konsul war sehr liebenswürdig und sehr zugeknöpft, also das, was man gemeinhin einen Diplomaten nennt.
Als ich wieder auf der Straße stand, traf ich zufällig einen mir von Konstantinopel her bekannten Syrier, der mich ganz entsetzt anstarrte und flüsterte: „Machen Sie, dass Sie fortkommen, es gibt Krieg!“ Ich lächelte ungläubig, aber er machte jedenfalls, dass er schleunigst weiter kam.
Am nächsten Tag gegen Mittag, es war Sonntag, wir saßen gerade beim Frühstück, erschien ein Balte im Restaurant, ein Baron Drachenfels, tuschelte geheimnisvoll nach rechts und links mit ihm bekannten Deutschen aus der Stadt, die am Sonntag hier ebenfalls frühstückten. Er schien sehr erregt zu sein, bat einige Deutsche, die er kannte, darunter auch den bayrischen Ingenieur und seine junge Frau, die Wienerin, zu sich an den Tisch und bestellte Sekt, weil er Kater habe und ihn wegschwemmen wolle.
Meine Frau und ich saßen nicht an dem Tisch, da wir damals noch niemanden von der Tafelrunde persönlich kannten. Der Sekt löste die Zungen, und da eine junge Frau am Tische saß, der man eifrig den Hof machte, ging es bald sehr lebhaft zu.
Wir fanden, diese Deutschen benähmen sich denn doch etwas zu laut in dieser immerhin kritischen Zeit. Wir sahen auch, wie ein Tisch mit russischen Offizieren immer unruhiger wurde über die vergnügten Deutschen. Nach allem, was sie taten und sagten, wusste ich, dass ihr Zusammensein rein zufällig und ganz harmlos gemeint sei. Aber ich kannte ja Russland und wusste, wie leicht man dort jemandem auch aus der größten Harmlosigkeit einen Strick dreht, wenn man will und einen Vorwand findet.
Wir verließen das Restaurant, zumal ich bemerke, wie auch der jüngere Sohn des Hauses immer unruhiger wurde über die fröhlich Sekt trinkende Gesellschaft. Ich hatte kein Recht, die Leute zu warnen, also entfernte ich mich lieber. Dass dies durchaus harmlos gemeinte Sektfrühstück noch so schwere Folgen haben würde, das hätte ich an jenem Sonntag noch nicht für möglich gehalten.
* * *
Die Kriegserklärung
Die Kriegserklärung
Als am Montag früh, den 3. August, meine Pässe noch nicht im Hotel waren und die Polizei auf telefonischen Anruf erklärte, es werde damit wohl noch bis morgen dauern, ging ich mit dem jüngeren Sohn unserer Hotelbesitzerin ein wenig spazieren, mir wieder einmal die schöne Stadt Tiflis anzusehen.

Tiflis um 1910
Wir schlenderten durch den schattigen Alexandergarten, denn es war sehr heiß, und gelangten zum Golowinskij-Prospekt, der breiten Hauptstraße, an der die massige Garnisonskirche, der Statthalterpalast, die Kommandantur, die öffentliche Bibliothek und das Kaukasische Museum liegen.
Hier begegneten wir gegen halb zwölf Uhr einem uns bekannten russischen Stabsoffizier. Wir grüßten. Er eilte hastig an uns vorüber, stutzte, kam auf uns zu, gab uns die Hand und sagte mit einem etwas hämischen Lächeln: „Haben Sie schon gehört? Deutschland hat uns den Krieg erklärt!“
Einen Augenblick standen wir wie vom Schlag getroffen. Dann aber lachte mein Begleiter dem Offizier ins Gesicht. So ein Unsinn!
Der Offizier eilte weiter.
Wir gingen stumm nebeneinander her, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt ... Unsinn! Warum sollte gerade Deutschland Russland den Krieg erklären?
Wir gelangten zum Eriwan-Platz, auf dem immer mehr Menschen zusammenkamen. Erregt, neugierig. Irgendetwas war im Gange.
Wir sahen, wie aus dem Rathaus ein Tisch auf den Platz getragen wurde. Ein weißes Tuch wurde darüber gedeckt und darauf ein großes goldenes Kreuz gestellt. Über dem Tisch wurde ein prunkvoller Baldachin errichtet. Einige Popen erschienen in goldüberladenen Gewändern.
„Irgendeine Seelenmesse wird gelesen, das kommt hier öfter vor“, sagte mein Begleiter, und wir gingen eilig weiter. Rein mechanisch wählten wir den Weg zur Ssergijewska, in der das österreichische Konsulat liegt.
Kaum waren wir in die Straße eingebogen, raste uns ein Zeitungsjunge mit einem Stoß Extrablättern entgegen. Wir entrissen ihm ein Blatt, auf dem nichts weiter stand als das lakonische Telegramm der Petersburger Telegraphenagentur, dass Deutschland Russland den Krieg erklärt habe. Trotzdem kam uns das allen beiden noch so unglaubhaft und ungeheuerlich vor, dass wir das Telegramm immer noch nicht ernst nahmen.
Der österreichische Konsul wusste nicht mehr als wir. Wir brachten ihm sogar durch unser Extrablatt die erste Kriegsnachricht ins Haus. Er schien geradeso wenig daran zu glauben wie wir. Er schien auch wirklich nichts Genaueres zu wissen, denn er erklärte, er erhalte von seiner Regierung seit Tagen keine Nachricht mehr. Trotz dringender Telegramme, die er aufgegeben habe.
„Aber in dem Petersburger Telegramm steht doch nur etwas von einem Krieg zwischen Deutschland und Russland. Kein Wort über einen Krieg zwischen Österreich und Russland. Warum sollte man Ihnen dann keine Telegramme aushändigen?“
Dr. Corossacz zuckte vielsagend die Achseln.
Der Sekretär des deutschen Konsulats telefonierte. Wir gingen mit dem österreichischen Konsul zum deutschen Konsulat.
Der Sekretär war höchst aufgeregt. Er glaubte sofort an den Krieg. Er bereitete alles vor, um das Konsulat zu schließen.
Wir beeilten uns, nach Hause zu kommen. Auf dem Eriwan-Platz wurde die erste Kriegsmesse unter freiem Himmel gelesen. Zum ersten Mal erflehten hier russische Popen den Sieg für die russischen Waffen und Untergang und Verderben für Deutschland. Zum ersten Mal scholl vom Eriwan-Platz hinter uns drein die russische Nationalhymne mit ihrer inbrünstigen, choralartigen Weise.
An den Ladentüren der deutschen Geschäfte auf dem Golowinskij-Prospekt standen die Inhaber und Angestellten mit bleichen Gesichtern. Aber keiner von allen glaubte an den Ernst der Lage. Sie alle waren unserer Ansicht: Stimmungsmache gegen die Deutschen.
Es war Mittag und der Golowinskij-Prospekt wimmelte von Menschen. Sie hielten das Telegramm in Händen oder warfen es schon, spöttisch lächelnd, von sich. Ernst wurde hier die Sache auch nicht genommen.
Dieselbe Stimmung herrschte im Hotel. Tragisch nahm man das Telegramm auch hier nicht. Weder die russischen Offiziere noch die ausländischen Zivilisten.
Die Offiziere unterhielten sich mit uns, wir mit den beiden Engländern. In dem ersten Hotel von Tiflis trieb an diesem Tag die erste Nachricht von dem nahenden Unheil die Gäste der verschiedenen Nationalitäten nicht voneinander fort, sondern zueinander.
Die beiden Engländer sahen zuweilen mit gespanntem Ernst in die Ferne wie auf ein ungeheuerliches Geschäft, das ihnen erst in flüchtigen Umrissen vor den Augen stand, und erwogen als kaltblütige Kaufleute die Chancen dieses Geschäftes.
Wir Deutschen aber hatten rote Köpfe und dachten nur an eins: Wie komme ich raus nach Deutschland?
Ehe wir uns dessen versahen, saßen wir Deutschen alle zusammen an einem Tisch: Frau Richter mit ihren Söhnen, der bayrische Ingenieur mit seiner Frau, ich und meine Frau. Dazu kamen bald noch Deutsche aus der Stadt. Was tun? Nur einer von uns war noch militärpflichtig. Aber wir alle wollten nach Deutschland und uns zur Verfügung stellen. Zu irgendetwas würde doch jeder von uns in dem bevorstehenden Riesenkampf gut sein. Also galt es packen und für die Pässe sorgen. Und als es so weit war, atmeten wir alle erleichtert auf, die Muskeln strafften sich, die Augen blitzten. O, jetzt ging es nach Hause nach Deutschland.
Und wieder saßen wir alle zusammen auf der Veranda des Hotels. Dunkel war es. Nur die Sterne leuchteten über der leise rauschenden Kura.
An einem Nachbartisch saßen die beiden Engländer. Nicht weit davon der amerikanische Missionar mit seiner Tochter, den die ganze Sache nichts anzugehen schien. Noch weiter fort russische Offiziere mit Lärmen und Lachen.
Zum ersten Mal empfanden wir: Wir sind von Feinden umgeben und müssen vorsichtig sein. Wir unterhielten uns nur leise miteinander. Wir zeigten äußerlich möglichst unbewegte Mienen. Aber in uns kochte es und war wilder Tatendrang.
Da, alles verstummt und lauscht in die Nacht. Was ist das? Wie ferner Gesang klingt es in das Rauschen der Kura. Es kommt näher und näher. Die russische Nationalhymne, feierlich, inbrünstig. Manifestanten singen sie und durchziehen die Stadt. Ich schleiche mich zum Hoteleingang, wo die Manifestanten vorbeikommen. Fünfzig halbwüchsige Burschen, denen ein Polizist das Zarenbild voranträgt.
Ich eile zur Veranda zurück. Der Gesang kommt jetzt von der Kurabrücke her. Wie auf Verabredung heben wir die Gläser mit Rheinwein und leeren das Glas. Sagen, was wir denken, dürfen wir nicht. Aber wir denken: Deutschland, Deutschland über alles!

Deutsche Infanteristen 1914
Am anderen Morgen schon in der Frühe zum österreichischen Konsul. Ich habe meinen Pass immer noch nicht. Er soll mir raten und helfen.
In der Amtsstube sitzt eine strahlende deutsche Mutter mit ihren zwei Söhnen. Der ältere, etwa neunzehnjährig, strahlt auch über das ganze Gesicht. Der jüngere, etwa sechzehnjährig, heult jämmerlich. Die Mutter meldet ihren Ältesten zum Militärdienst nach Deutschland. Deshalb strahlen die beiden so. Dem Jüngsten hat der Konsul eben gesagt, es könne gar keine Rede davon sein, dass er eingestellt würde. Deshalb heult er so jämmerlich. Mich durchzuckt es, und auch der Konsul ist sichtlich bewegt, trotzdem er sein glattrasiertes Gesicht gut in der Gewalt hat.
Es erscheinen andere Deutsche. Sie melden sich ebenfalls. Sie wollen alle dasselbe: einen Pass nach Deutschland.
Der arme Konsul, er befindet sich in einer schwierigen Lage. Er weiß ja offiziell durchaus nichts davon, dass Krieg ist. Er kann auch nichts Bestimmtes darüber erfahren. Er kann gar nichts anderes tun, als die Leute auf später vertrösten und sie bitten, nächstens wieder zu kommen, nachdem er sie an das deutsche Konsulat verwiesen hat.
Mir verspricht er natürlich auch, das seine zu tun, damit ich meine Pässe zurückerhalte. Aber er ahnte wohl damals schon, dass es damit nichts werden würde.
Vom Konsulat begebe ich mich zur Bank. Da man auf so einer Reise nicht mehr bares Geld mitnimmt, als unbedingt nötig ist, so hatte ich mein Hauptgeld nach Wan überweisen lassen. Da ich aber jetzt nicht mehr nach Wan wollte, sondern nach Deutschland, musste ich versuchen, ob ich nicht durch die Tifliser Bank mein Geld aus Wan erhalten könne. Auf der Bank riet man mir, sofort nach Wan um Überweisung des Geldes nach Tiflis zu telegraphieren. Man wollte das sogar selbst für mich besorgen und bat zu dem Zweck um meinen Depotschein. Ich zeigte ihn zwar, gab ihn aber nicht aus den Händen. Die Leute waren selbst für russische Verhältnisse etwas gar zu liebenswürdig. Ich wurde misstrauisch und wollte mich erst noch anderswo erkundigen.
Mein Misstrauen war berechtigt. Hätte ich dem Rat der Bank gefolgt, wäre ich das Geld losgeworden, denn sie zahlte schon wenige Tage nach der Kriegserklärung an Reichsdeutsche nichts mehr aus. Nicht einmal der österreichische Konsul konnte in den Besitz ihm überwiesener Gelder gelangen.
Die Ereignisse der allernächsten Zeit überstürzten sich dermaßen, dass ich ihrer chronologischen Reihenfolge nicht mehr sicher bin. Ich machte mir zwar sofort Aufzeichnungen, auf Grund deren ich alles der Reihenfolge nach erzählen könnte, aber diese Aufzeichnungen musste ich später vernichten. Ich vermag jetzt also nur noch die Haupteindrücke wiederzugeben.
Gegen Mittag komme ich in das Restaurant unseres Hotels und bleibe unwillkürlich an der Türe stehen. Mitten im Restaurant steht ein Herr entblößten Hauptes. Um ihn her russische Offiziere mit ernsten Gesichtern. Der Herr liest das soeben eingelaufene Manifest des Zaren vor, wonach Deutschland das unschuldige Lämmlein Russland hinterrücks mit Krieg überfallen hat. Nach der Verlesung erst tiefes Schweigen, dann die Nationalhymne ...
Höchste Zeit für uns alle, nach Hause, nach Deutschland zu kommen. Alle Deutschen im Kaukasus fühlen das und strömen in Tiflis zusammen. Hier befindet sich ja das einzige deutsche Berufskonsulat im Kaukasus. Es ist doch dazu da, den Deutschen zu helfen...
Ein junger, intelligenter deutscher Vorarbeiter erscheint im Hotel als Abgesandter von einem Dutzend, die in der Nähe von Batum in Arbeit sind. Er soll vom Konsulat Auslandspässe für sie alle besorgen. Er lacht über das ganze junge Gesicht vor Freude, dass es endlich losgeht. Alle zwölf Kameraden sind reisefertig wie er. Nur fort. Er eilt zum Konsul, kommt bald wieder und ist verzweifelt, weil der Konsul nicht helfen kann. Er eilt zur Bahn, um wieder nach Batum zu fahren und mit den Zwölfen auszurücken. Kaum ist er aus dem Hotel, stürzt Polizei in das Restaurant, die den jungen Deutschen sucht. Wir wissen natürlich nichts. Eine Stunde später ist der junge Mann wieder da, diesmal in Begleitung eines russischen Offiziers. Man hat ihn an der Bahn festgehalten. Man lässt überhaupt keinen Deutschen mehr aus Tiflis fort.
Immer wieder tauchen Deutsche in dem Hotel auf. Es ist ja ein deutsches Haus. Hier verkehren auch die Konsuln. Wo soll man sich Rat holen, wenn nicht hier? Bald darauf erscheint Polizei und führt die Deutschen fort. Wohin, wissen wir nicht ... Abend. Der österreichische Konsul kommt zu uns ins Hotel. Sein italienischer Kollege hat ihn endlich offiziell von dem Krieg zwischen Russland und Deutschland verständigt. Darauf ging er zum deutschen Konsulat. Noch einmal wurde die schwarz-weiß-rote Flagge hochgezogen. Dabei nur zwei Deutsche auf der Straße, Hut in der Hand. Die Flagge wurde eingeholt, der Mast zerbrochen, das Konsularschild entfernt. Ein deutsches Konsulat in Tiflis gibt es nicht mehr...
Ich: „Wie kommen wir jetzt aber nach Deutschland?“
Der Konsul: „Amerika hat den Schutz der Deutschen in Russland übernommen.“
Ich: „Der nächste amerikanische Konsul ist in Batum?“
Der Konsul nickt. Er setzt ein Telegramm an diesen Mr. Shmid auf, ungefähr des Inhalts, er möge so bald wie irgend möglich nach Tiflis herüberkommen, um den Schutz der hiesigen Deutschen zu übernehmen.
Andere Deutsche kommen hinzu. Der Konsul sucht uns zu beruhigen, indem er auseinandersetzt, der amerikanische Konsul werde uns unter amerikanischem Schutz auf ein neutrales Schiff nach Batum bringen und von dort über Konstantinopel nach Hause reisen lassen.
Uns Deutschen wird etwas leichter ums Herz. Deutschland hat uns nicht vergessen, es hat uns die Amerikaner zum Schutz bestellt.
Ich zum österreichischen Konsul: „Sagen Sie, ist dieser Mr. Shmid Berufskonsul?“
„Er ist Kaufmann. Wahlkonsul.“
Mir wird wieder schwer ums Herz, ich lasse es mir aber vor den anderen nicht merken, die so voll Hoffnungen sind. Der Mr. Shmid ist also Kaufmann, Geschäftsmann oder dergleichen. Er verdient also doch wohl durch Geschäfte mit Russen? Woher soll er dann die Energie nehmen, auch einmal, wenn es sein muss, energisch gegen die Russen aufzutreten? Ich spreche mit meiner Frau, die geborene Amerikanerin ist. Sie denkt darüber noch viel skeptischer als ich...