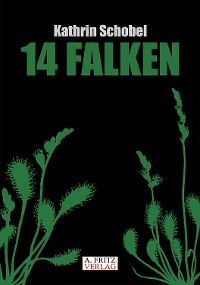Buch lesen: "14 Falken"
14 Falken
Kathrin Schobel

Originalausgabe Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe A. FRITZ VERLAG Umschlaggestaltung: A. James Satz: A. James Lektorat: Benjamin Schäfer a-fritz-verlag.de tw Drogen, Gewalt, Tod, Queerfeindlichkeit
Inhalt
Prolog
I
II
III
IIII
5
5 I
5 II
5 III
5 IIII
5 5
5 5 I
5 5 II
5 5 III
5 5 IIII
5 5 5
5 5 5 I
5 5 5 II
5 5 5 III
5 5 5 IIII
5 5 5 5
Epilog
Prolog

In alten Zeiten, als die Tage noch dunkel und die Venner Länder noch bis hinunter zum Wiehengebirge fruchtbar waren, besiedelten Moorbauern das Land. Der Lohn ihrer harten Arbeit wog kaum die Gefahr auf, der sie sich stellten, denn draußen im Moor konnte ein falscher Schritt bisweilen auch der letzte sein. Inmitten seiner lauernden Einsamkeit lebte die Moorhexe Grimetto in einer Schilfburg. Kein dunkles Wasser spiegelte ihre Anmut, und nur der jaulende Wind sprach von ihrer Schönheit, wie ein geschlagener Hund, der seinem Herrn doch treu ist. Aus Angst vor ihrer großen Macht wagte sich nie eine Seele zu ihr hinaus. So war es auch nicht die Absicht eines jungen Moorbauern, der sich eines Tages in ihre Heimat verirrte; dorthin, wo es keine Pfade mehr gab, wo der Nebel gierig seine Rufe verschlang und die knorrigen Finger der abgestorbenen Äste ihn zu sich in den Morast lockten. Als er schon drohte, die feste Erde zu verlassen, rief ihn die Stimme einer Frau zurück. Das Leben des jungen Mannes war gerettet.
Vor ihn trat Grimetto. Ein einziger Blick in ihre grünen Augen brachten den Moorbauern schier um den Verstand, und er wich ihr nicht mehr von der Seite. So dachte man ihn bald als vermisst, und ihr Vater ließ das Gehöft Trauer tragen. Als der schwere Winter jedoch vorbei war, am Morgen des ersten Frühlingstages, da klopfte es an seine Tür. Dort stand sein Sohn, und an der Hand führte er Grimetto. Er bat den Vater um seinen Segen für ihre Hochzeit. Der alte Moorbauer jedoch erkannte Grimetto und schalt seinen törichten Sohn, dass er eine Hexe auf sein Gut gebracht hatte. Mit einem Pfiff ließ er seine drei großen, schwarzen Hunde auf sie los und jagte die verängstigte Grimetto vom Hof.
Der junge Bauer jedoch fiel in tiefe Trauer über den Verlust seiner Geliebten. So sehr sein Vater sich auch mühte, das Dorf Glauben zu machen, er sei aus dem grausamen Zauber der Hexe erwacht, es zog seinen Sohn immer wieder hinaus in das Moor. So schloss er ihn in schließlich seine Kammer ein und bot ihm die Freiheit nur gegen eine Hochzeit mit der Enkelin der Pilzgrete. Ein ganzes Jahr verging, bis der erschöpfte Mann einwilligte. Sein Vater vollzog die Hochzeit noch am selben Tage.
Ein Jahr später bereits gebar die Frau des jungen Moorbauern ein Kind, das gleich darauf starb. Ebenso geschah es im nächsten Jahr. »Die Moorhexe sitzt ihm im Blut«, munkelte man. Im dritten Jahr jedoch brachte seine Frau einen Jungen auf die Welt, und obwohl sie dafür ihr Leben ließ, schien das Kind gesund. So wuchs es zu einem Jüngling heran. Als er in das Alter kam, den Hof zu verlassen, nahm ihn sein Vater mit der Kutsche auf eine Reise zu einer entfernten Hochzeit. Je tiefer sie ihr Weg in das Venner Moor verschlug, desto schweigsamer wurde der Vater. So fragte ihn der Junge: »Was macht dich so traurig? «
Der Moorbauer antwortete nur: »Ihre Augen.«
Und wie er das sprach, da scheuten die Pferde unter fürchterlichem Getöse und warfen sich zur Seite. Der Karren kippte und begrub Vater und Sohn unter sich. Als die Knechte schließlich den erschlagenen Vater und seinen verletzten Sohn bargen, rief es im gesamten Dorf: “Das hat die Hexe Grimetto getan!”
I

Es ist noch nicht mal zwölf, aber schon dunkel und erstaunlich schwül. Gwen hasst diese unvorhersehbaren Übergänge von Sommer und Winter, die sich Frühling und Herbst schimpfen. Für sie sind das keine Jahreszeiten, sondern undefinierbare Zwischensphären von Wetterumstellung und vor allem immer genau so, dass sie nicht zu dem passen, was Gwen gerade trägt. Und weil sie ihre Lederjacke mehr vergöttert als alles andere, ist ihr der Winter lieber, wenn sie schon wählen muss.
Nichts an diesem Abend passt zu Gwen. »Nichts, außer der Kneipe vielleicht«, hat sie schon beim Reingehen gedacht. Leichter Nieselregen sitzt ihr im Nacken und wenigstens das Timing mit dem Schauer stimmt, denn es beginnt mit ihrem Schritt über die Türschwelle zu schütten. Der klägliche Rest Regen lässt sich von ihrem Haar schütteln wie Blütenstaub. Ohne mit den Augen bei der Sache zu sein, zieht sie ihre Jacke aus und wirft sie über einen Barhocker, bevor sie sich daraufsetzt. Es ist ironisch, denkt sie, dass sie schon so oft in der Spiel-Bar war, dass sie die Stadien der Bezeichnung als stille Streunerin über eine Drogenfahnderin bis hin zu einem Stammgast alle schon durchlaufen hat. Ironisch nicht, weil die Leute damit Unrecht haben, sondern weil sie genau weiß, dass ihr Dienstausweis nur einen Handgriff entfernt ist. Gwen fragt sich, ob es die Sache zu doppelter Ironie macht, dass sie tatsächlich nicht wegen der halbstarken Dealenden oder den Illegalen kommt, sondern für den Whiskey.
»Blended Malt.«
»Kommt.«
Eine Kneipe, findet Gwen, ist wie ein Kino. Bestimmte Filme spielen zu bestimmten Zeiten, es finden sich Zuschauende für alle Genres und es gibt einen kleinen Kreis von immer gleichen Kinofans, die eigentlich nur da sind, weil sie sonst zu Hause einsam wären. Jetzt, so gegen 12, wechseln die Studierenden wie auf Handschlag nach und nach die Stammtischrunden und Kegelgruppen aus. An den kleinen Ecktischen sitzen die ewig stoischen Einzeltrinkenden, die, wie Gwen vermutet, erst bemerken, wie ihr Milieu sich verändert, wenn die Musik von Radiopop auf Oldierock umschwingt. Gwens Fußspitze tippt den Takt von White Winged Dove. Wenn die Bar wirklich wie ein Kino ist, ist Gwen der Film Noir. Sie hätte die Lederjacke anlassen sollen, denkt sie und grinst gegen den Glasrand. Für die Hauptrolle würde ihr zum Whiskey nur noch die verführerische Schönheit fehlen, die am Ende ihr Verderben sein würde.
»Noch einen... absolute Scheiße ist das ...«
Gwen schielt möglichst unbeeindruckt nach rechts, wo eine junge Frau zwei Plätze weiter sitzt und mit ihrem vollen Glas spricht – auf dem einzigen Barhocker, dessen rotes Polster noch nicht völlig rissig ist, als habe sie das mit Absicht gemacht. Gwen friert in der Bewegung ein und trinkt so langsam, dass die Eiswürfel an ihrer Oberlippe brennen. Der Barkeeper scheint es schon aufgegeben zu haben, mit der Frau zu sprechen. Was Gwen an ihrem Anblick stört, kann sie erst sagen, als sie sie genauer mustert. Die Kleine hat zu wache Augen für Selbstgespräche, eine zu gepflegte Erscheinung für ein nächtliches Saufgelage und, wie Gwen findet, ein viel zu hübsches Gesicht für diese Altvaterreue. Die Show ist also entweder schlecht inszeniert oder absolut ehrlich. Gwen hofft auf die erste Variante, weil sie niemanden mit nach Hause nimmt, der nicht bei sich ist. Außerdem verlieren so hübsche Begriffe wie “Würde” und “Selbstkontrolle” in der dunklen Sphäre des Überganges von Trinken zu Betrinken rapide an Wert.
Irgendwann in den 80ern waren Kneipen mal ein Auffangbecken für solche Leute, die innerlich irgendwie kaputt sind, hat Gwen sich sagen lassen. Aber das hat sich gelegt, seit die Polizei das auch geschnallt hat und verdeckte Ermittelnde schickt. Kneipen haben Alkohol und Alkohol hat immer Saufende, die die Kontrolle über ihren Schluckreflex verloren haben, aber die richtigen Deals, die wahren filmreifen kriminellen Machenschaften, die gibt es hier nicht mehr. Der Mythos der verstärkten Schutzpolitik hat sie irgendwie outgesourced, findet Gwen, raus in die dunklen Straßen der Großstadt, in Garagen, Hinterhöfe und 2-Zimmer-Wohnungen, Küche, Bad, Frau und drei Kinder. Vielleicht ein Hund. Jedenfalls kann Gwen an einer Hand abzählen, wie viele Einsätze sie in Kneipen gehabt hat, an denen mehr dran war als eine Prügelei. Die Zeiten sind vorbei. Und ohne die Drugs bleiben nur der Rock ‚n Roll und der Sex.
Gwen ist versucht, der Dramatikerin ein Bier zu spendieren. Ein Bier, weil es wenig Alkohol hat und spendieren, weil Gwen dann eine Ausrede hätte, sich neben sie zu setzen und rauszufinden, woran sie ist. Scheiß auf die Polizeimarke, die kann ihr beim Flirten auch nicht helfen.
Als könne sie Gedanken lesen, schiebt sich die Frau schwerfällig vom Hocker, wischt sich über das Gesicht und geht in Richtung Bad.
Fünf Sekunden.
Ein Nick zum Barkeeper, dann auf die Jacke. Noch mal fünf Sekunden Pause an der Jukebox. Das einzige Teil in dem Laden, das wirklich Vintage aussieht und nicht einfach nur alt. Gäste mit inbegriffen. Dann durch die Tür. Im Flur stinkt es scharf nach durch den Darmtrakt gejagtem hochprozentigem. Könnte Gwen jeden Stehpinkler strafrechtlich verfolgen, würde sie's tun. Zum Glück haben die Nutzenden des Damenklos meistens die falschen Genitalien für so eine Sauerei, aber Gwen findet trotzdem, dass es mutig ist, anzunehmen, dass die Kabinen sauberer seien. Die Kleine von der Bar hat eine davon belegt. Schnell blockiert Gwen das Klo zwei Türen weiter, spült und wäscht sich unnötig lang die Hände. Ihr Zielsubjekt benutzt das Becken neben ihr und sieht aus, als sei es aus den Wänden gewachsen. Ein verblasster Graffitimauerfall aus abblätternder Farbe und Putz, gleichgültige Neonröhrenkälte auf Klosprüchen und Namen von Liebenden, Betrunkenen oder Gangs und wer weiß schon, was davon noch Bedeutung hat.
»Man, was für ein beschissener Tag, hm?«
»Hm.«
Gwen fragt sich, wie viel länger sie sich realistisch die Hände waschen kann. Sie sollte irgendwann vor der Fremden damit aufhören, wenn sie nicht wirken will, als hätte sie gerade Kokain von ihrer Hand geschnupft. Doch zu ihrem Glück lässt ihr die junge Frau keine Wahl.
»‚Ich trenne mich‘, hat er gesagt. ‚Schatz, es ist nicht wie es aussieht‘, hab‘ ich gesagt. ‚Ich hasse dich‘, hat er geschrien. ‚Leg das Messer weg‘, hab‘ ich gewimmert. Er hat mich rausgeworfen. Hat den Fernseher behalten, meine Konsole, den Hund...«
Was für ein gequirltes Melodrama. Gwen verdreht die Augen. »Das muss hart für dich sein.«
»Ist es!« Sie wäscht sich jetzt auch schon ziemlich lang die Hände. »Ich hatte den Hund, seit ich ein Kind war... Kindergärtner sind herzlos.«
»Du warst mit einem Kindergärtner verheiratet?«
»Wir waren nicht verheiratet.«
»Dann darf er den Hund auch nicht behalten.«
Die junge Frau räuspert sich ertappt. »Dürfte er das, wenn wir’s wären? Dann erzähle ich nochmal von vorne.«
Gwen hebt die Schultern. »Weiß ich nicht, kann sein.«
»Dann reden wir mal lieber beide nicht von was, von dem wir keine Ahnung haben. Ich bin sowieso nicht hier, um zu jammern.«
»Und warum dann?«
»Ich hatte auf Ablenkung gehofft.«
Dieser Tonfall.
Genug subtile Veränderung, dass Gwen aufmerksam wird. Und den Fehler macht, der Fremden endlich ins Gesicht zu sehen.
Ein spitzes Kinn unter scharfen Zügen um den lächelnden Mund unter einer schmalen Nase unter aufmerksamen Falkenaugen hinter dünnen Brillengläsern mit dunklen Brauen unter wildem Literaturstudentenhaar, wie Gwen das nennt. Sie hat südländische Haut und sieht jung aus. Gwen ist dankbar, dass sie größer ist als die Fremde, denn so kann sie sie in Gedanken Kleine nennen, ohne das Gefühl zu haben, sie irgendwie herabzusetzen. Sie ringt sich ein Lächeln ab.
Die Frau mit den Falkenaugen lacht auf. »Das ganze Drama nur, weil ich seine Cousine gevögelt habe. Stellt sich aber auch an, oder?«
Das war‘s.
Noch nie hat Gwen einen so schlecht platzierten Hinweis erlebt. Brillen lassen manche Menschen eben doch nur solange klug aussehen, bis sie den Mund aufmachen. Sie lacht künstlich zurück und schüttelt sich das Wasser von den Händen auf die Schuhe. Die Kleine ist zurecht perplex, vergisst das durchsiffte Papiertuch in ihrer Hand und grinst unsicher.
»Ich hab‘ wohl nicht allein hinter‘n Durst gekippt.«
»Du hast was vergessen«, raunt Gwen amüsiert.
»Hab‘ ich?«, fragt der Falke.
»Ja. Betrunken zu klingen.«
Stille.
Aber keine seltsame. Sondern die, die man hat, wenn sich ein Gespräch in voller Deutlichkeit nonverbal im Raum aufbaut. So, weiß Gwen, reden Kriminelle miteinander, wenn die Polizei im Raum ist. Jedenfalls erinnerte es sie daran, und sie kann sich nicht entscheiden, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist.
»Das kann man ändern«, bricht die Fremde die Stille mit fester Stimme. »Hast du ein paar Euro für ein Bier? Und dann noch fünf?«
»Willst du dich wirklich betrinken?«
Endlich erinnert sich Gwen daran, dass sie noch mit halbnassen Händen mitten im Badezimmer steht und angelt sich ein Papiertuch. Die Tür trifft sie fast ins Gesicht, als ein verdächtig junges Mädchen an ihr vorbei in die Kabine flüchtet. Der Falke verzieht das Gesicht.
Gwen hasst Kotzgeräusche.
»So willst du heute enden?«, fügt sie hinzu und deutet mit dem Daumen auf die Kabinentür.
»Bis ich nicht mehr nach Hause laufen kann.«
Sie meint das in etwa so ernst, als wenn sie sagen würde ‚Ich habe nicht darauf gehofft, dass du mir ins Bad folgst‘.
»Dann muss ich dir ein Taxi rufen.«
»Und ich muss anfangen, tatsächlich was zu trinken.«
»Das Taxi ist schneller als du.«
»Dann fahr ich nüchtern nach Hause und du zahlst.«
Das Taxi lässt keine Viertelstunde auf sich warten. Der Falke hat eine nervöse Ader in der Art, wie sie an dem Zipfel ihrer Jacke spielt und sich sichtbar Disziplin abringt, nicht nachzugeben und Bilder auf die beschlagene Fensterscheibe der Bar zu malen. Sie hätte sie wenigstens nach dem Alter fragen sollen, denkt Gwen. Die Kleine wirkt jünger als sie aussieht, aber spricht älter als sie vermutlich ist. Und hat sicher auch einen Namen. Vielleicht auch zwei. Gwen hasst das Wort “Grazie”, aber sie klebt unbemerkt an der Fremden wie eine Fliegenfalle an ihrer Schuhsohle und gibt ihr einen Hauch von rebellischem Adelsnachwuchs, sodass es Gwen nicht wundern würde, wenn ihr Nachname dreiteilig wäre.
Ein Zücken der Polizeidienstmarke und Gwen wüsste ihn, Adresse, Alter und ihre genaue Augenfarbe, die je nach Licht zwischen einem verbrauchten Grün und einem seltsamen Bernsteinton variiert. Kleinigkeiten, die sie ärgern, weil sie sie nicht genauer bestimmen kann, aber vor allem, weil sie ihr auffallen. So wie das neue Gefühl einer völlig akzeptablen, subtextlosen Stille zwischen ihr und der jungen Frau. Nachdem Gwen ihre Getränke bezahlt und dem Barkeeper gutes Trinkgeld für das Bewachen ihrer Jacke gegeben hat, hat sie nur noch mit dem Taxiservice gesprochen. Seitdem beansprucht eine Zigarette ihre Lippen.
»Und wessen Adresse ist das jetzt?«
Gwen tritt die Stille ein wie eine offene Tür und macht deutlich, was er von den Märchen des Falken hält.
»Na da, wo ich jetzt wohne.«
»Und das wäre wo?«
Münchhausen bläst nachdenklich die Wangen auf. »Bei einem Kumpel. Benjamin. Netter Typ, hat zwei Katzen in einer viel zu kleinen Wohnung, weil er dachte, die werden nicht so groß. Menkuns oder so. Jurastudent, Klugscheißer in Ausbildung.«
»Hm.«
Gute Improvisationsgabe ist eine Option. Dass sie die gleiche Nummer bei jedem dritten Flirt durchzieht, auch. Gwen schmälert die Augen und versucht, sich nicht davon nerven zu lassen, dass die Katzenexpertin an ihrem Anschnallgurt zupft. Ihn immer wieder ein Stück herauszieht und dann zurückschnellen lässt. Wie ein Maßband oder ein Staubsaugerkabel oder ein gottverdammtes Gummiband. Sie muss das eine Kind in einer Klasse voller Hochbegabter und Aufmerksamkeitsschwachen gewesen sein, das tatsächlich ADHS hat, aber ihr hat keiner geglaubt.
»Benjamin wird begeistert davon sein, dass du so spät zurückkommst«, wirft Gwen ein.
»Ach, der packt das schon.«
Etwas vibriert. Bevor Gwen ihre tiefen Jackentaschen nach ihrem Handy durchsuchen kann, hat der Falke ihres schon herausgezogen und legt ein paar Sekunden theatralische Pause ein, bevor sie grinst.
»Wenn man vom Teufel spricht. Eins von den Höllentieren ist beim Notdienst. Er weiß nicht, wann er wiederkommt und ich hab‘ keinen Schlüssel dabei.«
Sie klingt vergnügt und Gwen ahnt, dass die Seriosität der Performance es vorhin nicht mal mit ihnen bis ins Bad geschafft hat.
»Ach wirklich«, erwidert sie und schmiert so viel Subtext auf ihre Stimme, wie sie kann. Leute, die glauben, sie hätten sie am Haken, hat Gwen ja besonders gern. Besonders, wenn sie Recht haben.
»Ich will nicht auf der Straße übernachten müssen... ich frage Bens Nachbarn oder so, dem alten Sack kommt es sicher ganz gelegen, mich in sein Bett zu lassen.«
»Bist du auf irgendwas?«
Gwen findet es beinahe putzig, wie schnell man der jungen Frau ansieht, wenn sie mit einer Frage nicht rechnet. Der Taxifahrer schweigt stoisch.
»Auf irgendwas?«
»Hast du was genommen?« Gwen gibt ihr einen abschätzigen Blick von der Seite.
»Oh. Nein, ich rede immer so schnell.«
Sie grinst breit. Weiße, gerade Zähne. Definitiv nicht mehr als eine Gelegenheitstrinkerin, wenn überhaupt. Und Raucherin schon gar nicht. Dafür riecht sie viel zu gut. Gwen hat das plötzliche Bedürfnis, an sich zu schnuppern. Aber vorerst würde sie ihrem Deo vertrauen müssen. Der Falke murrt noch einmal herzerweichend und Gwen kann und will sich nicht entscheiden, ob es sie nervt, sie amüsiert oder ob sie einfach nur Mitleid hat. Vermutlich, denkt sich Gwen grimmig, als sie dem Taxifahrer ihre eigene Adresse gibt, ist die Kleine auch einfach nur untervögelt. Eigentlich hasst Gwen dieses Wort, weil es klingt wie das Echo von jedem scheiß Klischee über Homosexuelle, das sie kennt, aber wieso würde sie mit so einem Spielkind nur für das hübsche Gesicht nach Hause fahren, wenn sie nicht auch... Gwen beschließt, sich vor sich selbst nicht rechtfertigen zu müssen.
Der Taxifahrer murmelt ein »Nordstadt wird aber teurer« und wendet dann bei einer Tankstelle. Gwen hätte dem Falken das selbstzufriedene Schmunzeln am Liebsten schon sofort aus dem Gesicht gebissen.
II

Die Morgen am nördlichen Stadtende beginnen noch vor Sieben.
Am Wochenende ist es bis tief in die Nacht laut. Gwen hat eine Wohnung an direkt der Hausecke, beeindruckender Ausblick auf einen winzigen Vorplatz, aber immer noch besser als eine Häuserwand so nah, dass man quasi nur die Fenster zu öffnen braucht, um sich mit den Anwohnenden eine Tasse Kaffee zu teilen. Von drei bis sechs ist es still. Dann, mit den ersten Sonnenstrahlen, melden sich verwirrte Singvögel und verirrte Betrunkene. Erstaunlich, dass es die hier überhaupt gibt. Vögel, meine ich. Wenn sie sich mit dem traurigen bisschen Grün in den vermüllten Straßen zufriedengeben, ist es schwer sich auszumalen, wie es wohl weiter Richtung Autobahn aussehen muss.
Der Sex war gut.
Nicht bahnbrechend, nicht Nachbarn-belästigend-laut, aber gut. Das Beste daran ist immer der Anfang, wenn die Ästhetik der Stadtnacht einen vorher in Benzin getaucht hat und man sich wie Streichholz an Streichholz aneinander reibt, bis man brennt, Stichflamme. Wenn man die Hitze nicht nutzt, lodert man danach alleine weiter und wenn man zu lange braucht, brennt man irgendwann aus, bevor man fertig ist. Wir haben keine Zeit mit geordnetem Ausziehen verschwendet, sondern unsere Klamotten willkürlich über Einrichtungsgegenstände verteilt, als ob die nicht hinsehen dürfen. Für so manche Einsiedelnde sollen Möbel ja wie Kinder sein. Gwens liebloser Ikea-Krempel ist dann eben wie die Zweckgeburt fürs Kindergeld.
Sie spricht im Schlaf, ich nicht. Ich war wach zwischendurch und habe mich dicht über sie gelehnt, aber ich habe nichts verstanden außer “Ist das Ihr Hund?” und “Hol die Kartoffeln aus dem Ofen”.
Ich glaube, sie wird wach, also stelle ich mich schlafend. Ich liege auf dem Bauch und bin bis zur nackten Hüfte bedeckt, wie in einem Hollywood Blockbuster. Sie schiebt die raschelnden Laken von sich und hievt sich aus dem Bett. Als sie ihre Klamotten zusammensucht, gibt sie sich nicht mal Mühe, leise zu sein, um mich nicht zu wecken. Jetzt pausiert sie. Ich blinzle und sehe nur, dass sie meine Hose in der Hand hat, bevor ich die Augen wieder schließen muss, weil mir eine Haarsträhne reinfällt. Creep. Sie geht geradewegs ins Bad. Kein Kuscheln, kein Kuss, kein Hauch von Morgenmundgeruch. Reimt sich fast. Sie schließt hinter sich ab. Bisher passiert nichts, mit dem ich nicht gerechnet habe. Aber wenn Gwen das schaffen würde, wäre das auch ein Kunststück.
Sobald ich höre, dass sie die Dusche anschmeißt, schmeiße ich mich auch an. Ich schüttele mir faul die Decke vom Unterleib, setze mich auf und strecke mich. Weil Madame es gestern Abend nicht für nötig gehalten hat, das Licht anzuschalten, als wir uns in ihre Wohnung geküsst haben, habe ich keine Ahnung, wie es hier aussieht. Irgendwie habe ich leere Bierflaschen erwartet und einen Aschenbecher pro Kindergeld-Möbel. Aber je genauer ich mich umsehe, umso mehr Liebe fürs Detail erkenne ich in ihrer minimalistischen Dekoration. Kein Staub auf dem Fernseher, nichtssagende, aber farblich abgestimmte Bilder an der Wand und einer der Schränke fällt total aus dem Rahmen. Sieht aus wie eine Vintage-Kommode mit diesem ausgeblichenen Vibe von Möbel-Burn Out. Ich hätte diese stilistische Beweisführung nicht gebraucht, um zu wissen, dass Gwen hinter ihrer Fassade aus Gips und Raufasertapete einen Sinn für Stil züchtet. Immerhin hat sie mich mit nach Hause genommen. Und nicht mal nach meinem Namen gefragt.
Ich setze mir meine Brille auf und fahre mir mit der Hand durch die Haare. Ich liebe meine Haare, da könnten sich noch mindestens fünf Hände mehr drin vergraben, wenn es nach mir geht. Macht dann insgesamt Sieben. Und das ist genau so viel wie die Minutenzahl, die ich schätze zu haben, bevor Gwen wieder reinkommt. Also mache ich Türenraten beim Aufstehen. Die Eingangstür kenne ich von gestern, das Bad ist die, hinter der es rauscht, ansonsten gibt es nur noch eine und die ist angelehnt. Meine Brille hat einen Fleck unten am rechten Glas, der mich stört. Schnell hüpfe ich mir meine Hose über die Hüften und schiele vor und nach dem Shirt über meinem Kopf in den Raum nebenan. Wohnzimmer mit Fernseher und Couch, offene Küche, nichts zu holen. Kurz bin ich versucht, uns Frühstück zu machen, aber das geht immer schief.
Ich konzentriere mich lieber auf das Schlafzimmer. Meine Jacke liegt zusammengeknautscht neben einem Stuhl, auf dem sich so viel Dreckwäsche stapelt, dass ich auf den ersten Blick nicht sagen kann, ob Gwen irgendwas davon gestern noch getragen hat. In seiner Nähe riecht es nach ausgetragenem Zigarettenrauch und eingetrocknetem Regen. Draußen röhrt die Müllabfuhr oder irgendwas anderes, was sich langsam bewegt und piept. Ich suche nach ihrer Hose.
Nichts.
Dann sehe ich ihre Jacke, schwarzes Leder und so abgeranzt, dass ich gestern Abend fast schon ein bisschen beleidigt war, nicht fordernd daran ziehen zu dürfen. Vielleicht war die Jacke das Wunschkind. Schmunzelnd pflücke ich sie von der offenen Schranktür. Ich werde darin untergehen, denke ich, und werfe sie über.
Verdammt warm. Riecht nach Leder und Wetter und Lungenkrebs, quasi wie Gwen Minus den Duft von „Ich bin leicht zu haben“ von gestern Abend. Sie ist mir zu groß und passt mir sogar über meine eigene Jacke, stelle ich fest. Hat was Heimisches, wie ein Kokon aus totem Tier. Ich erinnere mich an einen Film über einen Jungen, der nach einem Unfall die Kälte überlebt hat, weil er in den zerfleischten toten Körper seiner Mutter gekrochen ist. War eine Komödie, glaube ich. Ich taste die Taschen ab. Jackpot. Es ist immer entweder die rechte hintere Hosentasche oder die Jackeninnentasche, wenn sie eine hat.
Ihr Portemonnaie sieht aus wie die Jacke. Schwarz, ledrig, eingerissen. Aber Kunstleder, und viel zu klein für das ganze Papier. Gwen ist ein Kassenbon-Messi, denke ich und gehe die Karten durch. Ausweis (ich checke lächelnd unser Geburtsdatum), Führerschein, EC-Karte, versichert bei der DAK, Subway-Kundenkarte... ich halte inne. Blassgrünes Papier mit Eselsohren. Ich ziehe es heraus und sehe zum ersten Mal in diesem jungen Leben einen Dienstausweis.
»Oh Scheiße«, murmele ich.
Im Badezimmer wird es still.